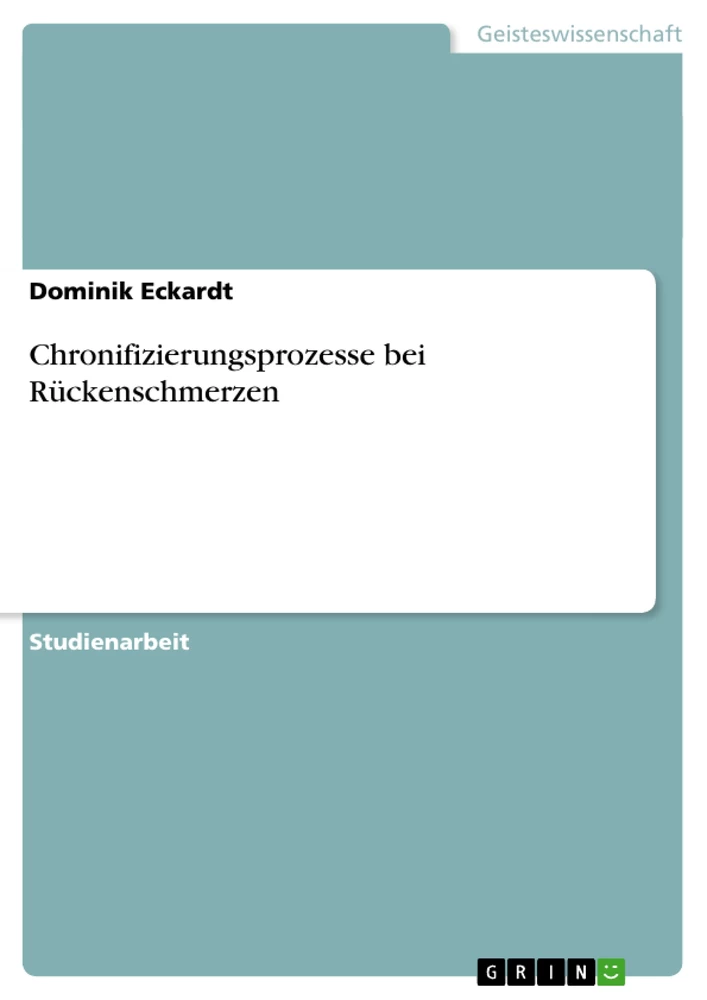Einführend kann Schmerz als „komplexe Sinneswahrnehmung unterschiedlicher Qualität“ definiert werden, welche in der Regel durch die „Störung des Wohlbefindens als lebenswichtiges Symptom von Bedeutung ist und in chronischer Form einen eigenen Krankheitswert erlangt“.1 Nach Jänig ist Schmerz ein Phänomen, „das eine aktive Antwort des Organismus auf periphere Reize ist, und aus vier Komponenten besteht: Erstens einer sensorisch-diskriminativen, zweitens einer kognitiven, drittens einer affektiven und viertens einer autonomen bzw. somatomotorischen Komponente“. Demnach ist Schmerz das Ergebnis der Interaktion des peripheren mit verschiedenen Instanzen des zentralen Nervensystems.
Als Nozizeption werden die physiologischen Vorgänge verstanden (Aufnahme, Weiterleitung und Verarbeitung der noxischen Reize), als Schmerzerfahrung wird das psychophysiologische Phänomen verstanden (emotionale, kognitive und verhaltensbezogene Momente). Berichtet ein Mensch von seinen Schmerzen, so meint er seine Schmerzwahrnehmung, seine Schmerzerfahrung und sein Schmerzerleben – damit kommt zum Ausdruck, dass die gesamte Person durch die Schmerzen beeinträchtigt wird.2
[...]
1 Pschyrembel (1994): 1380.
2 vgl. Ruoß (1998): 15.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Terminologische Klärung
- 1. Schmerz
- 2. Akuter vs. chronischer Schmerz
- III. Psychologische Aspekte des chronischen Schmerzes, der Schmerzverarbeitung und der Chronifizierung von Schmerzen
- 1. Das operante Modell
- 2. Diathese-Stress-Modell
- 3. Psychodynamische Erklärungsprinzipien
- 4. Weitere Erklärungsprinzipien
- 5. Psychosoziale Befunde
- IV. Chronische Rückenschmerzen
- 1. Allgemeines
- 2. Rückenschmerz ohne Pathologie
- 3. Prävention chronischer Rückenschmerzen
- 4. Risikofaktoren für chronische Rückenschmerzen
- V. Psychologische Behandlungsmöglichkeiten bei chronischen (Rücken)Schmerzen
- 1. Entspannungsverfahren
- 2. Operante Schmerztherapie
- 3. Biofeedback
- 4. Kognitiv-verhaltenstherapeutischer Ansatz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Chronifizierungsprozesse bei Schmerzen, insbesondere Rückenschmerzen. Die Arbeit beleuchtet zunächst das Phänomen Schmerz, geht auf akute und chronische Schmerzen ein und analysiert anschließend chronische Rückenschmerzen im Detail. Abschließend werden psychologische Behandlungsmöglichkeiten vorgestellt.
- Definition und Differenzierung von akutem und chronischem Schmerz
- Psychologische Aspekte chronischer Schmerzen und deren Chronifizierung
- Spezifische Betrachtung chronischer Rückenschmerzen: Ursachen, Prävention und Risikofaktoren
- Psychologische Therapieansätze bei chronischen Schmerzen
- Zusammenhang zwischen Schmerzverarbeitung und psychosozialen Faktoren
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I: Einleitung Die Einleitung führt in das Thema Chronifizierungsprozesse bei Schmerzen ein und beschreibt den Aufbau der Arbeit.
Kapitel II: Terminologische Klärung Dieses Kapitel bietet eine Definition von Schmerz, differenziert zwischen akutem und chronischem Schmerz und erläutert verschiedene Aspekte der Schmerzempfindung.
Kapitel III: Psychologische Aspekte des chronischen Schmerzes Hier werden verschiedene psychologische Modelle und Erklärungsprinzipien für die Entstehung und Aufrechterhaltung chronischer Schmerzen diskutiert, sowie psychosoziale Befunde vorgestellt.
Kapitel IV: Chronische Rückenschmerzen Dieses Kapitel befasst sich speziell mit chronischen Rückenschmerzen, ihren Ursachen, Präventionsmöglichkeiten und relevanten Risikofaktoren.
Kapitel V: Psychologische Behandlungsmöglichkeiten In diesem Kapitel werden verschiedene psychologische Behandlungsansätze für chronische Schmerzen, wie Entspannungstechniken, operante Schmerztherapie, Biofeedback und kognitive Verhaltenstherapie, erläutert.
Schlüsselwörter
Chronischer Schmerz, Rückenschmerz, Chronifizierung, Schmerzverarbeitung, Psychologische Aspekte, Schmerztherapie, Operante Konditionierung, Kognitiv-verhaltenstherapeutischer Ansatz, Entspannung, Biofeedback, Risikofaktoren, Prävention.
- Quote paper
- Dominik Eckardt (Author), 2001, Chronifizierungsprozesse bei Rückenschmerzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106091