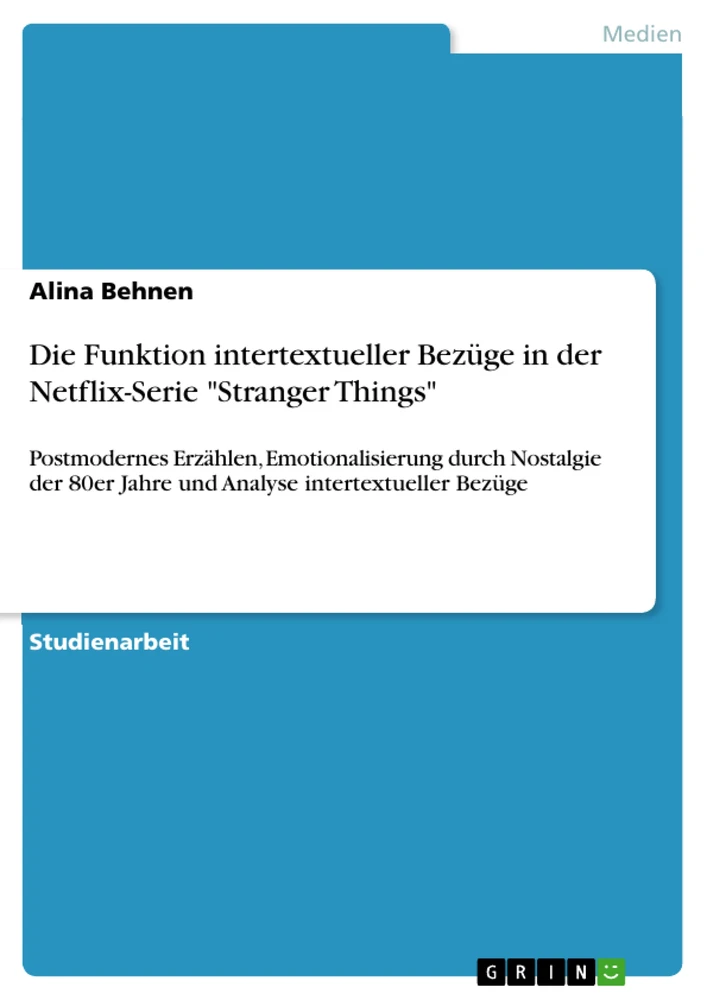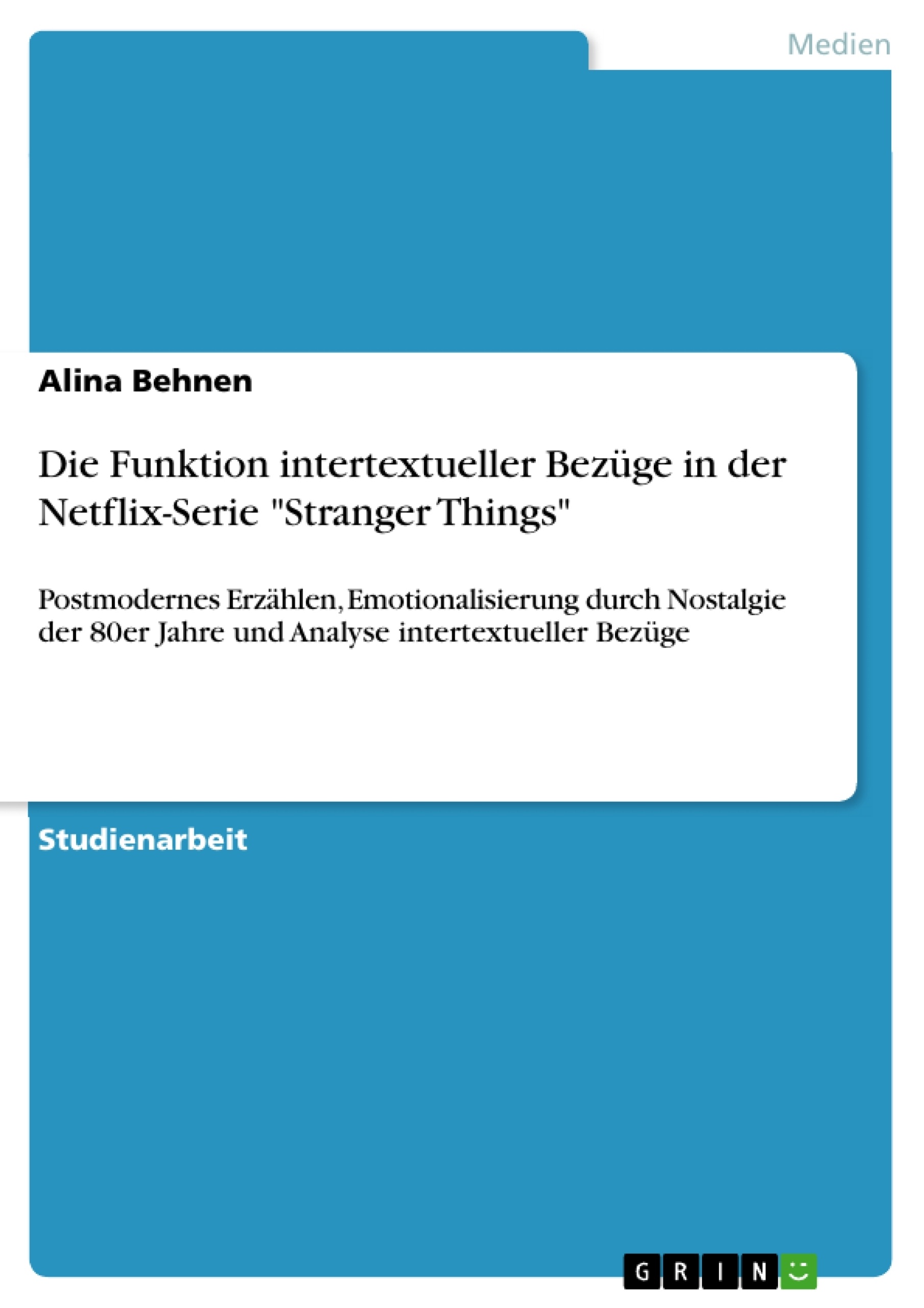In dieser Arbeit soll herausgearbeitet werden, inwiefern intertextuelle Bezüge in die filmische Gestaltung der Serie „Stranger Things“ einfließen und wie durch postmoderne Ästhetik eine Nostalgie der 1980er geschaffen wird.
Die Serie Stranger Things (2016-), welche am 15. Juli 2016 auf der Streaming-Plattform Netflix angelaufen ist, wird bereits nach der ersten Staffel von vielen Kritikern und Zuschauern ambivalent bewertet. Einerseits wird die Serie als ein Mix der größten kinematischen Klassiker der 1980er hoch gelobt und andererseits als ein leeres Gefäß gefüllt mit popkulturellen Referenzen bemängelt.
Wenn Artikel oder Kritiken über die erfolgreiche Show erscheinen, fallen im Zusammenhang die großen Namen der Autoren und Regisseure der Popkultur wie Steven Spielberg, Stephen King und John Carpenter.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Postmodernes Erzählen
- 3. Emotionalisierung durch Nostalgie
- 4. Analyse der intertextuellen Bezüge
- 4.1 Figuren und Darsteller
- 4.2 Ästhetik und Gestaltung
- 4.3 Genre und Lebenswelten
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Netflix-Serie Stranger Things hinsichtlich der Funktion intertextueller Bezüge und der Schaffung einer postmodernen Nostalgie-Ästhetik der 1980er Jahre. Die Analyse untersucht, wie filmische Gestaltungselemente diese Effekte erzeugen und ob Stranger Things lediglich eine Ansammlung postmoderner Referenzen ist oder darüber hinausgeht.
- Intertextualität in Stranger Things
- Postmoderne Ästhetik
- Nostalgie und die 1980er Jahre
- Analyse filmischer Stilmittel
- Die Funktion intertextueller Bezüge
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt die Forschungsfrage und die Thesen der Arbeit ein. Kapitel zwei beleuchtet das Konzept des postmodernen Erzählens, indem der theoretische Zugang zur Postmoderne erläutert wird. In Kapitel drei werden die Emotionalisierung und die verschiedenen Perspektiven der Nostalgie untersucht. Kapitel vier bildet den Hauptteil der Arbeit und analysiert die Serie Stranger Things mit Fokus auf Figuren, Darsteller, visuelle und auditive Ästhetik sowie Genre und Lebenswelten. Die Funktionen der intertextuellen Bezüge werden in diesen Analysen detailliert beschrieben und durchleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Intertextualität, Postmoderne, Nostalgie, filmische Gestaltung, Ästhetik, Genre, Lebenswelten, 1980er Jahre und die Netflix-Serie Stranger Things. Die Analyse basiert auf einer Untersuchung filmischer Stilmittel und intertextueller Bezüge.
Häufig gestellte Fragen
Welche Funktion hat Intertextualität in Stranger Things?
Intertextualität dient dazu, durch Bezüge auf Klassiker der 1980er Jahre (z.B. von Spielberg, King oder Carpenter) eine spezifische Nostalgie zu erzeugen und die Serie in einem popkulturellen Kontext zu verankern.
Ist Stranger Things nur eine Ansammlung von Referenzen?
Kritiker bewerten dies ambivalent: Einige loben den Mix als Hommage, andere kritisieren die Serie als „leeres Gefäß“, das lediglich aus popkulturellen Zitaten besteht. Die Arbeit untersucht, ob die Serie darüber hinausgeht.
Was macht die postmoderne Ästhetik der Serie aus?
Die Ästhetik zeichnet sich durch die bewusste Nachahmung visueller und auditiver Stilmittel der 80er Jahre aus, kombiniert mit modernem Erzählen und der Emotionalisierung durch Nostalgie.
Welche Genre-Einflüsse sind in der Serie erkennbar?
Stranger Things verknüpft verschiedene Genres wie Horror, Science-Fiction und Coming-of-Age-Dramen, die typisch für die Filme von John Carpenter und Steven Spielberg sind.
Wie wird Nostalgie in Stranger Things zur Emotionalisierung genutzt?
Durch die Gestaltung der Lebenswelten, die Wahl der Darsteller und die Musik werden Erinnerungen an die Kindheit und die Filmkultur der 80er Jahre geweckt, was eine starke emotionale Bindung beim Zuschauer erzeugt.
- Arbeit zitieren
- Alina Behnen (Autor:in), 2020, Die Funktion intertextueller Bezüge in der Netflix-Serie "Stranger Things", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1061017