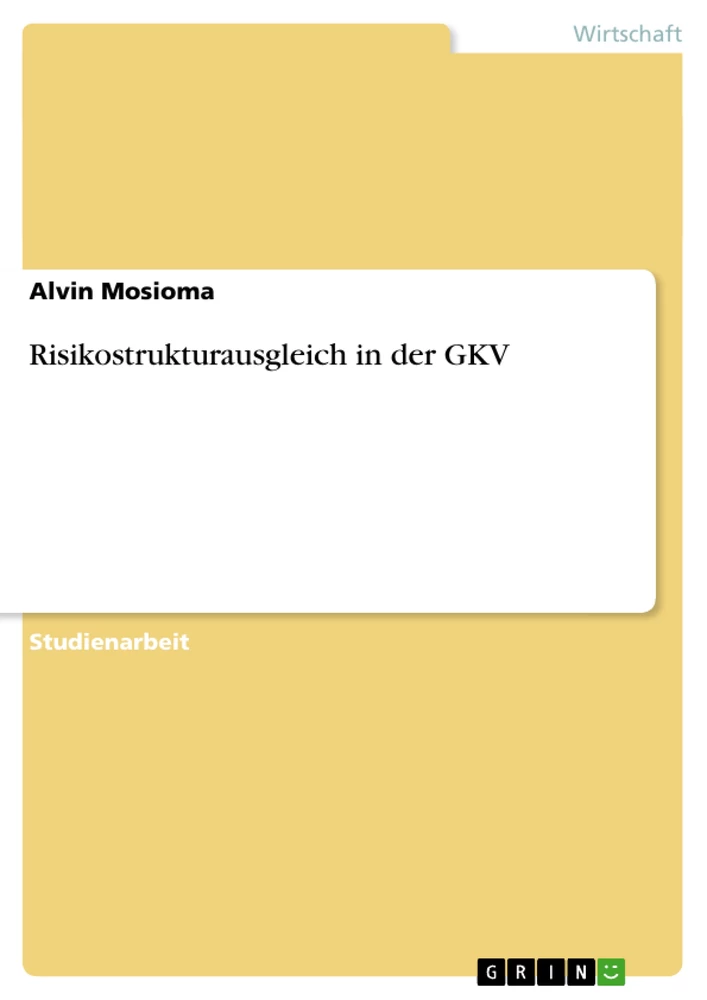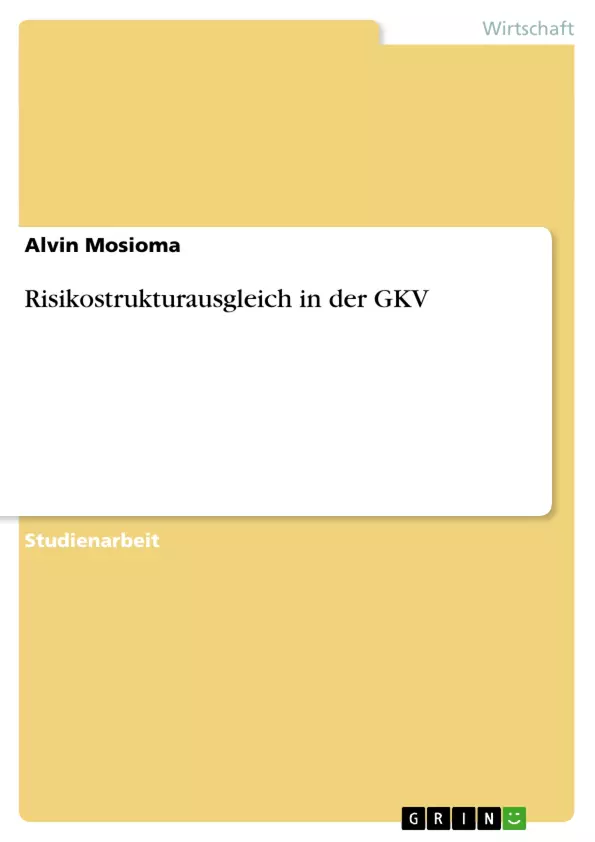Uni-Mainz
Alvin Mosioma
Risikostrukturausgleich in der GKV
1) EINFÜHRUNG
Über 90% der Bevölkerung sind in der GKV versichert. Der Anteil der Ausgaben für die Gesundheitsversorgung ist in den letzten 30 Jahren stetig gestiegen. Die steigenden Beitragssätze belasten in zunehmendem Maße sowohl die Bruttoeinkommen der krankenversicherungspflichtigen Beschäftigten als auch die Lohnnebenkosten.1Die Gesundheitsausgaben erreichten 1981 in der BRD eine Höhe von 210 Mrd. - gegenüber 1970 nahmen sie damit auf das Dreifache zu, während das BSP im gleichen Zeitraum um das 2.29- fache stieg. Der Anteil der Gesundheitsausgaben am BSP erhöhte sich entsprechend von 6.3% im Jahr 1970 auf 9.4% im Jahr 1981. Von der GKV wurden ca. 95 Mrd., d.h. 45.2% der gesamten Gesundheitsausgaben, GEBRACHT.2Die daraus resultierenden finanziellen Probleme versuchte der Staat durch staatliche Eingriffe, z.B. Krankenversicherungskostendämpfungsgesetz (Kvkg), zu lösen.3
Das Problem wurde aber nicht gelöst, weil die Problematik der GKV eher in ihrer Struktur liegt. Die Gliederung der GKV in verschiedene Kassenarten folgt keinem einheitlichen Organisationsprinzip, sondern hat sich historisch entwickelt4. Diese Organisationsprinzipien der GKV, die teils an regionalen und teils an berufsbezogenen Gegebenheiten orientiert sind, haben zu unterschiedlichen Risikostrukturen geführt5. Mit dem Lahnsteiner Kompromiss wurde durch einen parteiübergreifenden Konsens eine Gesundheitsstrukturreform in die Wege geleitet mit dem Ziel, das gewachsene gesetzliche Krankenversicherungssystem in eine solidarische Wettbewerbsordnung zu transformieren.
Es lassen sich zwe i Ansatzpunkte dieser Reform identifizieren:
1). Die teilweise beträchtlichen Beitragssatzdifferenzen zwischen den Kassenarten bzw. Regionen, die zu erheblichen Verzerrungen im Kassenwettbewerb führen, werden sowohl verteilungs- als auch allokationspolitisch für problematisch und nicht länger tragbar erachtet.
2). Die unterschiedlichen Wahlmöglichkeiten für einzelne Teilgruppen der GKV -Versicherten hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zu einer GKV gelten als unvereinbar mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung, und insbesondere die künftige Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten wird deshalb als wichtige Aufgabe der Reform angesehen6.
Es stellt sich nun die Frage, wie Wettbewerb in das System der GKV einzuführen ist, ohne dabei das Prinzip der Solidarität zu gefährden. Kassenwahl und Wettbewerb sind wesentliche Steuerungsinstrumente zur Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit der Gesundheitsversorgung und stellen damit zentrale Ziele der Gesundheitsreform dar.
Damit Wettbewerb funktioniert, bedarf es einerseits Wettbewerbsparameter, anhand derer Wettbewerblichkeit zu beurteilen ist. Auf der anderen Seite benötigt Wettbewerb einen funktionalen Ordnungsrahmen. Es darf nicht alles im Gesundheitsbereich der Marktsteuerung überlassen werden. Bei der Schaffung dieses Ordnungsrahmens kommt dem RSA eine große Bedeutung zu.
Der RSA hat die Aufgabe, Risikoselektion zu vermeiden, Anreiz bei den Kassen zur Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung zu verstärken und zu Beitragssatzgerechtigkeit beizutragen7.
Der RSA stellt nach dem Gutachten, das im Auftrag des BMG erstellt wurde, ein unverzichtbares Element eines solidarischen Wettbewerbs dar. Bei Wahrung des Prinzips der solidarischen Finanzierung in der GKV ist ein funktionsfähiger Kassenwettbewerb ohne den RSA nicht möglich.
2). BAUSTEINE DER GKV
Die Organisationsreform der GKV ist durch drei Hauptkomponenten gekennzeichnet auf den das Konzept der RSA aufgebaut ist.
2.1). SOLIDARITÄT
Die GKV dient zwei verschiedenen sozialen Zielen .Auf der einen Seite übernimmt sie die finanziellen Risiken aus der Erkrankung, wie dies von jeder PKV auch getan wird. Auf der anderen Seite ist der soziale Aspekt. Dieser besteht darin, die Leistungen ohne Berücksichtigung bestimmter Gegenleistungen, sei es finanzieller Art (Beitragshöhe) oder nichtfinanzieller Art (gesundheitsbewusstes Verhalten), zu wahren8. Jeder GKV-Versicherte erhält im Krankheitsfall Leistungen, die den jeweiligen medizinischen Erfordernissen entsprechen, trägt aber zu den Aufwendungen gemäß seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bei.
Nach diesem Prinzip sollen somit innerhalb der Solidargemeinschaft GKV nicht nur Gesunde für Kranke zahlen, wie das in jeder Krankenversicherung ist, sondern auch
- Besserverdienende mit für Schlechterverdienende
- Jüngere mit für Ältere
- Ledige und Kinderlose mit für Familien mit Kindern
- Männer wegen unterschiedlicher geschlechtspezifischer Risiken und unterschiedlic her Lebenserwartung mit für Frauen9
Diesen Aspekt unterstreicht die Solidaritätskomponente der GKV, die sowohl Gerechtigkeitsals auch Umverteilungsfunktion erfüllt.
Der Versicherungszwang, der die GKV kennzeichnet, ermöglicht die Durchführung des Solidarausgleichs. Dies ist notwendig, da andernfalls, soweit andere Versicherungsmöglichkeiten vorhanden sind, die durch den Ausgleich Belasteten Mitglieder die Versicherung verlassen würden.
Die Versicherungs- und Kassenpflicht soll den Solidarausgleich zwischen den unterschiedlichen Risiken der Versicherten sicherstellen. Von daher besteht die vorhandene Wahlmöglichkeit der Versicherten nur in einem sehr eingeschränkten Rahmen.
Dadurch soll verhindert werden, dass ,gute'Risiken sich dem Solidarausgleich entziehen können10Es stellt sich nun die Frage, ob die Einführung der Kassenwahlfreiheit, verbunden mit einem verschärften Kassenwettbewerb, mit dem Solidarprinzip der GKV vereinbar ist. Es besteht ein Spannungsverhältnis zwischen Wettbewerb und Solidarität.
2.2). KASSENWAHLFREIHEIT UND KASSENWETTBEWERB
Bartling definiert Wettbewerb als das Rivalisieren von Marktteilnehmern um Geschäftabschlüsse (d.h. Marktanteil) und damit für die Tauschpartner um Auswahlmöglichkeiten unter mehreren Alternativen. Die sich im Wirtschaftserfolg gegenseitig beeinflussenden Anbieter oder Nachfrager räumen ihren Tauschpartnern günstige Geschäftsbedingungen (hinsichtlich der Aktionsparameter Preis, Qualität, Absatz und Vertriebsvorteile)ein11.***Zur zentralen Voraussetzung für unbeschränkten Wettbewerb auf dem Markt für soziale Krankenversicherung gehört die Möglichkeit aller Versicherten, ihre Krankenversicherung frei zu wählen.
Wie oben erwähnt, besteht für die Versicherten die vorhandene Wahlmöglichkeit in einem sehr eingeschränkten Rahmen. Individuelles Kassenwahlrecht hatten im Wesentlichen nur Angestellte, und zwar auch nur zwischen ihrer zuständigen Primärkasse und den Angestellten-Ersatzkassen, die ihrerseits zum Teil bestimmte berufsbezogene Mitgliederbeschränkungen aufweisen. Wettbewerb zwischen den Kassen fand kaum statt. Das individuelle Kassenwahlrecht war als Steuerungsinstrument praktisch bedeutungslos.
Mit der Erweiterung des individuellen Kassenwahlrechts wird Wettbewerb zwischen den gesetzlichen Krankenkassen erheblich an Intensität zunehmen. Wie bislang nur die Angestellten, werden dann auch alle Arbeiter ein weitgehend unbeschränktes individuelles Kassenwahlrecht ausüben können. Gleichzeitig entfallen zahlreiche Mitgliederbeschränkungen einzelner Kassenarten. Alle Ersatzkassenmüssen, die BKK und IKKkönnensich für alle Mitglieder der GKV in ihrem jeweiligen regionalen Geltungsbereich öffnen12.
Wie die Kassenwahlfreiheit zu gestalten ist, ist in der Literatur nicht unumstritten. Die Forderung nach Abbau der Ungleichheit beim Wahlrecht findet bei fast allen Beteiligten Zustimmung. Die Einigkeit endet allerdings, sobald es um die Frage geht, wie diese Gleichbehandlung hergestellt werden soll. Hier liegen die Positionen weit auseinander13.
Die Hauptaufgabe der Politik muss darin bestehen, ein Gleichgewicht zwischen Wettbewerb und Solidarität herzustellen. Würde das System der GKV total den Marktkräften überlassen, dann würde dies zu Wettbewerbsverzerrung statt zu Wettbewerb führen. Es besteht die Gefahr, dass nach der Einführung der erweiterten Versicherten-Wahlfreiheit Wettbewerb zum Rosinen-Pickenseitens der Kasse verkommt. Dies bedeutet, dass Kassen durch niedrigere Beitragssätze jüngere, gesunde und zahlungskräftige Mitglieder anlocken. Wahlfreiheit kann auch innovationshemmend wirken, da Kassen, die innovative Konzepte zur Gestaltung der Versorgung erproben, damit die Kranken locken, dieschlechteRisiken darstellen.
2.3). BEITRAGSSATZ
Kann es gerecht sein, wenn ein Arbeitnehmer mit 2.000 DM Bruttomonatseinkommen hiervon einschließlich Arbeitgeberanteil 280 DM an die Krankenkasse bezahlen muss, ein Kollege mit 2.500 DM Einkommen aber nur 275 DM?.
Ist es sozialpolitisch erwünscht, dass jemand in jungen Jahren, wenn seine Krankenversicherungsbeiträge höher sind als die beanspruchten Krankenleistungen, er einer anderen Versichertengemeinschaft angehört als im höhere Alter, wenn die Leistungen weit mehr kosten, als seine Beiträge der Kasse einbringen?14
Diese Fragestellung von Borchert stellt die ganze Problematik der Beitragssatzunterschiede dar. Wie auf anderen Märkten stellt der Preis (beim Versicherungsmarkt der Beitragssatz) einen zentralen Wettbewerbsparameter. Preisunterschiede sind in einer Wettbewerbswirtschaft ein zentrales Allokationselement, so dass auch von Unterschieden beim Krankenversicherungsbeitrag eine allokativ positiv zu beurteilende Wirkung ausgehen könnte. Dies gilt aber nur, wenn diese Unterschiede zugleich auch Ausdruck entweder unterschiedlicher Versorgungsqualität oder Resultat unterschiedlicher Effizienz des jeweiligen Kassenmanagement sind.15
Die Beitragssatzunterschiede sind in der GKV aber nicht auf ihre Effizienz oder ihr Kassenmanagement zurückzuführen, sondern durch die Struktur bestimmt. Diejenige Krankenkasse, der es gelingt, überwiegend junge, männliche Angestellte aus ländlichen Gebieten zu versichern, wird durch das niedrige Versicherungsrisiko, das hohe Grundniveau und das regionale niedrige medizinische Leistungsangebot eine günstigere Einnahme/Ausgabe-Relation und damit einen niedrigeren Beitragssatz haben als ein Konkurrent, bei dem der Anteil der in den Ballungsgebieten lebenden RenterInnen unter den Versicherten relativ hoch ist.16
Auf der anderen Seite sind die Gestaltungsmöglichkeiten der Kassen im Lestungsbereich nach wie vor sehr begrenzt, so dass aus der Sicht ihrer Mitglieder - von Service, Satzung und Ermessensleistung einmal abgesehen - das Leistungsangebot der Kassen weiterhin einheitlich erscheint. Durch die staatliche Reglementierung der Leistungsbündel wurden die Möglichkeiten einzelner Kassen, ein größeres und qualitativ besseres Leistungsbündel anzubieten, begrenzt17.
Die Konzentration der Kassen auf den Beitragssatz als zentralen, wenn nicht einzigen Aktionsparameter hat die Folge, dass eine Mitgliederwanderung entsteht, die das System bzw. die Existenz einzelner Kassen gefährdet. Kassenwahlfreiheit verbunden mit unterschiedlichen Beitragsätzen wirkt als Anreiz für die Kasse, ,gute' Risiken zu selektieren, und für die Mitglieder, eine günstigere Kasse zu wählen. Es wird ein Mechanismus benötigt, durch den guteundschlechteRisiken zu normalen Risiken werden. Gleichzeitig sollten die Differenzen bei den Beitragsätzen eliminiert werden, damit bei der Kassenwahl die effizienten Kassen gewählt werden.18
Das Ziel ist nicht, undifferenziert die Beitragsatzunterschied auszugleichen. Differenzen, die aus unterschiedlicher Effizienz des Kassenmanagements resultieren oder auf eine abweichende Versorgungsqualität zurückzuführen sind, haben im Wettbewerb eine Signalfunktion und sollen erhalten bleiben.19
3) RISIKOSTRUKTURAUSGLEICH
3.1) Ziele
Mit der RSA sollen die über Jahrzehnten verfestigte Verwertung in den Krankenkassenstrukturen jener Risikofaktoren auf die die einzelne Krankenkasse keinen Einfluss hat abgebaut werden.
Der RSA verfolgt im Wesentliche folgende Drei Zielsetzung
1).Gleiche Startchancen der Kassen
Über den einer Auswertung der Versichertenwahlfreiheit vorgelagerte Ausgleich der Risikostrukturen, sollen für alle Kassen gleiche Startschalen in zu erwatenden Wettbewerb der Kassen um versicherten geschaffen werden .Der RSA ist also Voraussetzung für die Intensivierung des Wettbewerb in der GKV. Diese Gedanke ist im Hintergrund der Tatsache dass einerseits die Kassen teilweise keine oder einen sehr geringere Einfluss auf ihre Versichertenstrukturenhaben und dass anderseits einige Element der Versicherte sich deutlich auf die Beitragssätzen auswirken20Man befürchtet dass Krankenkassen in einzelne Regionen der BRD auf grund ihrer Schlechte Markteintrittsituation , keinen Überlebenschancen hätten, da im Wettbewerb ein Wanderung ihre mobilen Mitglieder zu erwarten wäre. Sie würden vom Markt verschwinden nicht weil sie nicht leistungsfähig sind bzw. - nicht weil ihre Konkurrent effizienter sind sondern allein auf grund der Tatsache dass die Wettbewerbsbedingung in der Startphase ungleich sind.21
2).Vermeidung von Risikoselektion
Der Solidarcharakter der GKV soll auch nach der Einführung von Wettbewerbkomponenten (Erweiterte Wahlfreiheit) erhalten bleiben in dem der RSA bewusste Risikoselektion der Kassen (z.B. das Rosinen-Picken junger gutverdienender versicherte) im Wettbewerb unattraktive macht. Ein Wahlfreiheitsmodell ohne RSA provoziert zwangsläufig einen Wettbewerb um ,gute 'Versichertenrisiken, denn unter Wettbewerbsaspekten sei gerade ein Kassenverhalten dass schlechte Risiken trotz Kontrahierungszwang möglichst vom Beitritt fern halt als rational zu bezeichnen. Wettbewerb zwischen den Kassen durch Risikoselektion gerade um Wettbewerb zu schaffen verhindert werden22.
3). Schutz Der Gesamte GKV-System.
Es werden funktionalen Erschütterung im Gesamtsystem erwatet die man für nicht tragbar hält. In einem formellen ökonomische Modell lassen sich zwar theoretisch begründen dass da die Versicherten ,mit dem Füßen' abstimmen könnten. -eine Wanderung zu de Krankenkassen mit geringeren Beitragssatz einsetzen und dadurch sukzessiv ein neues Gleichgewicht der Risikoverteilung der Kassen entstehen werden23Ein solches Modell - Konzeption ohne RSA ist nicht realistisch da auf dem Weg zu antizipiertem Gleichgewicht würden vielen Kassen schließen müssen, ohne dass dies einen Effizienzgewinn für das Krankenversicherungssystem insgesamt darstellt.
Die Einführung der RSA ist nicht ohne Gegner die, die Notwendigkeit einer RSA hinterfragen. Sie geben vor allem folgende Gegenargumenten für die Einführung des RSA24:
1).Maßnahmen wie Kontrahierungszwang sowie Diskriminierungsverbohrt reichen aus um die Versicherte vor Ungerechtfertigter Wettbewerb der Kassen durch Risikoselektion zu schützen.
2).Freie Wettbewerb um verschiedene Versichertengruppen mit unterschiedlicher Beitragssätzen und Leistungsangebot stellt ein Wirkungsvolle Steuerungsinstrument für das GKV-System.
3).Schütze der Versicherten muss vorrang haben als Schütz der Krankenkassen .Diese wird erreicht durch größere Freiheitsrecht und stabile Beitragssätzen
3.2) Ausgleichfähigen Risikostrukturen.
Welche Faktoren sind es die die versicherungstechnische Risikostruktur einer Kasse bestimmen? Diese Faktoren müssen Folgende Kriterien erfüllen.
1). Es muss sich um ein Merkmal handeln, dass von den Kassen nicht oder nur in sehr geringem Maße beeinflussbar ist
2). Das Merkmal muss einen deutlichen eigene Einfluss auf die Beitragssätzen haben.
3). Das Merkmal wird nicht bereits durch einen anderen Ausgleichsfaktor berücksichtigt.
4). Die Ausprägung muss zwischen den Kassen starke Unterschied aufweisen.
3.2.1 Grundlohn Entgeltssumme )
In der durchschnittlichen Hohe der beitragspflichtigen Einnahme (früher Grundlohn) der Mitglieder einer Krankenkasse spiegelt sich deren Finanzkraft wieder .Aus der Summe der Grundlöhne der Mitglieder lässt sich durch Multiplikation mit dem Beitragssatz das Einnahmenvolumen der einzelne Krankenkasse ablesen. Einnahmeseitig bildet somit die jeweilige Höhe des Grundlohnniveau die entscheidende Größe für die Finanzkraft einer Kasse.25
Da ein erheblicher Unterschied im Einkommen von Arbeitern und Angestellten besteht, ist einzusehen dass unterschiedliche Anteile an Arbeitern und Angestellten das Einnahmeniveau der betroffene Kassen maßgeblich bestimmen, wobei in bezug auf die Einnahmen c.p. tendenziell Nachteile die jenige Kassen haben die einen hohen Anteil an Arbeitern haben.26Es lässt sich daher erkennen, dass im gegliederten System der GKV ohne RSA zu einer extrem schiefen Verteilung führen würde mit Risikoselektion statt Risikomischung. Am meisten betroffen wäre hier die OKK da sie die größten Anteile an Arbeiter aufweisen. Die AOK erreichen z.B. ein Marktanteil von 56.7% gerade dort wo die Bruttoarbeitsentgelte deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegen.27
3.2.2)Versichertenstruktur:
Die überkommene Organisationsstrukturen der GKV beeinflussen nicht nur die Einnahmeseite sondern auch die Ausgabeseite der Kassen und Kassenart. Die relevante Faktoren die die Risikostruktur einer Kasse prägen sind dabei :
a) Die Altersgliederung der Mitglieder
b) Die geschlechtspezifische Verteilung bei den Versicherten.
c) Der Anteil der (beitragsfrei mitversicherten) Familienangehörigen
d) Besondere Risikogruppen
a) Alter
Mit steigendem Alter wachsen schwere und Häufigkeit von Erkrankungen und damit auch die Nachfrage nach Gesundheitsleistung. Altersbedingte Mehrausgaben steigern den Finanzbedarf der Kassen, die über einen überdurchschnittlichen Anteil an Versicherten in höhere Altersgruppe aufweisen.28Nach Analyse des Wissenschaftlichen Institutes der OKK (WidO), entfiel in 1991 auf Versicherten mit einen einem Lebensalter ab 60 Jahren rund 55% der gesamten GKV - Arzneimittekosten, obwohl diese Altergruppe nur 21% der Bevölkerung ausmacht. Ergebnisse einer Analyse von der (SVRfdKAiG) belegen, dass eine ungleichgewichtige Verteilung der Versicherten nach ihre Altersstruktur im system der GKV besteht.
Während die EKK der Arbeiter, die IKK und die Ersatzkassen der Angestellten überwiegend aus jüngeren Mitgliedern besteht, sind in der Bundesknappschaft, der BKK und der OKK eher ältere Mitglieder zu finden29.Diese unterschiedliche Verteilung der Versicherten wirkt auf die Versicherungsrisiken und Beitragsstruktur der Kassen und damit auf ihren Finanzbedarf aus.
b) Geschlecht
Welche Einfluss über die Kassenart variierenden Anteil an weiblichen Versicherten auf den Finanzbedarf der Kassen haben ist umstritten. Die Diskussion ist geprägt von Vorurteilen und Stereotypen über das weibliche Geschlecht.30
Neben geschlechtsspezifischen Besonderheiten wie Schwangerschaft und Mutterschaft, die höheren Leistungsausgleich auch theoretisch als plausibel erschienen lassen, wird Frauen ein allgemein schlechterer Gesundheitszustand und daraus resultierend ein hohe Nutzungsintensität und Kontakthäufigkeit von Gesundheitseinrichtung unterstellt.31.
So belegt Schneider dass die Leistungsausgabe pro-kopf der 25-29Jährige weibliche AKV Mitglieder um 6.1% höher liegen als bei Männer in diese Altersgruppe.32
c) Familienlastquote
Beitragesfrei Mitversicherte von Familienangehörigen wirken unmittelbar finanzbedarfsteigernd, da die Krankenkassen als Kostenträger Leistungen für Versicherten erbringen müssen, von denen sie keine Gegenleistung in Form von Beitragszahlungen erhalten. Bei Analyse der unterschiedlichen Belastungen der Kassenart durch Mitversichertenangehörigen lässt sich bestätigen, dass die zwischen den Kassenarten deutliche schwankende Familienlastquote (Zahl der Familienangehörigen im Verhältnis zur Mitgliederzahl einer Kasse), Einfluss auf die Finanzbedarf der Krankenkassen hat.33
Die Position, dass die oben genante Faktoren entscheidenden Einfluss aus die Ausgabeseite einer Krankenkasse haben, ist in der Literatur nicht einheitlich. Wüstrich sagt z.B., dass die Annahme, dass Frauen häufiger krank werden und daher ein schlechtere Gesundheitsrisiko darstellen von neuen Untersuchungen relativiert wird.34
Mildendorf hinterfragt die Zusammenhang zwischen Geschlecht und Beitragssatz. .Fraglich für ihn ist auch, ob zwischen Höhe der durchschnittlichen Mitgliedsalter und des Beitragssatzes ein Zusammenhang besteht35
Allgemein besteht zwischen den risikostrukturbildende Elemente der einzelnen Versichertenpopulation bei den Kassen und Kassenarten eine vielfältigen Interdependenz, die in ihre Wirkung auf die Finanzkraft und den Beitragssatz teils kompensatorische teils kumulierende Effekte aufweisen. Übereinstimmend für alle Kassen lässt sich nur feststellen ,dass es sich um Faktoren handelt, auf deren Zusammensetzung die einzelne Kassen prinzipiell kaum Einfluss aus üben kann da die konkreten Versichertenstrukturen in erste Linie auf den Zuweisungen der überkommenen Gliederungssystemen der GKV gründen36.
d) Besondere Risikogruppe
Neben den Hauptdeterminanten der kassenspezifische Risikostruktur als Entgeltsumme und der Anzahl bzw. Geschlechtsstruktur der Versicherten, werden in der Diskussion die Einführung eines RSA auch die,Besondere Gruppe'angesprochen. Für die Kassen mit einem hohen Anteil dieser Gruppe ist deren Versicherung eine besondere Belastung. Zu diese Gruppe zählen die Arbeitslose, freiwillig versicherte Sozialhilfeempfänger, Behinderte in geschützten Einrichtung und Rehabilitanten, Beruf- und Erwerbsunfähigkeitsrentner (BU/EU- Rentner) und schwere Risiken (z.B. Bluter, Dia lysepatienten oder Aidskranke)37
Die obige Aufzahlung der zu ,Besondere Risikogruppe' gehörenden ist aber in der Literatur nicht einheitlich. Es werden. bei manchen Autoren z.B. Mitglieder mit einen Monatseinkommen von weniger als 1.000 DM als besondere Risikogruppe bezeichnet oder sogar pauschal alle weiblichen Mitglieder.38Ein eindeutige Zuordnung der Versicherten und ihre Charakterisierung als besondere Risikogruppe ist vor allem wegen der ungesicherten Datenlage kaum möglich, meint Jacobs.
Zu gleichem Ergebnis kommt auch Wüstrich und vertritt die Position, dass das quantitative Gewicht dieser Gruppe zu der Gesamtzahl aller AKV Mitglieder vernachlässigbar ist. Die "Besondere Risikogruppen" stellen zwar ein schlechtes Risiko für die Kassen dar, aber sie wirken sich negativ auf die Beitragssätze erst bei einer kumulativen Häufung mit andere Risikogruppen aus. Bei einer insgesamt ausgewogene Risikomischung der Kassen ist diese Auswirkung vernachlässigbar39
3.3).AUSGETALTUNGSMÖGLICHKEIT DER RSA
Welche Möglichkeiten bestehen zur Ausgestaltung der RSA, um ihre Ziele zu erreichen? Pfaff und Wassener unterscheiden sieben Kriterien anhand deren sich die Ausgestaltungsmöglichkeit der RSA differenzieren lassen40
- Orientierung an Finanzbedarf, Finanzkraft oder Beitragssatz
- Berücksichtigte Beitragssatzdeterminanten (z.B. Grundlohnsumme, Alterstruktur Geschlechtstruktur Mitversicherten-Quote und Besondere Risikogruppen)
- Ausgabenausgleich oder RSA anhand der Durchschnittsprofile der Beitragssatzdeterminanten
- Ausgleichsgrad (z.B.50% oder 100%)
- Kassenarteninterne oder Kassenartübergreifende Ausgestaltung des Ausgleiches
- Räumliche Reichweite des Ausgleiches (regional oder bundesweit)
- Laufzeit des Ausgleiches (Zeitliche Begrenzung oder unbefristet)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Übernommen von Pfaff ,M und Wassener, D.41
Anhand dieser sieben Kriterien lassen sich eine Vielzahl theoretisch denkbarer
Ausgestaltungsmöglichkeiten der RSA differenzieren. Es herrscht jedoch bei den diskutierten Modellen Übereinstimmung über folgende Aspekte:
1).Ausgleich soll an den relevanten Beitragssatzdeterminanten orientieren
2).Ein Ausgleich soll in form eines Ausgabe neutral RSA ausgestaltet sein
3).Ein RSA soll 100% und zeitlich unbefristet sein42-dies wird darin begründet dass die Gefahr der Wettbewerb um guten Risiken die gleichzeitig die schlechte Risiken an den Rand der GKV dräng, immer dann entsteht, wenn ein solcher befristeter RSA ausgelaufen ist.43
3.3.1). Kassenintern vs Kassenübergreifenden Ausgleich
Dem Solidaritäts- und Wettbewerbsanspruch gerecht zu werden, ist nach Schneider, nur durch ein kassenartübergreifendes RSA möglich. Er argumentiert, dass ein kasseninterner Ausgleich neue Risikoverwerfungen produzieren würde. Beitragssatzunterschiede würden von risikospezifischen Eigenschaften bestimmt. Ein kassenartinterner RSA würde nicht zu einem Abbau sondern zu einer Zementierung der Wettbewerbsverzerrung führen.44
Diese Position vertreten auch Jacobs/Reschke in dem sie argumentieren: im Wettbewerb miteinander stehen aber nicht die OKK in Bad Tölz, Berlin und Bielefeld oder die IKK in Mannheim, Mattmann und München, sondern -und diese umso mehr bei erweitertem individuellen Wahlrecht- die Kassenvor Ort.45Sie stellen fest, dass bei einer Entscheidung für den RSA, die Notwendigkeit eines kassenübergreifenden Ausgleichs sich fast zwingend aus der Funktion der Ausgleichform als zentralem Bestandteil der Wettbewerbsordnung ergibt46
3.3.2). Bundesweite oder Regionale Begrenzung
Soll die RSA bundesweit, regional oder gemischt erfolgen? Man ist sich nicht einig, welche Variante am besten geeignet ist. Für einen regionalen Ausgleich liefert Brunkhorst folgende Argumente:
Innerhalb eines Wettbewerbsmodells sind angebotsbedingte Beitragssätze durchaus akzeptabel, wenn sie sich aus einen besseren regionalen Leistungsversorgung ergeben. Es resultieret deshalb eine gestieigertes Interesse der Krankenkasse an einer konsequenten Ausschöpfung der Wirtschaftsreserven im Vertragswesen und im Bereich der Gesundheitsförderung, weil von vorn herein die Planung auf den Sektoren Ärzte, Zahnarzte, und Krankenhäuser überwiegend regional ausgerichtet ist. Dies hat für die Versicherten positive Effekte bezüglich ihrer Gesundheitsversorgung.47
Nach dem Konzept des Sachverständigenrates gehören Regionalisierung der Beitragssätze und RSA zusammen, nur dann, wenn der -in der Versichertenstruktur begründete- Unterschied- in der Höhe der Leistungsausgabe pro Kopf nivelliert werden, können die verbleibende Unterschiede auf regionale Besonderheiten in der Ausstattung im Gesundheitsgütern zurückgeführt werden.48Auf der anderen Seite sprechen die erheblichen Differenzen eher für einen bundesweiten Ausgleich der Grundlöhne.
So ist für den Bereich AOK festgestellt worden, dass die Bruttoarbeitsentgelte von ca.37 000DM (Hamburg) bis ca.30 400DM(Schleswig-Holstein) sich deutlich unterscheiden. .Bei einem regionale Ausgleich würden Regionen mit höherem Erwerbseinkommen und niedrigerer Arbeitslosigkeit ein höheres Finanzpotential zu Verfügung haben als eine Region in einem umgekehrten Fall.
Zu erwarten wären dann höhere regionale Disparitäten. Ein weiteres Argument gegen einen regiona len Ausgleich bietet Schneider. Wenn man sich bei der Erstellung der Ausgabe-Profile einer Kasse an den durchschnittlichen Leistungsausgaben der jeweilige Region orientieren würde, fließen dann in diese Profile automatisch regionale Besonderheiten ein, die im Grunde unabhängig von der Risikostruktur sind.49
Die GSG hat sich für einen Bundesweit RSA entschieden - jedoch für die Dauer der unterschiedlicher Wirtschaftsverhältnisse, nach alten und neuen Länder getrenntdurchzuführen. Eine Vermischung der Ausgleichwerte - mit höherem westlichen und vergleichsweise niedrigerem östlichen Leistungsstandard- zu einem gemeinsamen Durchschnittswert hätte zu einer Verzerrung des Ausgleichs geführt.
Mit der Trennung Ost/West wird der RSA seinem Ziel gerecht.50
Zur Funktionsweise des RSA
Wie vorher erwähnt.
[...]
1 Felkener,C./ Stein,P./ Stützmüller,U., hrsg. von der Robert-Bosch-Stiftung (1990): Die Entwicklung der Beitragsstruktur und ihre Bestimmungsgründe in der gesetzlichen Krankenversicherung. Bleicher Verlag S.1
2 Geigant, F./ Oberender, P., hrsg. von der Robert-Bosch-Stiftung (1985): Beiträge zur Gesundheitsökonomie - Marktsteuerung im Gesundheitswesen. Bleicher Verlag S.18
3 ebd., S.11
4 Smigielski, E.: Möglichkeiten und Grenzen des Wettbewerbs zwischen den Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung. in: Sozialer Fortschritt 12/1982, S.235
5 vgl. Borchert ,G.: Risikostrukturen und Beitragssatzunterschiede in der gesetzlichen Krankenversicherung. in: Sozialer Fortschritt 10/1982, S.245
6 Jacobs, K./ Reschke, P.: 1991 Risikostrukturanalyse
7 Jacobs, K./Reschke P./ Cassel, D./ Wasem, J.(2000):Zur Wirkung des RSA in der GKV. Eine Untersuchung im Auftrag des BMG. Zwischenbericht S.7
8 Vgl Geigant, F./ Oberender ,P.: a.a.O., S.154
9 Jakobs, K./ Reschke, P./ Cassel, D./ Wasem, J.: a.a.O., S.13
10 Middendorf-Meyers, J. (1993): Die Gestaltungsrelevanz marktwirtschaftlichen Wettbewerbs der GKV. Müller Bötermann Verlag Köln, S.250
11 Bartling, H. (1980): Leitbilder der Wettbewerbspolitik
12 Jacobs, K.: Sinnvoller Kassenwettbewerb in der GKV. in: Wirtschaftsdienst 1993/XI; S.597
13 Vgl. Wasem, J.: Die Probleme der Versicherten und Kassenstrukturen und ihre Reform. in: Sozialer Fortschritt 3-4/1990, S.55
14 Borchert, G.: a.a.O., S.243
15 Vgl. Leber, W. D./ Wasem, J.: Risikostrukturausgleich in der GKV. in: Wirtschaftsdienst 1989/II, S.
16 Paquet, R.: Wahlfreiheit und Organisationsstruktur in der GKV. in: Sozialer Fortschritt 1/1988, S. 53
17 Hoffmann, J.: Von der Wahlfreiheit zum Solidarausgleich. in: Sozialer Fortschritt 1/1988,
S. 12
18 ebd. S.13
19 Leber, W-D/ Wasem, J. a. a. O: S 93
20 Pfaff, M/Wassener, D. Die Bedeutung des RSA für den Kassenwettbewerb und die Solidarische Wettbewerbsordnung in: http//www.wiso.uni-augsburg.de/vwl/pfaff/lit/rsa- rpg.html. S.1
21 Bundesdrucksachen 11/6380 S.203
22 Vgl. ebd S. 203
23 ebd
24 Vgl. Bundesdrucksachen 11/6380. S.204
25 Pfaff,M./Wassener ,D. Der RSA als Element der GKV -Organisationsreform. in: Sozialer Fortschritt 3-4/1990 S.192
26 Vgl. Wüstrich. T. (1994) Wettbewerb und Soziale Krankenversicherung. Verlag P.C.O.Bayreuth. S.147
27 Vgl. Bundesdrucksache. a.a.O. S.193.
28 Vgl. Wüstrich ,T. a.a.O. S. 156
29 Vgl. Schneider, W. (1994) Der Risikostrukturausgleich der Gesetzlichen Krankenversicherung.S.109. Erich Schmidt Verlag
30 Vgl. Wüstrich, T. a. a O.157
31 ebd.S.158
32 Vgl. .Schneider, W. a. a. O S.110
33 Vgl. Brunkhorst J. (1987) Zur Problematik unterschiedlicher Risikostruktur und ihre Ausgleiches in der Sozialversicherung .S. 96 Dunker & Humblot /Berlin
34 Vlg.Wüstricht, T.a .a. O S. 158
35 Middendorf-Meyers, J.a.a.O. S.301
36 Bundesdrucksache.11/6380. S.191
37 ???
38 Vgl. Jacobs, K/Reschke, P. (1992) Freie Wahl der Krankenkasse: Konzeption und Konsequenz eines geordnete Wettbewerb. S.15. Nomos Verlagsgesellschaft Baden Baden.1.Auflage
39 Vgl. Wüstrich, T. a. a. O. S.152
40 Vgl. Pfaff, M/ Wassener, M. Der RSA als Element der GKV-Organisationsreform .in :Sozialer Fortschritt 3-5/1990.S.51
41 Vgl. ebd. S.61
42 Vgl. ebd S.60
43 Vgl. Schneider, W. a. a. O S.112
44 Vgl. Schneider, W. a.a.O. S.118
45 Jacobs ,K/Reschke ,P.(1992) Freie Wahl der Krankenkasse: Konzeption und Konsequenz eines geordnete Kassenwettbewerb.S.36
46 ebd. S 36
47 Vgl. Brunkhorst, J. Risikostrukturausgleich und Regionale Krankenversicherung.S.236. in: Arbeit und Sozialpolitik 8/1988
48 Vgl. Wasem, J .Die Probleme der Versicherten und Kassenstrukturen und ihre Reform. in: Sozialer Fortschritt3-4/1990
49 Vgl.Schneider,W.a.a.O.S.120
Häufig gestellte Fragen zu "Risikostrukturausgleich in der GKV"
Was ist der Risikostrukturausgleich (RSA) in der GKV?
Der Risikostrukturausgleich (RSA) ist ein Mechanismus in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), der darauf abzielt, finanzielle Unterschiede zwischen den Krankenkassen auszugleichen, die durch unterschiedliche Risikostrukturen ihrer Versicherten entstehen. Ziel ist es, Risikoselektion zu vermeiden, Anreize zur Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung zu setzen und zu Beitragssatzgerechtigkeit beizutragen.
Warum ist der RSA notwendig?
Der RSA soll gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Krankenkassen schaffen, indem er Unterschiede in der Versichertenstruktur ausgleicht, die nicht von den Kassen beeinflusst werden können. Ohne RSA könnten Kassen dazu neigen, "gute" Risiken (junge, gesunde Versicherte) anzuziehen und "schlechte" Risiken (ältere, kränkere Versicherte) abzulehnen, was zu Wettbewerbsverzerrungen führen würde.
Welche Faktoren werden beim RSA berücksichtigt?
Beim RSA werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, die die Risikostruktur einer Krankenkasse beeinflussen, darunter:
- Grundlohn (Entgeltsumme) der Versicherten
- Altersstruktur der Versicherten
- Geschlechtspezifische Verteilung der Versicherten
- Anteil der (beitragsfrei mitversicherten) Familienangehörigen
- Besondere Risikogruppen (z.B. Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Behinderte)
Was sind die Ziele des RSA?
Die Hauptziele des RSA sind:
- Gleiche Startchancen für die Kassen im Wettbewerb
- Vermeidung von Risikoselektion durch die Kassen
- Schutz des gesamten GKV-Systems vor finanziellen Erschütterungen
Was sind die Bausteine der GKV, auf denen das Konzept des RSA aufbaut?
Die Organisationsreform der GKV und das RSA Konzept basieren auf drei Hauptkomponenten:
- Solidarität: Die GKV dient sozialen Zielen, indem sie finanzielle Risiken aus Krankheit übernimmt und Leistungen ohne Berücksichtigung bestimmter Gegenleistungen (z.B. Beitragshöhe) gewährt.
- Kassenwahlfreiheit und Kassenwettbewerb: Versicherte sollen ihre Krankenkasse frei wählen können, was Wettbewerb zwischen den Kassen fördert.
- Beitragssatz: Der Beitragssatz ist ein zentraler Wettbewerbsparameter, aber Unterschiede sollen nicht durch Risikostruktur, sondern durch Effizienz der Kassen entstehen.
Welche Ausgestaltungsmöglichkeiten gibt es für den RSA?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den RSA auszugestalten, die sich anhand von sieben Kriterien unterscheiden lassen:
- Orientierung an Finanzbedarf, Finanzkraft oder Beitragssatz
- Berücksichtigte Beitragssatzdeterminanten
- Ausgabenausgleich oder RSA anhand von Durchschnittsprofilen
- Ausgleichsgrad
- Kassenarteninterne oder kassenartübergreifende Ausgestaltung
- Räumliche Reichweite (regional oder bundesweit)
- Laufzeit (befristet oder unbefristet)
Was bedeutet kasseninterner vs. kassenübergreifender Ausgleich?
Ein kasseninterner Ausgleich würde nur innerhalb einer Kassenart (z.B. nur unter den AOKs) stattfinden, während ein kassenübergreifender Ausgleich zwischen allen Kassenarten erfolgt. Ein kassenübergreifender Ausgleich wird bevorzugt, um neue Risikoverwerfungen zu vermeiden und Wettbewerbsverzerrungen abzubauen.
Sollte der RSA bundesweit oder regional begrenzt sein?
Es gibt Argumente für beide Varianten. Ein regionaler Ausgleich könnte angebotsbedingte Beitragssätze aufgrund besserer regionaler Leistungsversorgung akzeptabel machen. Ein bundesweiter Ausgleich könnte regionale Disparitäten aufgrund unterschiedlicher Erwerbseinkommen vermeiden.
- Quote paper
- Alvin Mosioma (Author), 2000, Risikostrukturausgleich in der GKV, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106132