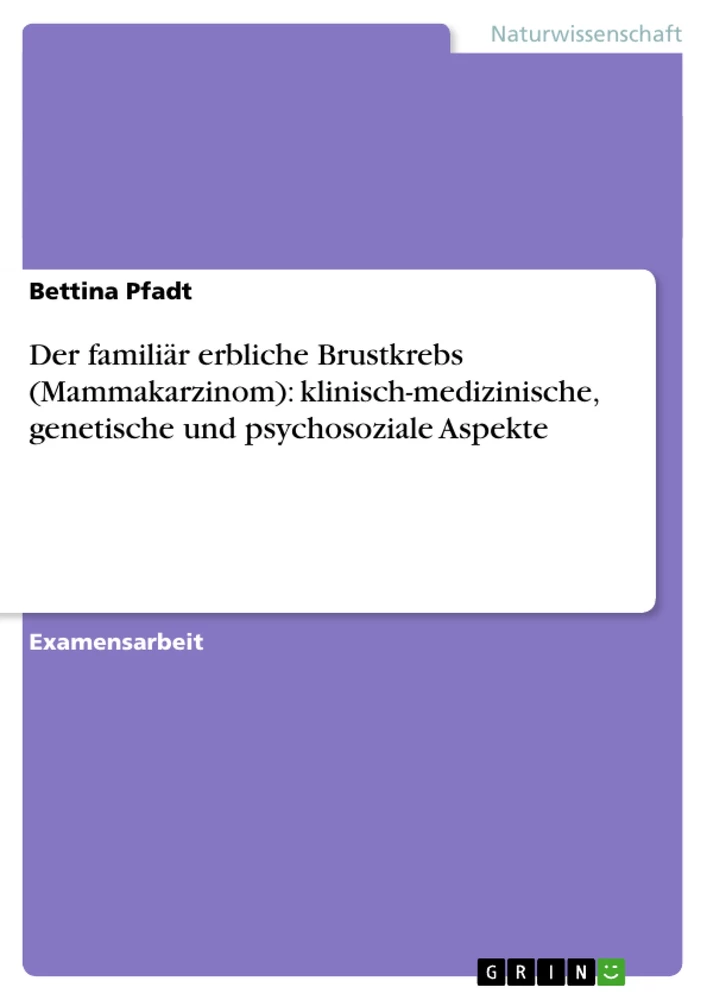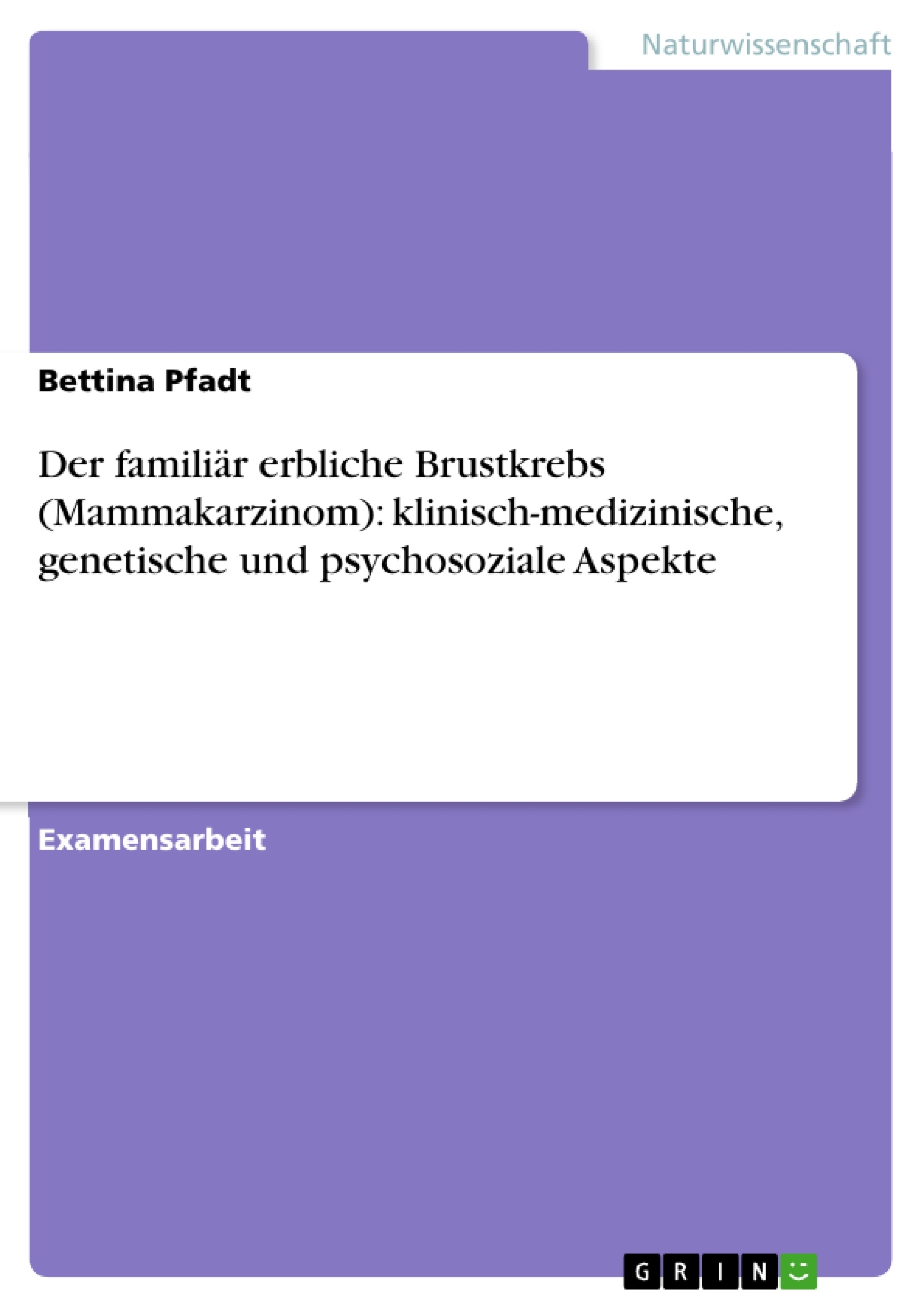Stellen Sie sich vor, Sie tragen ein genetisches Geheimnis in sich, eines, das Ihre Zukunft verdunkeln oder erhellen könnte. Dieses Buch enthüllt die komplexen klinischen, genetischen und psychosozialen Dimensionen des erblichen Mammakarzinoms, einer Bürde, die für manche Familien zur schattenhaften Realität geworden ist. Im Fokus stehen die Schlüsselgene BRCA1 und BRCA2, deren Mutationen das Risiko für Brust- und Eierstockkrebs drastisch erhöhen können. Doch was bedeutet es wirklich, Mutationsträger zu sein? Diese tiefgründige Analyse dringt in die wissenschaftlichen Grundlagen ein, beleuchtet die morphologischen Aspekte verschiedener Mammakarzinomtypen, die Methoden der Diagnostik und die neuesten Therapieansätze. Es werden die genetischen Mechanismen der Tumorsuppression und die komplexen Wechselwirkungen von Protoonkogenen und Tumorsuppressorgenen verständlich erklärt. Aber dieses Buch geht weit über die reine Wissenschaft hinaus. Es widmet sich den psychosozialen Herausforderungen, mit denen sich Betroffene konfrontiert sehen: Wie verarbeiten sie die kognitiven Informationen und emotionalen Belastungen einer genetischen Beratung? Welche Rolle spielen Angst, Schuldgefühle und die Angst vor der Ungewissheit? Und wie beeinflusst all dies ihre Entscheidungen bezüglich Prävention, Früherkennung und prophylaktischer Maßnahmen wie der Mastektomie? Dieses Werk ist ein unverzichtbarer Ratgeber für Betroffene, Angehörige und Fachleute, der nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch Empathie und Verständnis für die komplexen Lebensrealitäten derer weckt, die mit dem Damoklesschwert des erblichen Brustkrebsrisikos leben müssen. Es werden genetische Beratungsmethoden, Risikoeinschätzungen und die ethischen Implikationen der prädiktiven Gendiagnostik detailliert erörtert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der familiären Kommunikation und den psychosozialen Folgen eines positiven oder negativen Testergebnisses. Abschliessend werden die Möglichkeiten der Prävention und Früherkennung erörtert, einschliesslich der kontrovers diskutierten prophylaktischen Mastektomie. Diese umfassende Auseinandersetzung mit dem Thema macht das Buch zu einem unverzichtbaren Wegweiser durch das Labyrinth der erblichen Brustkrebserkrankung, der wissenschaftliche Erkenntnisse mit praktischer Lebenshilfe verbindet und den Leser dazu anregt, informierte und selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Die Auseinandersetzung mit der Thematik geht über die reine Information hinaus und bietet eine Plattform für ein tieferes Verständnis der menschlichen Erfahrung im Angesicht einer solchen genetischen Herausforderung.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Klinisch-medizinische Aspekte
2.1 Morphologische Grundlagen
2.1.1 Nicht-invasive Mammakarzinome
2.1.2 Invasive Mammakarzinome
2.1.3 Besonderheiten bei BRCA 1-/2-Karzinomen
2.2 Diagnostik des Mammakarzinoms
2.3 Therapie des Mammakarzinoms
3 Genetische Aspekte
3.1 Tumorsuppressor- und Protoonkogene
3.2 BRCA 1
3.2.1 Eigenschaften
3.2.2 Mutationen im BRCA 1 Gen
3.3 BRCA 2
3.3.1 Eigenschaften
3.3.2 Mutationen im BRCA 2 Gen
3.4 Funktionelle Gemeinsamkeiten von BRCA 1 und 2
3.5 Weitere genetische Faktoren für das Mammakarzinom
3.6 Risikoeinschätzung bei Mutationsträgerinnen
3.7 Mutationsnachweis / Gentest
3.7.1 Probleme
3.7.2 Methoden
3.8 Die genetische Beratung
3.8.1 Durchführung
3.8.2 Zielgruppe
4 Psychosoziale Aspekte
4.1 Die genetische Beratung, ein psychosoziales Gefüge
4.1.1 Die kognitive Verarbeitung der Information
4.1.2 Kognitive Auffassungen und Gesundheitsverhalten
4.1.3 Emotionale Verarbeitung
4.1.4 Meinungen zum Grund der Erkrankung
4.1.5 Auffassungen zur Schwere der Erkrankung und Anfälligkeit
4.1.6 Auffassungen zur Kontrollierbarkeit der Erkrankung
4.1.7 Emotionaler Stress und Gesundheitsverhalten
4.1.8 Emotionaler Stress und Entscheidung zum DNS-Test
4.1.9 Verarbeitungsstrategien
4.1.10 Anleitung und Unterstützung der familiären Kommunikation
4.1.11 Ergebnis
4.2 Möglichkeiten der Prävention
4.2.1 Prophylaktische Mastektomie
5 Schlussbetrachtung
6 Zusammenfassung
7 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Der weitaus größte Teil der Zeit, die der Mensch auf der Erde existierte, war von einer Fülle lebensbedrohlicher Krankheiten geprägt, gegen die man machtlos war. Erst seit wenigen Generationen hat die moderne Medizin es möglich gemacht, vielen Gebrechen die Aussichtslosigkeit zu nehmen und das Leben in dieser Hinsicht sorgloser werden zu lassen. Doch selbst die moderne Forschung kann bis heute längst nicht alles erklären, und es gibt Krankheiten, die nach wie vor als Geißeln der Menschheit betrachtet werden. Eine dieser Geißeln ist die Krebserkrankung, die in Form des hereditären Mammakarzinoms in dieser Arbeit näher betrachtet werden soll.
In vielerlei Hinsicht ist die Brust der Frau ein Phänomen. Zum einen ist sie ein erotisches Symbol der Liebe und eine Quelle lebensnotwendiger Nahrung für den Säugling, zum anderen ist sie für viele eine Brutstätte der Angst, liegt hier doch der Ursprung einer der häufigsten Tumorarten bei Frauen in Deutschland [Hampl 1997]. Selbst in der männlichen Bevölkerung erkrankt immerhin jeder Tausendste im Laufe seines Lebens an Brustkrebs [Hofferbert 1998]. Insgesamt sind 90 - 95 % dieser Fälle durch komplexe Interaktionen von endogenen und exogenen Faktoren erworben und gelten als sporadischer Tumor. Bei etwa 5 - 10 % tritt jedoch eine genetische Disposition und eine familiäre Häufung der Erkrankung in aufeinander folgenden Generationen auf, wodurch sie als erblich (hereditär) eingestuft werden [Hofferbert 1998]. Hierbei wird nicht der Krebs im eigentlichen Sinne vererbt, sondern die Veranlagungen, welche die Entstehung bestimmter Neoplasien begünstigen. 1990 hat die Gruppe um Marie Claire King (Universität Berkeley) das erste Mal bewiesen, dass in einigen Familien ein einzelnes Gen für die Entwicklung von Brustkrebs verantwortlich gemacht werden kann. Bei gehäuft auftretenden Mamma- und Ovarialkarzinomen ist diese genetische Disposition inzwischen in Form von Mutationen in den zwei Tumorsuppressorgenen BRCA 1 und BRCA 2 (BReast CAncer 1 und 2) als Ursache isoliert worden. Mittlerweile sind etwa 50 verschiedene „hereditary cancer syndroms“ bekannt [Müller 1995]. So ermöglicht es die moderne Gentechnik, Mitglieder betroffener Familien schon im Vorwege genetisch zu testen und ein individuelles Vorsorgeprogramm zu entwickeln.
Immerhin steigt das Erkrankungsrisiko bei Mutationsträgern von 10 % auf 60 % (BRCA 2) bis 80 %(BRCA 1) und ist häufig schon vor dem 50. Lebensjahr, also prämenopausal, zu beobachten [Hofferbert 1998]. Diese Erkenntnisse haben unter anderem zur Definition sogenannter Hochrisikofamilien geführt und liegen den Indikationskriterien für Genuntersuchungen im Förderprogramm der Deutschen Krebshilfe zu Grunde.
Trotz der neuen Möglichkeiten und Erfolge darf nicht die Tatsache vergessen werden, dass die Entdeckung dieser genetischen Prädisposition wichtige Fragen aufwirft. Was bedeutet es, Mutationsträger zu sein? Wie lebt man mit der Diagnose „Hochrisikopatient“, wie gehen die Patienten mit den Ängsten um? Wie sicher sind präventive Maßnahmen, und, bezogen auf die Frage der Brustentfernung (Mastektomie), wie radikal dürfen sie ausfallen,? Wie ist der heutige Stand der Forschung und wie sollten Betroffene beraten werden? Letztlich die Frage, was bedeutet das alles für die Zukunft der Medizin?
Demzufolge enthält diese Arbeit:
- die klinisch-medizinischen Aspekte der Brustkrebserkrankung (Kapitel 1),
- die genetischen Grundlagen der Gene BRCA 1 und BRCA 2 nach dem heutigen Wissensstand (Kapitel 2) und
- psychosoziale Überlegungen, die sich unter den Bedingungen der neuen Erkenntnisse ergeben (Kapitel 3)1
2 Klinisch-medizinische Aspekte
Das Wissen über den Verlauf der Brustkrebserkrankung ist eine maßgebliche Voraussetzung für die stadiengerechte Planung und Durchführung der Primär- und Zusatztherapie. Eine differenzierte Diagnose und die histologische Untersuchung sind ebenfalls äußerst wichtige Grundlagen, damit die Behandlung erfolgreich verlaufen kann. Daher erfordert eine solch komplexe Erkrankung die Zusammenarbeit von Klinikern, Radiologen, Pathologen und Chirurgen.
Erkenntnisse aus der Histologie der Mammakarzinome lassen verschiedene Formen und Stadien erkennen, auf die in Kapitel 2.1 näher eingegangen werden soll.
2.1 Morphologische Grundlagen [Beck 1994]
Das Mammakarzinom entwickelt sich wie viele andere Organkrebse in zwei Phasen über histologisch erkennbare präinvasive Stadien. Nach grundlegenden Untersuchungen entstehen die meisten Formen der Mammakarzinome in den peripheren Brustdrüsenanteilen der Milchgänge, welche in die Läppchenstrukturen einmünden. Diese Einheiten sind aus histogenetischer Sicht die Orte der frühen Kanzerogenese des Drüsenepithels. Hier entstehen die beiden Hauptformen der „In- situ“-Karzinome (Carcinoma lobulare in situ, Carcinoma ductale in situ), aus denen sich die invasiven Formen (invasiv lobuläres und invasiv duktales Karzinom) entwickeln. Die duktalen Tumoren machen ca. 85 %, die lobulären 10 - 15 % aller Mammakarzinome aus [Thomsen 1981]. Diese histogenetische Betrachtungsweise führte schließlich zur Grundlage der heute gültigen WHO-Klassifizierung der Mammakarzinome in der Histopathologie (siehe Tab. 1).
Die von der Histogenese der frühen Karzinomentwicklung abgeleitete Einteilung der Tumortypen basiert nicht nur auf den unterschiedlichen Erscheinungsformen der Struktur, sondern beinhaltet eine Reihe wesentlicher Unterschiede in der Tumorbiologie und der Tumorausbreitung. Sie ist in hohem Maße auch mit dem Problem der Multifokalität und Multizentrizität verknüpft.
Diese grundlegenden Kenntnisse der histologischen Klassifikation der Mammakarzinome sind für die operative Primärtherapie wertvoll, da die Topographie und Pathogenese der Mammakarzinomentwicklung bei der Indikationsstellung brust-erhaltender operativer Verfahren Berücksichtigung finden müssen. Daher soll im Folgenden auf die einzelnen Tumortypen im Hinblick auf ihre charakteristischen Ausbreitungsmuster näher eingegangen werden.
Tabelle 1:
Einteilung der Mammakarzinome in der speziellen Pathologie nach WHO (1981)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Beck 1994
2.1.1 Nicht-invasive Mammakarzinome
Die atypische Drüsenepithelentwicklung in den Milchgängen und den Läppcheneinheiten der Brustdrüse können zu zwei unterschiedlichen Karzinomvorstufen führen: das Carcinoma ductale in situ (CDIS) und das Carcinoma lobulare in situ (CLIS).
1. Carcionoma ductale in situ (CDIS)
Das Carcinoma ductale in situ entwickelt sich von den terminalen Milchgängen über eine zunehmende Entartung der die Gänge auskleidenden Epithelschicht. Es wird auch als intraduktales Mammakarzinom bezeichnet. Die geläufigste Form dabei ist der solide, obstruktiv wachsende Typ [Thomsen 1981]. Während des Tumorwachstums werden die terminalen Milchgänge zunehmend erweitert, so dass eine Brückenbildung zwischen den Gängen oder Wucherungen in den Ganglumina entstehen. Mit diesen intraluminalen Wucherungen geht häufig die Einlagerung von Mikrokalk einher. Die sich hier ansammelnden Kalziumpräparate können einen Durchmesser von mehreren 100 µm erreichen und stellen in charakteristischer Gruppierung, Dichte und Korngröße in der Röntgendiagnostik ein Leitsymptom des duktalen Karzinoms dar [Thomsen 1981]. Diese Mikrokalzifikationen sind nicht in jedem Fall vorhanden und betreffen häufig nur umschriebene Areale der intraduktalen Karzinomentwicklung.
Nach Thomsen (1981) stellen sie allein oder in Kombination mit anderen Kriterien das größte Kontingent unter den mammographisch induzierten Biopsien dar. Der Anteil histologisch positiver Befunde bei Mikrokalzifikationen variiert je nach mammographischer Technik und Indikationsstellung zwischen 8 % und 24 %. Die Mikroverkalkungen geben darüber hinaus direkte oder indirekte Hinweise auf krebsähnliche Veränderungen und Präkanzerosen (Mastopathie Grad III, CLIS). Unter Einbeziehung dieser potentiell bösartigen Befunde erhöht sich der Anteil klinisch bedeutsamer Treffer bei Mikrokalzifikationen auf 25 -30 % der untersuchten Fälle. Zwei bis drei negative Biopsien sind dabei der Preis für die Entdeckung einer potenziell oder manifest bösartigen Veränderung.
Ausgehend von den terminalen Milchgängen können tapetenförmig weitere Bereiche von der Karzinomentwicklung erfasst werden. Die krebsartig veränderten Drüsenepithelien können so bis in die Haut der Brustwarze bzw. deren Hof vorwachsen und hier das klinische Bild des Mamillenekzems hervorrufen. Ebenso kann auf der anderen Seite die Struktur der Drüsenläppchen von dem entarteten Epithel befallen werden, das mit dem Begriff der „Kanzerisierung von Lobuli“ beschrieben wird.
Ein großes Problem des Carcinoma ductale in situ ist die quantitative Erfassung der Veränderung der Brustdrüse. Einerseits muss bei den bisher umschriebenen Formen bei einer Flächenausdehnung von 2,5 cm nicht mit einer Lymphknoten- metastasierung gerechnet werden. Andererseits finden sich bei größeren Geschwulsten des intraduktalen Mammakarzinoms mit zunehmender Flächenausdehnung trotz fehlendem Nachweis invasiven Wachstums Lymphknoten- metastasen (sog. histologisch okkulte Invasionen). Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, auch bei diagnostiziertem nicht-invasiven Wachstum eine sorgfältige Lymphknotenentfernung durchzuführen.
Die biologische Bedeutung dieser Karzinomvorstufe besteht darin, dass innerhalb eines Intervalls von 10 Jahren mit einer Veränderung zum invasiven Karzinom zu rechnen ist. Im Vergleich zum Karzinoma lobuläre in situ ist das multizentrische Auftreten und die beidseitige Lokalisation eines Carcinoma ductale in situ seltener. Umschriebene Formen des CDIS (maximaler Größendurchmesser 2,5 cm) werden heute bezüglich der Eignung für eine brusterhaltende Therapie in Studien untersucht.
2. Carcinoma lobulare in situ (CLIS)
Die intraepitheliale Karzinomentwicklung, die ihren Ausgangspunkt in den Läppchenstrukturen der Brustdrüse hat, unterscheidet sich schon im Zellbild grundlegend von dem CDIS: Das lobuläre Karzinom in situ ist charakterisiert durch gleichartige, meist kleinzellige Tumorepithelien mit auffallender Helligkeit des Zellplasmas. Die entarteten Drüsenepithelien füllen die Drüsenendstücke aus und haben eine ausgedehnte Erweiterung der Läppchenstruktur zur Folge. Das Volumen der Drüsenläppchen nimmt damit im Vergleich zur Normalstruktur erheblich zu. Sekundär kann auch ein Übergreifen auf die terminalen Gangsegmente stattfinden. Charakteristisch für das CLIS ist das gleichzeitige Entstehen in mehreren
Drüsenläppchen, ohne dass mit Mikrokalzifikationen gerechnet werden kann. Daher ist diese Karzinomvorstufe in der Frühdiagnostik mit den konventionellen Methoden der Mammographie und Sonographie in den meisten Fällen nicht erfassbar. Die Quantität der CLIS-Herde, also die Anzahl befallener Läppchen, ist aber ein wesentlicher Wegweiser für die operative Entfernung und muss im histologischen Befund detailliert beschrieben sein. Die operative Therapie erfordert daher eine enge Zusammenarbeit von Histopathologen, Operateuren und Radiologen.
Bezüglich der biologischen Wertigkeit des lobulären Karzinoms in situ wird heute von einem Zeitintervall von 15 Jahren ausgegangen, bevor es sich zu einem invasiven Karzinom entwickelt. Gehäuftes Auftreten wird vor allem bei einer anamnestisch erhobenen familiären Vorbelastung beobachtet. Diese ist häufig gekoppelt mit beidseitigem Befall, einer Multifokalität und Multizentrizität des CLIS.
2.1.2 Invasive Mammakarzinome
Aus den beiden oben beschriebenen Karzinomvorstufen (Carcinoma ductale bzw. lobulare in situ) entwickeln sich im Laufe der Zeit die beiden Hauptformen invasiver Mammakarzinome: das invasiv-duktale und das invasiv-lobuläre Mammakarzinom.
1. Das invasiv-duktale Mammakarzinom
Das invasiv duktale Karzinom ist der häufigste Tumortyp, der bei 60 - 70 % der Fälle auftritt. Ausgehend von der intraduktalen Entwicklung in den Enden der Milchgänge dringen die karzinomatös entarteten Drüsenepithelzellverbände frühzeitig invasiv in das umliegende Fett- und Bindegewebe ein. Die Außenbezirke des Tumors erscheinen sehr zellreich. Im Zentrum des Tumorknotens findet sich eine zunehmende Bindegewebsbildung (Fibrosierung) mit relativer Zellarmut. Das ergibt bei der Mammographie die typische sternförmige Tumorbildung mit zentralem Tumorschatten. Äußerlich sichtbar sind die Auswirkungen der zentralen Fibrosierung, die in Form von Einziehungen der Haut und des Brustwarzenkomplexes auftreten können. Der frühzeitige invasive Befall der Lymphspalten in den äußeren Tumorarealen ist die Voraussetzung für eine Lymphknotenmetastasierung im Achselbereich bzw. eine generalisierte Metastasierung. Diese häufigste Form des invasiv-duktalen Tumors ist in seiner biologischen Bedeutung charakterisiert durch Tumorknoten, welche frühzeitig im Mammogramm erkannt bzw. von der Patientin als tastbare Tumoren selbst entdeckt werden können. Das meist unifokale Auftreten ist die Voraussetzung für eine in den meisten Fällen brusterhaltende Primärtherapie.
Das invasiv-duktale Mammakarzinom bildet neben der beschriebenen Hauptform verschiedene Subtypen (siehe Tabelle 1), die für das Thema dieser Arbeit nicht relevant sind und daher nicht näher beschrieben werden sollen.
2. Das invasiv-lobuläre Mammakarzinom
Die zweite Hauptform der Brusttumoren wird vom invasiv-lobulären Mammakarzinom gebildet. Diese Form des Mammakarzinoms stellte eine eigene Form dar und hat im Gegensatz zum invasiv-duktalen Tumor keine weiteren Untergruppen. Es ist charakterisiert durch Kleinzelligkeit der invasiven wachsenden Tumorepithelzellverbände, die das Brustdrüsengewebe durchdringen. Dabei können intakte Milchgänge von außen infiltriert werden. Weiterhin besteht eine auffallende Gleichartigkeit der Zellverbände ohne stark veränderte Zellteilungsrate. Der diffuse Befall des intakten Drüsengewebes führt selten zur charakteristischen Knotenbildung und ergibt häufig eine negative Mammographie bzw. eine verminderte Strahlentransparenz.
Die biologische Bedeutung des invasiv-lobulären Mammakarzinoms in Hinsicht auf die operative Therapie besteht in der genannten Unschärfe der Knotenbildung und dem häufig späten Erkennen der malignen Entartung. Wie beim Carcinoma lobulare in situ bereits beschrieben, ist insbesondere bei familiärer Belastung die Multifokalität und Multizentrizität ein Problem. Kleine (< 3 cm) invasiv-lobuläre Mammakarzinome ohne nachgewiesene Multifokalität bzw. Multizentrizität sind für eine brusterhaltende Therapie geeignet.
Die dargestellten Charakteristika der genannten Karzinome und ihrer Vorstufen, welche mit den WHO-Klassifikationen verknüpft sind, enthalten eine Fülle wichtiger Informationen für den Kliniker, der die Entscheidung zur Wahl des Operationsverfahrens zu treffen hat. Dennoch ist die Mammakarzinomerkrankung im
Einzelfall ein individuelles Ereignis, das sich nur ungefähr in die WHO-Einteilung einfügen lässt. Meistens zeigt die Erfahrung in der Histologie, dass häufig Mischformen der oben beschriebenen Tumortypen vorliegen, die nur nach ihrer überwiegenden Wuchsform klassifiziert werden können.
2.1.3 Besonderheiten bei BRCA 1-/2-Karzinomen [Untch 1998]
Mehrere Studien weisen histologische Unterschiede zwischen erblichen und erworbenen Formen von Brustkrebs bezüglich Ploidie und Grading (histopathologische Prognosefaktoren) auf. Zum Beispiel sind BRCA 1-assoziierte Tumoren signifikant häufiger aneuploid gegenüber nicht hereditären Karzinomen (87 % vs. 65 %) und wiesen häufiger (61 % vs. 27 %) ein Grading 3 auf. Auffallend seltener gegenüber den sporadischen (20 % vs. 35 %) und auch BRCA 2-Tumoren sind bei BRCA 1-assoziierten Karzinomen duktale In-situ-Karzinome. Ebenso waren BRCA 1-Karzinome häufiger östrogen- und progesteronrezeptor-negativ als sporadische Tumoren.
Darüber hinaus ergeben sich auch histopathologische Unterschiede unter den Subgruppen hereditärer Mammakarzinome. So findet sich ein Grading 3 in BRCA 1- Tumoren in 66 % im Vergleich zu 41 % bei BRCA 2. Tubuläre und auch lobuläre Karzinome werden wiederum häufiger bei BRCA 2-assoziierten Tumoren gefunden, wobei insgesamt eine größere Heterogenität dieser Karzinome beobachtet wird. Aufgrund der deutlich ungünstigeren histopathologischen Charakteristika ist zu erwarten, dass sich auch die klinischen Verläufe hereditär bedingter Tumorerkrankungen von denen sporadischer unterscheiden. Hierzu liegen in der Literatur unterschiedliche Aussagen vor. Einerseits wird berichtet über eine niedrigere Rezidivrate und längere Überlebenszeit bei BRCA 1-Mutations- trägerinnen mit Mammakarzinom, wobei keine Aussage zum Tumorstadium gemacht wird. Andererseits ergaben neuere Untersuchungen hingegen nach Angleichung der Tumorstadien keine signifikant unterschiedlichen Überlebens- oder Rezidivraten bzw. sogar ein tendenziell schlechteres Outcome für Patientinnen mit hereditär bedingten Tumoren. Außerdem wurden im Vergleich zu sporadischen Mammakarzinomen signifikant häufiger kontralaterale Tumoren gefunden.
Beim Mammakarzinomgewebe des Mannes ergab sich ebenfalls ein hoher Anteil an Grading 3-Tumoren, ohne dass diese mit einer signifikant schlechteren Prognose korrelierten gegenüber dem sporadischen Brustkrebs der Frau.
Beim Ovarialkarzinom ergaben sich für hereditär bedingte oder sporadische Formen keine derartigen Unterschiede bezüglich histopathologischer Unterformen. Bei Betrachtung des Krankheitsverlaufs ergaben sich allerdings in der retrospektiven Untersuchung einige Unterschiede. Auch bei fortgeschrittenen Stadien war die mediane Überlebenszeit bei erblichen Formen gegenüber sporadischen deutlich länger (77 Monate vs. 29), der Verlauf damit günstiger.
Die Relevanz solcher Ergebnisse wird anhand tumorbiologischer Überlegungen deutlich: Das bei BRCA 1-assoziierten Tumoren gehäuft auftretende Grading 3 sowie der geringe Anteil an In-situ-Karzinomen könnte darauf hinweisen, dass diese Tumoren die Karzinogenese schneller durchlaufen, rascher proliferieren und damit eine hohe Anzahl an Intervallkarzinomen auftritt. Da gerade der Mikrokalk als Charakteristikum des DCIS die mammographische Früherkennung erlaubt, könnte darüber hinaus die Wertigkeit der Mammographie in dieser speziellen Hochrisikogruppe eingeschränkt sein. Es könnte sogar bei Frauen mit genetischer Prädisposition für Brustkrebs eine höhere Strahlensensibilität auch gegenüber diagnostischer Strahlenbelastung bestehen. Es bestehen dafür bisher zwar keine Beweise, aber es könnte zu einem geringen Anstieg der strahleninduzierten Karzinome kommen. Insgesamt muss in Studien geklärt werden, inwieweit die bekannten klinischen Screeningverfahren auch in diesen Hochrisikogruppen die Erkrankungsrate bzw. Mortalität senken können.
2.2 Diagnostik des Mammakarzinoms
Für eine erfolgversprechende Therapie des Mammakarzinoms ist der Zeitpunkt der Entdeckung des Tumors von maßgeblicher Bedeutung. Die Qualität der Diagnoseverfahren kann daher einen erheblichen Einfluss auf die Prognose der Erkrankung haben.
Grundsätzlich kann man die diagnostischen Verfahren in zwei Kategorien unterteilen: invasive (hier die Biopsie) und nicht-invasive wie die körperliche Untersuchung, Mammographie, Sonographie und Kernspintomographie.
Nicht-invasive Methoden
Im Rahmen der jährlichen Vorsorgeuntersuchungen haben vorrangig die nicht- invasiven Methoden eine Bedeutung erlangt. Hierzu zählt in erster Linie die körperliche Untersuchung, die nach Tiling (1998) folgendermaßen durchgeführt werden sollte:
Die wichtigsten äußerlichen Voraussetzungen sind gute Lichtverhältnisse und ein komplett entkleideter Oberkörper. Bezogen auf die Patientin ist direkt nach der Periodenblutung die beste Zeit für eine Untersuchung, da die Mammae dann weniger empfindlich und gespannt sind. Für die eigentliche Untersuchung hat sich folgender Ablauf bewährt:
- Inspektion in unterschiedlichen Positionen (Arme seitlich, Arme über dem Kopf, Oberkörper nach vorne und Arme hängend, Hände in die Hüften gestemmt)
- Untersuchung der Lymphknoten (Abtasten der supra- und infraklavikulären und der axillären Lymphknoten)
- Palpation der Mammae (Patientin liegt auf einer festen Unterlage, es wird von den Mammillen spiralförmig bis zum Brustansatz abgetastet)
Da diese Untersuchungen vom Arzt nur jährlich durchgeführt werden, kommt der monatlichen Selbstuntersuchung eine große Bedeutung zu. Das beweisen auch die Umstände in der onkologischen Ambulanz der I. Universitäts-Frauenklinik München. Von den jährlich über 400 neu an Brustkrebs erkrankten Patientinnen, die sich hier vorstellen, hat die Mehrzahl das Karzinom selbst entdeckt [Tiling 1998]. Sollten sich bei der körperlichen Untersuchung suspekte Befunde in Brust- oder Lymphknotenregion ergeben, müssen weitere Maßnahmen eingeleitet werden. Zunächst stützt man sich dabei auf bildgebende Verfahren, wie die Mammographie. Diese wird in Deutschland ohnehin ab dem 40. Lebensjahr in 2-jährlichen, ab dem 50. Lebensjahr in jährlichen Abständen Bestandteil der Vorsorgeuntersuchung. Laut www.Krebsinfo.de müssen Mammographien in zwei Ebenen angefertigt werden, da bei Aufnahmen in nur einer Ebene ein diagnostischer Verlust von 20 % zu erwarten ist. Die mittlere effektive Dosis der Mammographie beiderseits in zwei Ebenen beträgt ca. 0,5 mSv. Damit liegt der Wert im Niedrigdosisbereich, und es ist normalerweise kein erhöhtes Strahlenrisiko zu erwarten. Bei einer bestimmten Form des genetisch bedingten Mammakarzinoms, dem Ataxia-teleangiectasia (AT)-Gen (in Kapitel 3.5.1 näher beschrieben), ist jedoch besondere Vorsicht geboten. Die Zellen von Patientinnen mit einer AT-Gen-Mutation weisen eine auffallende Empfindlichkeit gegenüber Röntgenstrahlen auf [Müller 1995]. Prophylaktische Mammographien können hier zum Auslöser der Erkrankung werden und damit eher schaden als nutzen. Betroffene der AT-Gen-Mutation und auch anderweitig genetisch belastete junge Frauen mit einem dichten Brustdrüsenkörper und daher eingeschränkter mammographischer Beurteilbarkeit sollten einer Screeningmethode ohne Strahlenbelastung wie Sonographie oder Kernspintomographie unterzogen werden.
Invasive Methoden [Tiling 1998]
Bei den heute gut entwickelten bildgebenden Verfahren und ihrer kompetenten Interpretation durch erfahrene Diagnostiker gelingt es, ca. 95 % der invasiven Karzinome nachzuweisen. Da diese aber keinen Malignitätsbeweis liefern können, wird die invasive Diagnostik praktisch als Voraussetzung für die Einleitung der operativen Therapie angewendet. Unpassend auch noch als Probeexzision bezeichnet, sollte sie in der Abklärungskaskade aber an letzter Stelle stehen.
Bildgesteuerte perkutane Stanzbiopsien erreichen eine diagnostische Sicherheit von knapp unter 100 %. Sie sind für die Patientin wenig belastend und ohne kosmetische Folgen, doch leider werden diese Möglichkeiten nicht ausgeschöpft. Auch vorschnelle operative Maßnahmen sollten die gezielte Mammadiagnostik nicht überspringen.
Bei klinischem Befund sind ohne bildgebende Hilfe die Feinnadelaspiration und die Feinnadelbiopsie möglich. Bei Haut- und Subkutanbefunden hat sich der Einsatz der Hautstanze mit einem Durchmesser von 2 - 6 mm bewährt. Man erhält so für die histologische Untersuchung einen Stanzzylinder, wobei außer einer Lokalanästhesie und einem Druckverband kein weiterer Aufwand zu betreiben ist. Dagegen ist die diagnostische Extirpation wiederum an bestimmte chirurgische Gesetzmäßigkeiten gebunden (kosmetische Schnittführung, präoperative Einfärbung, komplette Entfernung etc.), die eine Vorabklärung durch eine Biopsie sinnvoll erscheinen lässt.
Genetische Diagnostik
Seit einigen Jahren bewegt sich die Forschung auf einem völlig neuen Gebiet. Wie bereits erwähnt, sind mehrere Gene bekannt, die für eine Brustkrebserkrankung prädisponieren. Die Möglichkeit der Krebsprävention dank genetischer präsymptomatischer Diagnostik ist so zu einer Herausforderung der heutigen Medizin geworden. Bisher werden aber nur Mitglieder aus nachweislichen Hochrisikofamilien untersucht. Nach Müller (1995) wird dabei wie folgt vorgegangen:
Zuerst sucht man bei einer betroffenen Patientin aus der Risikofamilie nach einer krankheitsauslösenden Mutation. Ist diese isoliert, wird das zu untersuchende Mitglied dieser Familie auf eben diese Mutation hin getestet. Dann gibt es drei Möglichkeiten:
1. Die Patientin hat diese Mutation nicht und hat somit das gleiche Risiko wie die Normalbevölkerung und kann an der Standardvorsorge teilnehmen.
2. Die Patientin hat diese Mutation nicht, könnte aber eine noch nicht identifizierte, krankheitsauslösende genetische Veränderung aufweisen. Das Risiko wird in diesem Falle allein aus der familiären Situation geschätzt.
3. Die Patientin ist Trägerin der Mutation. Sie hat ein erhöhtes Erkrankungsrisiko und benötigt ein besonderes prophylaktisches Screeningprogramm. Für die häufigen Tumorerkrankungen der Brustdrüse müssen jedoch noch viele logistische und medizinische Probleme gelöst werden, bevor diese präsymptomatische genetische Diagnostik als eine Routineuntersuchung oder gar für Screeningtests angeboten werden kann. Bei der genetischen Beratung sollte in jedem Fall auf die Möglichkeiten, aber auch auf die Grenzen der Spezifität und Sensitivität der Verfahren hingewiesen werden.
2.3 Therapie des Mammakarzinoms [Tiling 1998]
Die radikale Operationstechnik des Mammakarzinoms wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt. Erst nach Respektierung des systemischen Charakters der Erkrankung ab 1965 kam es zu einer Kehrtwendung in der Chirurgie des Mammakarzinoms. Seit etwa 30 Jahren haben sich die Prinzipien der sicheren lokalen Tumorkontrolle nach dem Grundsatz „soviel wie nötig, so wenig wie möglich“ in Verbindung mit Strahlen-, Hormon- und Chemotherapie bewährt.
Die brusterhaltende Operation
Ein für das Selbstwertgefühl der Betroffenen wichtiges brusterhaltendes Verfahren ist möglich geworden, wenn eine sichere Tumorentfernung erreicht werden kann und wenn die Patientin dies wünscht. Die brusterhaltende Operation beinhaltet eine diagnostische Tumorentfernung und die Axillaausräumung. Die Lymphknoten- entfernung ist gegenwärtig Bestandteil sowohl der brusterhaltenden als auch der entfernenden Operationsverfahren. Der Lymphknotenstatus ist ein bedeutender Diagnose- und Prognosefaktor, die Operation aber nicht ganz unproblematisch. Daher wird zur Zeit geklärt, ob andere Prognosefaktoren (z. B. Knochenmarkbefall) eine axilläre Ausräumung der Lymphknoten ersetzen können, wenn sie klinisch frei erscheinen.
Liegt eine Multizentrizität oder eine exzessive intraduktale Wuchsform vor, sollte von einer brusterhaltenden Operation abgesehen werden. Dasselbe wird empfohlen, wenn eine postoperative Bestrahlung von der Patientin abgelehnt wird. Das hohe Lokalrezidivrisiko bei jungen Frauen ist dagegen keine Gegenanzeige für eine brusterhaltende Therapie, denn das Schicksal dieser Frauen entscheidet sich nicht lokal, sondern durch frühe Metastasierung.
Die brustentfernende Operation (Mastektomie)
Die modifizierte radikale Mastektomie unter Erhalt der gesamten Muskulatur wird bei etwa 30 % der Patientinnen erforderlich. Diese hat keine funktionellen Auswirkungen zur Folge, ganz im Gegensatz zur indizierten radikalen Mastektomie. Bei dieser nur sehr selten zur Anwendung kommenden Technik liegt meist eine Infiltration des Muskelgewebes vor, das dann mit entfernt werden muss. Brustrekonstruktionen mit autologem oder heterologem Material sind in vielen Variationen möglich und aus psychologischer Sicht unbedingt zu begrüßen. Nach rein onkologischen Gesichtspunkten sind diese Rekonstruktionen jedoch nicht ganz unproblematisch.
Radiatio beim Mammakarzinom
Zur brusterhaltenden Operation gehört im Anschluss eine Strahlentherapie der Restbrust mit einer Dosierung von 50 Gy. Diese kontrolliert die trotz weiträumiger Resektion verbliebenen mikroskopischen Tumorreste bei etwa 80 % der Patientinnen. Damit wird die Rate der Rezidive von 30 - 40 % nach 5 - 10 Jahren ohne Bestrahlung auf 5 - 10 % gesenkt. Eine Strahlentherapie der regionären Lymphknoten ist nur bei Befall indiziert.
Die Radiotherapie nach der brusterhaltenden Operation hat ihre unstrittige Berechtigung als Standardbehandlung, da zusätzlich bestrahlte Patientinnen seltener wegen Lokalrezidiven mastektomiert werden müssen. Auch die psychologischen und wirtschaftlichen Belastungen sind durch die Senkung der Rezidivrate geringer.
Chemotherapie des Mammakarzinoms
Das Mammakarzinom gilt als chemosensibel, die Chemotherapie ist daher Bestandteil vieler Therapieschemata.
Durch die primäre Chemotherapie kann beispielsweise ein großer Tumor operabel gemacht und sogar eine brusterhaltende Therapie ermöglicht werden. Besonders die sehr schlechten Prognosen beim inflammatorischen Mammakarzinom können durch diese Therapieform evtl. mit anschließender Knochenmarktransplantation oder Stammzellreinfusion grundlegend geändert werden.
Ebenso ist die Chemotherapie im Rahmen der Primärbehandlung zur Sanierung potenzieller okkulter Fernmetastasen indiziert.
Umfangreiche Metaanalysen haben den Vorteil dieser Therapie bewiesen, es bleibt allerdings problematisch, das individuelle Risiko und den Nutzen für die jeweilige Patientin zu bestimmen. Es ist immer noch unklar, welche Chemotherapie oder hormonablativen Maßnahmen am effektivsten sind. Die Chemotherapie geht auch nach wie vor mit einer hohen Nebenwirkungsrate einher.
Hormontherapie des Mammakarzinoms
Hormone weisen in der Ätiologie des Mammakarzinoms eine Schlüsselstellung auf und sind daher seit über 100 Jahren im therapeutischen Einsatz. Von der anfänglichen Ovarektomie ist man übergegangen zu einer spezialisierten individuellen Therapie, die vom Östrogen- und Progesteronstatus des Tumors, von seiner Klassifikation und vom Menopausenstatus der Patientin abhängig ist. Im Allgemeinen wird eine Hemmung des endogenen Östrogens angestrebt, die auf unterschiedliche Weise erreicht werden kann (z. B. durch Ovarektomie, Antagonisierung des Estrogens, Hemmung der ovariellen Produktion etc.). Wegen der im Vergleich zur Chemotherapie geringeren Nebenwirkungen ist die Entscheidung für eine Hormontherapie leichter. Teilweise werden die Medikamente (klassisches Beispiel ist Tamoxifen) nicht nur zur Nachbehandlung eingesetzt, sondern auch bei Risikopatientinnen zur Prävention.
3 Genetische Aspekte [Schernek 1999]
An der Entstehung familiärer Mammakarzinome sind Keimbahnmutationen in verschiedenen Genen ursächlich beteiligt. Zur Zeit sind unter anderem zwei Gene bekannt, die für einen Großteil der Fälle in Hochrisikofamilien verantwortlich sind. Zum einen handelt es sich um das BRCA 1 Gen auf dem langen Arm des Chromosoms 17, zum anderen das BRCA 2 Gen auf dem langen Arm des Chromosoms 13 (derzeit wird BRCA 3 auf Chromosom 8 vermutet [Untch 1998]). Prädisponierende Mutationen werden über einen autosomal dominanten Erbgang weitergegeben und liegen dann in den meisten Fällen als heterozygote Veränderung vor. Im homozygoten Zustand können sie das Risiko für Brustkrebs und Ovarialtumoren erheblich erhöhen. Beide Vertreter gehören der Klasse der Tumorsuppressorgene an, die generell die maligne Entartung einer Zelle verhindern sollen. Die genaue Funktion dieser Tumorsuppressorgene ist bisher lediglich in ihren Grundzügen bekannt:
3.1 Tumorsuppressor- und Protoonkogene [Erbar 1994]
Auf der DNS einer jeden Zelle befinden sich sogenannte Protoonkogene, die man auch als die „eigentlichen Krebsgene“ bezeichnet. Das Protoonkogen selbst ist nicht direkt der Auslöser einer malignen Entartung der Zelle. Erst ein dazugehöriges Regulatorgen ist in der Lage, das jeweilige Protoonkogen so zu beeinflussen, dass es zum Onkogen mutiert. Unter diesen Umständen wird ein spezielles Protein gebildet, das eine unkontrollierte Zellteilung auslöst und so ein Tumorwachstum einleitet. Zudem können so veränderte Onkogene über kodierte Proteine „normale“ benachbarte Zellen zur Annahme eines neoplastischen Charakters veranlassen. Außerdem fehlt die regulierende Kontaktinhibition, das heißt, es kommt nicht mehr zu einem Stillstand der Zellteilung und des Wachstums bei allseitiger Berührung. So würde es praktisch in jeder Zelle zur Entstehung eines malignen Tumors kommen. Auf der normalen DNS gesunder Zellen gibt es jedoch neben den Protoonkogenen und den dazugehörigen Regulatoren die so genannten Tumorsuppressorgene (TSG). Diese Genabschnitte kodieren Proteine, die das jeweilige Regulatorgen des Protoonkogens blockieren, sodass die Umwandlung zum Onkogen nicht mehr stattfinden kann.
Diese Schutzwirkung geht verloren, wenn beide Allele eines TSG in einer Zelle mutiert und damit fehlgesteuert sind. Wird die mutierte Form eines Allels mit der Keimbahn vererbt, führt eine spontane Mutation im zweiten Allel auf zellulärer Ebene zur Aufhebung der Tumorsuppression und damit zur Transformation der Zelle. Bei einer ungestörten Funktion der normal aufgebauten DNS ist also der regulierte Ablauf der Zellteilung garantiert.
Das deutsche Ärzteblatt [Holinski-Feder 1998] schreibt, dass es nicht nur diese eine Form der Tumorsuppressorgene gibt, die in erster Linie an der Regulation der Zellteilung beteiligt sind. Zunehmend wird deutlich, dass Mutationen in Genen, die für DNS-Reparatur-Enzyme kodieren, ebenfalls zu Tumorerkrankungen führen. Dabei wird die Zellteilung indirekt beeinflusst, denn die fehlenden Ausbesserungen an der zerstörten DNS können unter anderem auch Mutationen in Genen akkumulieren, die an der Zellteilung mitwirken. Ein Ausfall der Regulation führt dann zu unkontrollierter Teilung und damit zum Tumorwachstum. Somit müssen auch diese Genabschnitte zur Klasse der Tumorsuppressorgene gerechnet werden. Die in dieser Arbeit relevanten Tumorsuppressorgene BRCA 1 und BRCA 2 kodieren Proteine, die nach heutigem Stand der Wissenschaft an eben solchen Reparaturen von DNS-Doppelstrangbrüchen und an der Regulation der Zellteilung beteiligt sind. Eine Tumorentstehung kann hier durch unterschiedliche Gegebenheiten hervorgerufen werden. Liegt eine prädisponierende Keimbahnmutation in einem DNS-Reparaturgen vor, müssen noch das zweite Allel des Reparaturgens sowie beide Allele des Regulatorgens eine Mutation erfahren, bevor die maligne Entartung der Zelle beginnen kann. Tritt eine prädisponierende Keimbahnmutation jedoch in einem Regulatorgen auf, reicht bereits eine zusätzliche somatische Mutation im zweiten Allel, um ein Tumorwachstum zu begünstigen. Wegen des umfangreicheren Mutationsweges verursachen Keimbahnmutationen in Reparaturgenen vermutlich ein geringeres Erkrankungsrisiko als solche in Regulationsgenen. Denn selbst vor dem Hintergrund eines defekten DNS-Reparatur- Systems sind drei weitere somatische Mutationen in ein und derselben Zelle unwahrscheinlicher als lediglich eine.
Bisher ungeklärt ist die Tatsache, dass Keimbahnmutationen grundsätzlich in allen Körperzellen vorhanden sind und alle Zellen auch weitere Mutationen erfahren können, Tumorentstehung allerdings nur in bestimmten Geweben des Körpers (vor allem in derBrust und den Ovarien) beobachtet werden kann.
3.2 BRCA 1 [Hampl 1997]
Molekulargenetische Untersuchungen von Angehörigen großer Mammakarzinom- familien haben es 1990 möglich gemacht, den Genlokus 17q21 bzw. Mutationen in demselben, als einen prädisponierenden Faktor für Mamma- und Ovarialkarzinome zu identifizieren. Im Dezember 1994 gelang dann mittels der positionellen Klonierungsstrategie die Klonierung und Sequenzierung dieses Tumorsuppressorgens, das heute unter dem Namen BRCA1 bekannt geworden ist. Kopplungsuntersuchungen lassen laut dem Zentralblatt für Chirurgie [Hampl 1997] vermuten, dass Keimbahnmutationen im BRCA 1-Gen in 60 - 76 % der Familien mit einer Häufung von Mamma- und Ovarialkarzinomen und in 40 - 50 % der Familien mit mehreren Mammakarzinomen für die Erkrankung verantwortlich sind. Genetische Kopplung wurde aber nur in solchen Familien gefunden, in denen ein Mammakarzinom vor dem 45. Lebensjahr auftrat und in Familien mit gehäuft auftretenden Mamma- und Ovarialkarzinomen [Schernek 1999].
Ein statistisch signifikant gehäuftes Auftreten von Tumoren in bestimmten anderen Geweben wurde bisher allerdings nicht beobachtet [Holinski-Feder 1998].
3.2.1 Eigenschaften [Hampl 1997]
Das BRCA 1 Gen setzt sich aus 24 Exons zusammen, wovon 22 kodierend sind. Mit einer Länge von 100 Kilobasen (kb) ist es ein sehr großes und komplexes Gen mit ungewöhnlicher Struktur, das eine gesamtkodierende Sequenz von 5592 Basen- paaren aufweist [Scherneck 1999]. 21 kleine Exons in der Größe zwischen 100 und 300 Basen und ein großes Exon mit 3,4 kb bestimmen die Struktur dieser Region. Sie kodiert für eine 7,8 kb große m-RNS, die mit Hilfe der Ribosomen in ein Protein, bestehend aus 1864 Aminosäuren, übersetzt wird. Obwohl über die biologische Funktion dieses Eiweißes noch relativ wenig bekannt ist, nimmt man an, dass es in Zellproliferations- und Differenzierungsvorgänge involviert und an DNS-Reparatur- und Rekombinationsfunktionen beteiligt ist [Schernek 1999]. Diese Eigenschaften verleihen dem BRCA 1-Gen den Charakter eines Tumorsuppressorgens. Gehen diese krebshemmenden Eigenschaften zum Beispiel durch eine Mutation in der kodierenden Sequenz verloren, steht der malignen Entartung der Zelle nichts mehr im Wege.
3.2.2 Mutationen im BRCA 1 Gen
Die Frequenz von BRCA 1-Mutationen in der gesamten Bevölkerung ist unbekannt [Schernek 1999]. Sie werden aber gehäuft (12 %) bei jungen Frauen gefunden, die im Alter von 32 Jahren und darunter an Brustkrebs erkrankt sind, weniger bei Erstmanifestationen im höheren Alter (ab 50) [Schernek 1999]. Die bisher beschriebenen Mutationen sind in den meisten Fällen nicht weit verbreitet. Sehr oft kann man sie einer bestimmten Population zuordnen, innerhalb derer sie weitervererbt werden [Backe 1996]. Im Rahmen solcher Untersuchungen wurden viele verschiedene Mutationen von BRCA 1 und 2 gefunden. Der prozentuale Anteil der einzelnen Mutationen schwankt in den verschiedenen Populationen jedoch erheblich, was sich durch sogenannte „founder“-Mutationen erklären lässt. Diese sind vermutlich vor mehreren hundert Jahren entstanden, seither über viele Generationen weitervererbt worden und daher heute verantwortlich für viele familiär gehäuft auftretende Mammakarzinomfälle in einer Population. Das liegt auch daran, dass diese Gene bei Säugetieren einen hohen Grad von Konservierung im Rahmen der Evolution aufweisen, ohne dass Homologien zu bereits bekannten Genen existieren [Schernek 1999]. Vermutlich hat jede Population ein eigenes „Mutationsprofil“ für BRCA 1 und 2, denn Neumutationen in Form von Keimbahn- mutationen sind selten [Holinski-Feder 1998].
Bei Familien mit mindestens 4 Betroffenen mit Mamma- und/oder Ovarialkarzinomen ist der BRCA 1-Genort in 80 % der Fälle involviert [Holinski Feder 1998]. In den meisten Fällen führen die Mutationen zu einer strukturellen Veränderung des Proteins, das dann inaktiv bzw. nur teilweise funktionstüchtig ist. Verschiedene Mutationen können zu unterschiedlich starker Funktionseinschränkung des gebildeten Proteins führen. Die Penetranz ist somit variabel und geht mit einer spezifischen Erkrankungswahrscheinlichkeit und auch mit einem spezifischen Tumorspektrum einher. Untersuchungen haben gezeigt, dass zum Beispiel Mutationen in den Exons 1 - 11 des BRCA 1-Gens mit abnehmender Häufigkeit mit Ovarialkarzinomen assoziiert sind [Holinski-Feder 1998].
Die derzeit bekannten über 500 diagnostizierten Mutationen sind Keimbahnmutationen, und sie ergeben in 86 % der Fälle eine Veränderung in Form eines verkürzten BRCA 1-Proteins. Mehr als 70 % aller Mutationen sind Frameshift- Mutationen, die das Leseraster auf der DNS verschieben und auf diese Weise eine Verkürzung des Proteins erreichen. Das führt zu einem gegenüber der Allgemeinbevölkerung deutlich erhöhten Risiko für Mamma- bzw. Ovarialkarzinome und zu einer geringen Risikoerhöhung für Kolon- und Prostatakarzinome. Neuere Untersuchungen zeigen auch ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs bei Männern.
Neben den mittels Polymerasekettenreaktion (PCR) gefundenen Mutationstypen innerhalb der Exons und deren flankierenden Intronbereichen gibt es auch Mutationen, die mit dieser Methode nicht nachweisbar sind. Im BRCA 1-Gen sind das vor allem Deletionen größerer Bereiche, die durch Rekombinationen in der genomischen DNS entstehen. Vermittelt werden sie durch sogenannte „Alu-repeats“, das sind ca. alle 4 kb vorkommende repetitive Elemente, die im menschlichen Genom enthalten sind. Diese Rekombinationen im BRCA 1-Gen, die eine Deletion im Bereich von bis zu 14 kb zur Folge hat, scheinen nicht selten zu sein [Schernek 1999]. Daraus ergibt sich die interessante Frage, wie häufig diese Deletionen sind und ob sie möglicherweise an der Entstehung sporadischer Tumoren beteiligt sind.
3.3 BRCA 2
Bei der genetischen Analyse von Brustkrebsfamilien war sehr schnell ersichtlich, dass nicht jede als erblich eingestufte Erkrankung immer an das BRCA 1 Gen gekoppelt war. Diese Erkenntnis und das gleichzeitige Auftreten von männlichen Betroffenen führte im Jahr 1994 mit Hilfe der Kopplungsanalyse zur Lokalisation und im darauf folgenden Jahr zur Isolation eines zweiten für Mammakarzinome prädisponierenden Genortes 13q12-q13, dem heute bekannten BRCA 2-Gen [Schernek 1999]. Im Dezember 1995 gelang der Wissenschaft die Klonierung und Sequenzierung dieses DNS-Abschnitts [Hampl 1997]. Nach Schernek 1999 besteht laut aktuellen Angaben eine genetische Kopplung mit dem mutierten BRCA 2-Gen in 32 % der Mammakarzinomfamilien, allerdings nur in 14 % der Mamma- und Ovarialkarzinomfamilien. Sehr auffällig ist die Tatsache, dass BRCA 2 besonders disponierend für Brustkrebs bei männlichen Personen ist. In 76 % der Familien, in denen männliche Betroffene auftreten, ist BRCA 2 an der Erkrankung beteiligt.
3.3.1 Eigenschaften [Hampl 1997 & Schernek 1999]
Strukturell ist das BRCA 2 Gen dem BRCA 1 sehr ähnlich. Seine 26 kodierenden Exons erstrecken sich über eine Länge von ca. 70 kb auf der genomischen DNS. Die mittlere Genregion mit dem 4932 Basenpaar (bp) großen Exon 11 und dem knapp 1000 bp großen Exon 10 bildet, ähnlich wie bei BRCA 1, den größten Teil (60 %) der kodierenden Region des BRCA 2-Gens. Das von diesem Abschnitt gebildete Protein setzt sich aus 3418 Aminosäuren zusammen, und seine Funktion ist bisher ebenso unklar wie die des BRCA 1-Proteins. Da die Analysen von Mammakarzinom-familien mit mutiertem BRCA 2-Gen und die sporadischer Tumoren eine hohe Rate an Heterozygotieverlust zeigen, wird vermutet, dass auch BRCA 2 zu den Tumorsuppressorgenen gehört. Ähnlich wie das BRCA 1-Gen weist es eine Beteiligung an DNS-Reparaturprozessen und Rekombinationsfunktionen auf.
3.3.2 Mutationen im BRCA 2-Gen [Schernek 1999]
Das Mutationsspektrum erstreckt sich im BRCA 2-Gen auf über 330 unterschiedliche Keimbahnmutationen, von denen mehr als die Hälfte nur einmal beschrieben wurde. Auch hier werden wie beim BRCA 1-Gen „founder“-Mutationen beschrieben. Beispielsweise wird bei 1 -1,5 % der Ashkenazim-Juden eine 6174delT gefunden, die sogar auf 8 % bei unter 40-jährigen Erkrankten steigt. Ähnliche Beobachtungen gibt es auf Island, wo die 999del15-Mutation eine der am häufigsten auftretenden BRCA 2-Veränderungen ist, die vor allem bei Männern nachweisbar ist. (40 % aller getesteten isländischen Männer hatten diese spezifische Mutation.)
Wie beim BRCA 1 Gen sind die Mutationen über das gesamte Gen verteilt und das Mutationsprofil ähnelt sich stark. Auch hier sind die Veränderungen meistens in einer Verkürzung des Proteins begründet, das dann nur teilweise funktionstüchtig oder komplett inaktiv ist. Ebenfalls gibt es Hinweise, dass verschiedene Mutationen unterschiedliche Penetranzen für die Entstehung eines Mammakarzinoms hervorrufen. Hier haben Untersuchung belegt, dass Mutationen im Exon 11, im Gegensatz zu einer abnehmenden Häufigkeit bei BRCA 1, mit einem höheren Risiko für Ovarialtumoren einhergehen als solche in anderen Lokalisationen [Holinski-Feder 1998].
Diese Variabilität der Penetranz bezieht sich aber nicht nur auf Unterschiede innerhalb von BRCA 1 oder BRCA 2, man kann zwischen beiden auch Vergleiche ziehen. Untersuchungen haben laut Holinski-Feder (1998) ergeben, dass zum Beispiel bei den Ashkenasim-Juden ein Prozent die Mutation BRCA 1-185delAG trägt und 1,5 % die Mutation BRCA 2-6174delT. Durch die BRCA 1-Mutation werden 43 % der Erkrankungen verursacht, durch die BRCA 2-Mutation aber nur 13 %. Rechnerisch ergibt sich daraus ein 5-fach höheres Risiko für BRCA 1- 185delAG. BRCA 2-Genmutationen sind aber im Unterschied zu denen im BRCA 1-Gen mit einem breiteren Tumorspektrum assoziiert. Handelt es sich bei BRCA 1 vor allem um Mamma- und Ovarialkarzinome, verursacht BRCA 2 zusätzlich ein gehäuftes Auftreten von Mammakarzinomen bei Männern und allgemein vermehrt Pankreas-, Kolon-, Oropharynxtumore und Lymphome [Holinski-Feder 1998].
3.4 Funktionelle Gemeinsamkeiten von BRCA 1 und 2 [Holinski-Feder 1998]
Bei Genen, die sehr groß sind und vermutlich viele Funktionen haben, ist es ziemlich kompliziert, die für die Tumorentstehung relevanten herauszufiltern. Bei BRCA 1 und 2 kommt erschwerend hinzu, dass sie in ihrer Nukleotidabfolge weder zueinander noch zu anderen Genen eine deutliche Ähnlichkeit zeigen. In jüngsten Arbeiten konnten jedoch für die Genprodukte von BRCA 1 und 2 zwei funktionelle Verwandtschaften aufgezeigt werden.
Die eine der beiden Verwandtschaften bezieht sich auf die DNS-Reparaturfunktion. Beide gebildeten Proteine können an ein Protein namens RAD51 binden, das an der Reparatur von Doppelstrangbrüchen der DNS beteiligt ist. Die entstehende Wechselwirkung zwischen RAD51 und BRCA 1 oder BRCA 2 scheint diese Reparaturfunktion zu unterstützen.
Die andere funktionelle Verwandtschaft von BRCA 1 und 2 bezieht sich auf ihre Regulationseigenschaften. Auf beiden Genprodukten konnten transkriptionsaktivierende Regionen nachgewiesen werden. Diese so genannten Transkriptionsfaktoren sind Proteine, die positiv oder negativ regulierend auf die Transkription eines oder mehrerer Gene einwirken können. Untersuchungen haben gezeigt, dass zum Beispiel Proteine des BRCA 1-Gens vermutlich auf die Zellteilung Einfluss haben, denn in vitro wirkt sich eine zelluläre Überexpression drosselnd auf die Zellteilung [Holinski-Feder 1998 & Schernek 1999]. Bei Mammakarzinom- patientinnen konnten in beiden Genen Mutationen, die zu einem Funktionsverlust führen, in den transkriptionsaktivierenden Bereichen nachgewiesen werden. In welchem Umfang diese Ausfälle an der Tumorentstehung beteiligt sind, ist noch nicht geklärt.
Auch liegen bisher nur wenige Daten über histopathologische Merkmale und Prognosen von BRCA 1- und BRCA 2-assoziierten Karzinomen vor. Eine Studie des „International Cancer Linkage Consortiums“ fand in der Gruppe der BRCA 1- Mutationsträger häufig medulläre und atypische medulläre Karzinome sowie Tumoren mit histologischem Grad III. Bei den BRCA 2- Mutationsträgerinnen traten hingegen invasiv ductale und invasiv lobuläre Karzinome häufiger auf.
3.5 Weitere genetische Faktoren für das Mammakarzinom
In einer kürzlich durchgeführten genetischen Analyse von Mammakarzinomfamilien mit wenigstens 4 Fällen ergab, dass etwa 16 % weder dem BRCA 1 noch dem BRCA2 Gen zugeordnet werden können. Die Daten weisen darauf hin, dass weitere genetische Prädispositionen existieren müssen (BRCA X) [Schernek 1999]. Einige davon hat man bereits entschlüsselt.
Das AT-Gen [Hampl 1997]
Das AT-Gen, das Gen für Ataxia telangiectasia, ist auf dem Chromosom 11q22-23 lokalisiert und 1995 entschlüsselt worden. Seine Länge erstreckt sich über 170 kb und beinhaltet 65 kodierende Exons mit 9168 Nukleotiden.
In Verbindung mit der seltenen autosomal rezessiv vererbten Erkrankung Ataxia telangiectasia treten homozygote Keimbahnmutationen auf. Die Anzahl heterozygoter Genträgerinnen in der Bevölkerung wird auf 1 % geschätzt und ist mit einem 5-fach erhöhten Mammakarzinomrisiko assoziiert. Weiterhin ergibt sich eine allgemeine Krebsdisposition, die sich auf unterschiedliche Tumoren beziehen kann, und eine erhöhte Radiosensitivität normaler Gewebe gegen ionisierende Strahlen. Vermutlich sind die Keimbahnmutationen des AT-Gens für bis zu 8 % aller
Mammakarzinome bei Patientinnen unter 40 Jahren verantwortlich.
Das p53-Tumorsuppressorgen [Hampl 1997 & Schernek 1999]
Das p53-Gen (teils auch als TP53 bezeichnet) ist wie BRCA 1 und 2 ebenfalls ein Tumorsuppressorgen. Es sitzt auf dem langen Arm des Chromosoms 17 (17q13), und bestehenden Keimbahnmutationen werden ebenfalls Mammakarzinomdisponierende Funktionen zugeschrieben. Diese wurden bei Frauen im Rahmen der seltenen Li- Fraumeni-Erkrankung beschrieben, bei der die Betroffenen neben Mamma- karzinomen im frühen Alter auch Hirntumoren und verschiedene Sarkome entwickeln. Nebennierentumoren und Leukämien wurden ebenfalls beobachtet. Im Gegensatz zu BRCA 1 und BRCA 2 werden p53-Mutationen in mehr als 50 % der sporadischen Brustkrebserkrankungen und anderen Tumoren gefunden. Das weist darauf hin, dass dieses Gen bei der Progression, aber auch der Disposition dieser Tumoren eine wichtige Rolle spielt. Insgesamt kommen p53 Keimbahnmutationen aber bei weniger als 1 % aller Mammakarzinome vor.
Andere genetische Faktoren
Auch bei anderen erblichen Syndromen wird ein gehäuftes Auftreten von Mammakarzinomen beobachtet. Zum Beispiel führen beim Reifensteinsyndrom X-chromosomal gekoppelte Androgenrezeptoren zu Brustkrebs bei Männern. Bisher wurde in der Literatur aber lediglich von 3 Fällen berichtet [Hampl 1997]. Beim Cowden-Syndrom und dem Puetz-Jeghers-Syndrom wird eine ähnliche Häufung beobachtet.
Für die meisten dieser Syndrome sind Mutationen in disponierenden Genen nachgewiesen worden, die wahrscheinlich eine nur geringe Penetranz entwickeln, deren Bedeutung für das Mammakarzinom aber noch ungeklärt ist [Schernek 1999]. Eine Reihe von Untersuchungen zeigt, dass die Ausprägung eines Tumorphänotyps durch Gene mit geringer Penetranz und spezifischen genetischen Polymorphismen modifiziert werden kann.
Zu Letzteren zählen unter anderem die Gene Cytochrom P450, 1A1, Glutathion-S- Transferase-M1 und HRAS 1, auf das hier näher eingegangen werden soll. Variationen im Protoonkogen HRAS 1 bilden wie beschrieben ebenfalls eine 27
Prädisposition.
HRSA 1 ist eng mit einem Minisatellitenlokus gekoppelt, in dem bestimmte Allele mit verschiedenen Krebsformen assoziiert sind, unter anderem auch mit dem Mammakarzinom. Das relative Risiko von Trägerinnen dieses seltenen Allels beträgt ca. 1,7. Schätzungen besagen, dass etwa einer von elf Fällen (9 %) in der Gesamtpopulation von diesem seltenen HRAS 1 Allel hervorgerufen werden könnte. Außerdem haben Patientinnen, die dieses Allel tragen, ein zweifach höheres Ovarialkarzinomrisiko. Das ist das erste Beispiel für die Beeinflussung der Penetranz einer vererbten Genmutation durch einen modifizierenden Faktor [Hampl 1997].
Kopplungsuntersuchungen machen auch den Östrogenrezeptor zu einem weiteren Kandidaten für die Prädisposition zu Mammakarzinomen. Dieses Gen für den menschlichen Östrogenrezeptor liegt auf Chromosom Nr. 6 und kodiert für ein Protein, das aus 595 Aminosäuren besteht. Vor allem in Familien mit spät auftretendem familiären Mammakarzinom wurde dieser Östrogenrezeptor als mögliche Ursache isoliert [Hampl 1997].
Außerdem sind multiple exogene Faktoren für die Ausprägung eines Tumorphänotyps verantwortlich, die allerdings nicht hereditären Charakters sind.
Zusammenfassend sind alle hereditären Syndrome und deren Mammakarzinom disponierenden Gene in Tabelle 2 dargestellt:
Tabelle 2:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Schernek 1999
3.6 Risikoeinschätzung bei Mutationsträgerinnen [Schernek 1999 ]
Bei der Berechnung des Erkrankungsrisikos für betroffene Familienmitglieder, die BRCA 1-oder BRCA 2-Mutationsträgerinnen sind, werden zahlreiche Faktoren berücksichtigt wie zum Beispiel die Zahl der betroffenen Familienmitglieder, der Verwandtschaftsgrad, das Alter bei der Erkrankung, Bilateralität, das Auftreten anderer Tumoren, aber auch hormonelle Einflüsse und Umwelteinflüsse. Daraus können ungefähre Risiken berechnet werden, die mit dem Auftreten von BRCA 1- und 2-Mutationen einhergehen.
Das geschätzte Risiko einer Patientin mit einer Keimbahnmutation im BRCA 1 Gen, an Brustkrebs zu erkranken, beträgt bis zum Alter von 50 Jahren 51 % [Hampl 1997], bis zum Alter von 70 Jahren 85 %. Auch familiär gehäuft auftretende Ovarialkarzinome sind auf eine Mutation im BRCA 1 zurückzuführen. Hier beträgt das kumulative Risiko einer Erkrankung im Alter von 50 Jahren 23 % [Hampl 1997] und im Alter von 70 Jahren 45 %. Im Gegensatz zur Gesamtbevölkerung, die mit ca.
10 % an Mamma- und ca. 1 % an Ovarialkarzinome erkrankt, ist das eine deutliche Risikosteigerung. Außerdem erleiden BRCA 1-Mutationsträgerinnen viermal häufiger einen colorektalen Tumor, und männliche Betroffene haben ein dreifach erhöhtes Risiko für Prostatakarzinome gegenüber Nichtbetroffenen. Insgesamt gesehen wird das Risiko für Zweitkarzinome bis zum 60. Lebensjahr auf 64 % geschätzt und ist damit ebenfalls gegenüber der Gesamtbevölkerung deutlich erhöht. Die Risiken für BRCA 2-Mutationsträgerinnen gestalten sich ein wenig anders. Nach Statistiken des „International Breast Cancer Linkage Consortiums“ liegt das Gesamtrisiko für das Auftreten eines Mammakarzinoms bis zum 70. Lebensjahr bei 70 %. Das ist dem Risiko für BRCA 1 Träger damit relativ ähnlich. Die Wahrscheinlichkeit, an einem Ovarialkarzinom zu erkranken, liegt aber nur bei 15 - 20 % und ist damit deutlich unter dem Niveau des Risikos bei BRCA 1- Mutationen. Das Risiko für männliche Mutationsträger, an einem Mammakarzinom zu erkranken, liegt bei 5 %, was wiederum etwas höher ist als bei BRCA 1- Betroffenen und ca. 200-fach höher als in der Gesamtbevölkerung. Auch bei BRCA 2 gibt es eine Überrepräsentation für andere Tumoren wie zum Beispiel für Prostatakarzinome, Lymphome und Melanome. Insbesondere bei Pankreas- und hepatozellulären Karzinomen wurden BRCA 2-Mutationen nachgewiesen. Diese und andere Untersuchungen haben gezeigt, dass BRCA 1- und BRCA 2- assoziierte Tumoren unterschiedliche biologisch-pathologische und klinische Eigenschaften haben, teilweise auch im Vergleich zu sporadischen Mammakarzinomen. Krankheitsverlauf und Prognose unterscheiden sich aber dennoch nicht wesentlich voneinander [Schmutzler 1998].
Nach Schernek 1999 sollten die Risiko-Zahlen allerdings mit Vorsicht zu genießen sein.
Zitat: „Bei der Bewertung der Risikozahlen-Angaben muss berücksichtigt werden, dass die Daten auf Untersuchungen aus Hochrisikofamilien basieren und daher möglicherweise überschätzt werden. Erste Studien an Nichtrisikofamilien ergaben dann auch, dass die oben genannten Risikozahlen relativiert werden müssen. Sie geben ein geschätztes Risiko von ca. 56 % für BRCA 1/2-Mutationsträgerinnen an, bis zum 70. Lebensjahr an MC zu erkranken. Diese Zahlen verdeutlichen, wie vorsichtig und differenziert damit, insbesondere im Hinblick auf einen BRCA 1/2- Gentest, umgegangen werden muss.“
Weiterhin muss auch bedacht werden, dass die Risikozahlen lediglich eine geschätzte Verallgemeinerung aller bisher beschriebenen Fälle sind. Schmutzler (1998) schreibt dazu, dass selbst gleiche Mutationen nicht dieselben Auswirkungen haben müssen. Hereditäre Tumorerkrankungen können im Einzelfall eine Variabilität des Manifestationsalters, der Penetranz sowie der Organspezifität zeigen. In einer Familie kann zum Beispiel eine Mutationsträgerin für Mamma- und Ovarialkarzinome früh an Brustkrebs erkranken, ihre Schwester einen Ovarialtumor entwickeln, doch die Mutter, bei der ebenfalls dieselbe Mutation festgestellt wurde, bleibt gesund. Das verdeutlicht sehr gut, dass weiteren modifizierenden Faktoren wie anderen Genen, Lebensgewohnheiten etc. maßgebliche Bedeutung zukommen muss.
3.7 Mutationsnachweis / Gentest [Schernek 1999]
Die Entschlüsselung der BRCA 1- und BRCA 2-Gensequenzen war notwendig, um die Voraussetzungen für eine präsymptomatische Mutationsanalyse zu schaffen. Diese Umstände haben ein weltweites wissenschaftliches, aber auch kommerzielles Interesse geschaffen, einen geeigneten Gentest zu etablieren. Diesem Gentest für BRCA 1 und 2 stehen aber noch zahlreiche ungelöste Probleme entgegen, die einen Einsatz als Routinemethode bzw. Screeningverfahren bisher verhindert haben.
3.7.1 Probleme
Ganz abgesehen von der Tatsache, dass es inzwischen viele verschiedene Methoden zur genetischen Testung gibt, deren Vor- und Nachteile im nächsten Kapitel abgehandelt werden, sind es vor allem grundsätzliche und allgemeine Probleme, die in den unterschiedlichen Bereichen auftauchen.
Nach wie vor existieren die bereits erwähnten Unsicherheiten bei der Risiko- abschätzung und bei der Interpretation der Mutationsdaten und Sequenzvarianten unbekannter Signifikanz sowie ihrer Assoziation mit anderen Tumortypen. Ein weiterer Streitpunkt ist die Notwendigkeit methodischer Entwicklungen zum Mutationsnachweis und die umfassenden Untersuchungen über Genotyp-Phänotyp- Korrelation. Weiter bestehen Unklarheiten über die Entwicklung und Anwendung geeigneter Beratungskonzepte für die Betroffenen, die Akzeptanz einer genetischen Beratung und vor allem der Testung in der Bevölkerung sowie der psychischen Belastung Betroffener. Nicht zuletzt gibt es noch offene Fragen im Hinblick auf die Entwicklung von Konzepten zur Früherkennung, Prophylaxe und Therapie des hereditären Mammakarzinoms. Ein Gentest für BRCA 1 und BRCA 2 sollte daher nach Expertenmeinung vorerst nur im Rahmen interdisziplinärer, multizentrischer wissenschaftlicher Studien laufen [Schernek 1999].
Nach Hampl (1997) sollte die Genanalyse ebenfalls nur an einem klar definierten Risikokollektiv nach spezifisch erarbeiteten Richtlinien und im Rahmen gut dokumentierter Studien an bestimmten Zentren durchgeführt werden. Sie sollte sich auf diejenigen Frauen konzentrieren, in deren Familie mit großer Wahrscheinlichkeit zum Beispiel eine BRCA 1-Mutation vorkommt. Die Auswahl bei manifest erkrankten Personen sollte nach den folgenden Kriterien erfolgen:
- Auftreten der Brust-/Ovarialkarzinomerkrankung vor dem 50. Lebensjahr und bei mindestens einer weiteren Verwandten, unabhängig von deren Erkrankungsalter;
- Frauen über 50 Jahre mit einer Verwandten 1. oder 2. Grades, die unter 50 an Brust- oder Eierstockkrebs erkrankt ist und
- Frauen mit mehr als einem Primärtumor.
Zur Gruppe der Risikopatientinnen bei den Nichtbetroffenen zählen laut Definition alle Patientinnen über 18 Jahre, die eine Verwandte mit nachgewiesener BRCA 1- Mutation haben. Letztlich gehört zu den Voraussetzungen für eine genetische Testung nicht nur die Erhebung einer Familienanamnese zur Einordnung in ein Risikokollektiv, sondern auch das Vorliegen einer schriftlichen Einwilligung und die Nichtdirektivität und Freiwilligkeit der Untersuchung unter Berücksichtigung des Datenschutzes.
Ein Gentest, der als anerkannte Screeningmethode eingeführt werden soll, muss möglichst schnell, sensitiv, kostengünstig und nutzerfreundlich sein. Bisher sind die technischen Anforderungen an einen BRCA 1- und 2-Mutationsnachweis sehr anspruchsvoll, kosten- und arbeitsintensiv. Das liegt unter anderem daran, dass beide Gene sehr groß sind und die bisher nachgewiesenen Mutationen sich über die gesamte kodierende Sequenz erstrecken können [Schernek].
Ein geeigneter Gentest für BRCA 1 ist unter anderem auch aus folgenden Gründen noch nicht verfügbar [Backe 1996]:
- Es gibt keine weit verbreiteten Mutationen, nach denen man suchen könnte. 32 Direkte Mutationsnachweise bleiben auf Familienmitglieder von bereits erkrankten Personen beschränkt, bei denen eine bestimmte Mutation identifiziert und charakterisiert werden konnte.
- Es ist noch nicht möglich, harmlose Polymorphismen von Brustkrebs-relevanten Mutationen abzugrenzen.
- Die Häufigkeit von Neumutationen ist zur Zeit nicht abschätzbar.
- Die klinische Bedeutung einer individuellen Mutation hinsichtlich der Disposition zu Brust- oder Ovarialkarzinomen ist noch nicht evaluiert.
Außerdem besteht wie schon beschrieben keine Einigkeit darüber, welche Konsequenzen aus dem Nachweis oder Ausschluss einer Mutation in einer Brustkrebsfamilie zu ziehen sind. Welche therapeutische Relevanz hat ein positiver Mutationsnachweis für eine asymptomatische Patientin aus einer Brustkrebsfamilie? Derzeit realisierbare Konzepte beginnen bei der regelmäßigen lebenslangen Kontrolle, mit der schon in jungen Jahren angefangen werden sollte. Sie setzt sich zusammen aus gründlichem Abtasten beider Mammae, der Mammographie, der Mammasonographie, der Kontrolle der Tumormarker und der Vaginalsonographie zur Beurteilung der Ovarien. Weiterhin ist eine präventive antihormonelle Therapie mit Tamoxifen möglich und nicht zuletzt die prophylaktische Mastektomie beiderseits mit Brustaufbau bei Patientinnen mit einem nahezu 90 %igen Brustkrebsrisiko bis zum Lebensende. Letzteres Vorgehen ist sehr radikal und für Betroffene eine schwerwiegende Entscheidung. Aufgrund der fehlenden Erfahrung und der oben genannten Unsicherheiten über klinische Daten (Korrelation von Genotyp und Phänotyp, Zeitpunkt des Auftretens des Karzinoms, Penetranz einer bestimmten Mutation) ist es daher nicht gerechtfertigt.
Eine weitere sehr wichtige Frage darf ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden:
Welche psychischen Konsequenzen hat die Feststellung einer solchen Mutation für die Betroffenen? Da diese Belastungssituation unter gar keinen Umständen unterschätzt werden darf, wird sie in Kapitel 3 dieser Arbeit ausführlich behandelt werden.
Das Ziel einer solchen angestrebten Genstudie ist letztendlich die Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Schaffung einer Basis für die Entscheidung, ob und in welchem Umfang in Zukunft ein Mammakarzinomgentest in der medizinischen Praxis angeboten werden kann [Hampl 1997]. Dabei sollte man auch bedenken, dass ein solches Screening nicht nur mögliche Genträgerinnen identifiziert, die fortan einer starken psychischen Belastung ausgesetzt sind und einem geeigneten Vorsorgeprogramm zugeführt werden sollten. Mit ihm können auch Familienangehörige gefunden werden, die diese Mutationen nicht aufweisen und somit nicht das hohe Risiko für Mamma- und Ovarialkarzinome tragen. Diese psychisch stark entlastende Funktion sollte dementsprechend ausreichend Beachtung finden.
3.7.2 Methoden
Die zur Zeit angewendeten Methoden zum Nachweis von Genmutationen sowie die Sensitivität dieser Methoden bei der BRCA 1/2-Genanalyse sind als Überblick in Tabelle 3 dargestellt.
Die höchste Sensitivität mit mehr als 99 % wird nach wie vor mit der Methode der direkten DNS-Sequenzierung beider Gene erreicht.
Tabelle 3
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Schernek 1999
3.8 Die genetische Beratung
Laut Holinski-Feder (1998) haben Untersuchungen an deutschen Familien ergeben, dass ein Teil der familiär gehäuft auftretenden Mammakarzinome wie bereits beschrieben durch Mutationen im BRCA 1- und BRCA 2-Gen verursacht werden. Mit Hilfe breit angelegter Studien und einer großen Anzahl von Familien sollte es möglich sein, die tatsächliche prozentuale Beteiligung dieser Gene, das Mutationsspektrum und das mit den Mutationen assoziierte klinische Bild zu erfassen, da Neumutationen nur einen geringen Anteil aufweisen. Aus diesen Daten muss versucht werden, differenzierte Risikozahlen und individuelle Vorsorge- und Therapiekonzepte herauszuarbeiten, denn wie bei jeder anderen genetischen Erkrankung sollte auch bei erblichen Tumoren eine ausführliche humangenetische Beratung erfolgen können.
Die Aufklärung des komplexen Zusammenspiels von exogenen und endogenen Faktoren, das letztendlich zur phänotypischen Ausprägung bestimmter Tumoren führt, erfordert eine Zusammenarbeit von molekulargenetischer Grundlagenforschung und Klinik. Dieser Verbund sollte neben den klinischen Einrichtungen die Chirurgie, die humangenetische Beratung, die Psychologie, die klinische Pathologie, das Patientenregister, die Vor- und Nachsorgeeinrichtungen, die molekulare Forschung mit Tumor-, Normalgewebe- und die DNS-Banken und die molekulare Diagnostik miteinander vereinen [Hampl 1997]. Das Ziel dieses Vorhabens ist es unter anderem, die rasch zunehmenden Kenntnisse über BRCA 1- und 2-Dispositionen erstens auf ihre Verwertbarkeit für Beratung und Betreuung Betroffener zu überprüfen und zweitens für die Krebsvorsorge und -früherkennung einzusetzen. In den nächsten Jahren sollen vor allem Häufigkeit und Spektrum von BRCA 1- und 2-Mutationen in Deutschland ermittelt, optimale Testmethoden entwickelt und die Qualitätssicherung gewährleistet sein [Scherneck 1999]. Daraus ergeben sich wiederum die Konzepte zur klinischen Betreuung von Mutationsträgerinnen bzw. Konzepte für die Vorsorgeprogramme. Die Einrichtung mehrerer solcher Zentren in Deutschland ist in Planung und teilweise schon umgesetzt, denn nur hier können derzeit offene Fragen wie Prävalenz von BRCA 1- und 2-Mutationen, Penetranz bestimmter Mutationen, Genotyp-Phänotyp- Korrelation und Einfluss modifizierender Gene und exogener Faktoren beantwortet werden und in Therapie und Diagnostik umgesetzt werden.
3.8.1 Durchführung
Im Rahmen interdisziplinärer Programme werden ratsuchenden und betroffenen Familienmitgliedern humangenetische, molekularbiologische, klinische und psychotherapeutische Beratung und Betreuung angeboten. Nach Holinski-Feder (1998) zählen zu den wesentlichen Inhalten der Beratung:
- die Abschätzung des Erkrankungsrisikos für nicht betroffene Ratsuchende,
- die Erläuterung eines autosomal-dominanten Erbgangs,
- das Erklären der Vorgehensweise bei einer molekulargenetischen Untersuchung,
- die Aufklärung aller Ratsuchenden über den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse und
- der Ausschluss einer falschen Sicherheit aufgrund eines negativen Testergebnisses.
Eines dieser Zentren, in denen das oben beschriebene Optimalkonzept angestrebt wird, ist in Würzburg ansässig. Ein Team aus humangenetischen Beratern, Gynäkologen und Psychologen führt seit April 1997 eine interdisziplinäre Beratung in Risikofamilien durch. Nach Hofferbert (1998) verläuft eine genetische Beratung hier folgendermaßen:
Die Kontaktaufnahme erfolgt meistens telefonisch durch die Ratsuchende selbst. Dabei werden persönliche Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Krankheitsstatus (betroffen / nicht betroffen) sowie ein kurzer Stammbaum erfragt und erste Informationen über die Beratung und die genetische Testung weitergegeben. Auf Wunsch wird schriftliches Informationsmaterial zugeschickt. Wenn die Ratsuchende eine Beratung wünscht, wird ein Termin vereinbart und schriftlich bestätigt. Mit dieser Einladung wird ein Fragebogen verschickt, der Teil der psychosozialen Verlaufsuntersuchung ist und ausgefüllt zum Gespräch mitgebracht werden sollte. Ein weiterer Fragebogen wird direkt vor der Beratung ausgehändigt. Beide Fragebögen sollen Fragen zur Persönlichkeit, sozialen Einbindung, Vorinformiertheit über die Erkrankung sowie Einschätzung des persönlichen Risikos der Ratsuchenden klären. Außerdem werden Ratsuchende aufgefordert, soweit vorhanden, Arztbriefe und histologische Befunde von erkrankten Personen der Familie mitzubringen. Das eigentliche Gespräch erfolgt dann unter der Moderation des genetischen Beraters, wobei die Aufgabenbereiche wie folgt verteilt sind:
Genetischer Berater:
- Erhebung der Eigenanamnese
- Erstellung eines ausführlichen Stammbaumes
- erste Einschätzung des Risikos, Mutationsträgerin zu sein
- Information über familiären Brustkrebs und die Implikationen der genetischen Testung
Gynäkologe:
- Erhebung der gynäkologischen Anamnese
- Aufklärung über derzeit empfohlene Vorsorgemaßnahmen und deren Einleitung,
- Informationen über Hormonsubstitution bzw. Einnahme hormoneller Kontrazeptiva
- Aufklärung über prophylaktische Operationen
- Information über präventives Verhalten (Sport, Ernährung, Verzicht auf Nikotin)
Psychologe:
- Interventionsbereitschaft während aller Phasen des Gesprächs
- Angebot der psychotherapeutischen Begleitung
- Erläuterung und Weiterführung der psychosozialen Verlaufsstudie
Danach können weitere Sitzungen anberaumt werden, in denen eine psychologische Aufarbeitung und die Entscheidungsfindung erfolgen. Ziel einer solchen Beratung ist einerseits, möglichst genaue Informationen über die Stammbaumsituation der Ratsuchenden zu gewinnen, und andererseits, die Ratsuchenden durch umfassende Aufklärung in den Stand zu versetzen, eine begründete Entscheidung für oder gegen die molekulargenetische Analyse der BRCA 1- und BRCA 2-Gene zu treffen.
Dabei soll den Ratsuchenden sowohl ein Überblick über die Genetik des Mamma- und Ovarialkarzinoms gegeben als auch die Implikationen der genetischen Testung deutlich gemacht werden. Laut Tiefensee (1998) gilt hier als Leitprinzip die Non- Direktivität, d. h. der Berater soll zwar umfassend informieren, aber nicht empfehlen. Es ist allerdings die Frage, ob eine solche Beratung non-direktiv sein kann. Allein die Tatsache, dass der genetische Test angeboten wird, impliziert nach Meinung einiger Experten stillschweigend die Empfehlung einer rationalen Handlungssequenz, nämlich ihn anzunehmen und, im positiven Fall, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Ihrer Ansicht nach wollen oder können viele Ratsuchende die ethische Bürde, die ihnen die Entscheidung auferlegt, nicht alleine tragen, und so suchen sie nach jeder auch noch so indirekten Orientierung.
Nach den bisherigen Erfahrungen wird dieses interdisziplinäre Beratungskonzept gut angenommen. Die Betroffenen fühlen sich gut betreut. Für das Beratungsteam selbst besteht der Vorteil, dass die zugleich durchgeführten Beratungsgespräche eine dynamische Entwicklung erfahren, da die Vertreter der einzelnen Disziplinen voneinander partizipieren und die gesammelten Erfahrungen wiederum in die Beratung einbringen können.
Als mögliche Ursache für eine Nicht-Inanspruchnahme des Tests trotz hohen genetischen Risikos kann eine Kombination aus folgenden Faktoren genannt werden:
- junges Alter einer Ratsuchenden oder Betroffenen
- nur eingeschränktes Vertrauen in ärztliche Früherkennungsmaßnahmen und die Selbstuntersuchung
- der Mangel an therapeutischen Möglichkeiten
Die Entscheidung gegen eine DNS-Testung scheint hier überwiegend durch die Angst vor einem positiven Befund motiviert zu sein.
Andersherum ließen sich als mögliche Ursache für den Wunsch nach einem Test trotz mäßigem bis niedrigem Risiko folgende Faktoren ermitteln:
- junges Alter der Ratsuchenden
- sehr hoch eingeschätztes Erkrankungsrisiko
- ängstlich-depressive Grundstimmung
- wenig Kommunikation mit Familie oder Partner
- wenig Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Fähigkeiten anderer
- dadurch wenig Annahme von Hilfe
- keine Zuversicht, das Schicksal selbst beeinflussen zu können
Die Motivation für die Testung liegt hier wahrscheinlich in der Hoffnung auf einen negativen Befund, der von dem sonst unausweichlichen Schicksalsschlag befreien könnte.
Die Inanspruchnahme des genetischen Tests stimmt aber in den meisten Fällen mit dem kalkulierten genetischen Risiko überein, d. h. die meisten Ratsuchenden aus Hochrisikofamilien entscheiden sich für eine BRCA 1/2-Analyse, während die meisten Ratsuchenden aus Niedrigrisikofamilien keine molekulargenetische Analyse wünschen.
3.8.2 Zielgruppe
Wie bereits erwähnt, sollte jeder Risikoträgerin eine genetische Untersuchung und eine darauf begründete ausreichende Beratung zuteil werden. Die Wahrscheinlichkeit, in einer Familie BRCA 1/2-Mutationen zu finden, hängt ganz entscheidend von der Anzahl der weiblichen Mammakarzinomfälle in der Familie, von zusätzlich vorkommenden Ovarialtumoren sowie vom Auftreten von Mammakarzinomen bei männlichen Familienmitgliedern ab. Da die genetische Untersuchung sehr aufwändig ist, wurden Kriterien zur Auswahl von Familien (-mitgliedern) geschaffen, um den Patientenkreis besser eingrenzen zu können.
Die folgenden Abbildungen aus Scherneck 1999 sollen das etwas verdeutlichen. Abbildung 1 zeigt die Kriterien für eine genetische Untersuchung bei erblich belasteten Familien, Abbildung 2 die Empfehlungen für Frauen mit hohem Risiko für Mamma- oder Ovarialkarzinom.
Ähnliche Indikationen liegen auch den BRCA 1- und 2-Genuntersuchungen zugrunde, die seit 1996 im Rahmen des Förderprogramms der Deutschen Krebshilfe in 12 regionalen Zentren in Deutschland durchgeführt werden. In den nächsten Jahren sollen Aufschlüsse über die Akzeptanz einer genetischen Testung und Beratung untersucht werden und zu Konzepten zur Prophylaxe, Früherkennung und
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Therapie des familiären Mamma- bzw. Ovarialkarzinoms entwickelt werden [Hofferbert 1998].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4 Psychosoziale Aspekte
Die oben genannte genetische Beratung dient aber nicht nur der rationalen Entscheidungsfindung für oder gegen einen Gen-Test, sie zieht auch eine ganze Reihe psychischer und sozialer Folgen für die Betroffene nach sich, die in einer solchen Beratung unbedingt Beachtung finden müssen. Angesichts der psychosozialen Tragweite eines positiven oder negativen Befundes sollte die Entwicklung und Durchführung prädiktiver Gendiagnostik nur im Rahmen von Forschungsprogrammen erfolgen [Groeben 1999]. Bei der Literatursuche konnte man allerdings feststellen, dass über die psychischen und sozialen Auswirkungen genetischer Tests bei Krebserkrankungen erst wenige Forschungsarbeiten vorliegen, die diesem Teil der Beratung zu Gute kommen könnten. Das größte Problem in den bisher vorliegenden Studien waren die komplexen Verarbeitungsprozesse, die es stark erschweren, den individuellen Nutzen zu beurteilen. Da selbst der Ausgang der genetischen Tests keine sicheren Aussagen über das Risiko ermöglicht, stellt sich das Problem der Vermittlung dieser Wahrscheinlichkeitsinformation sowie deren Verarbeitung in besonderem Maße.
Zudem sollte sichergestellt werden, dass Mutationsträger nicht von Lebensversicherungen und Krankenkassen oder vom Arbeitgeber benachteiligt werden [Müller 1995].
4.1 Die genetische Beratung, ein psychosoziales Gefüge
Krebs ist bedrohlich und verursacht bei den Betroffenen psychologischen Stress. Brust- und Ovarialkarzinome sind besonders gefährlich für das Selbstbewusstsein und das körperliche Image der Frau, denn sie verbinden diese Teile ihres Körpers mit Fruchtbarkeit, Weiblichkeit und Sexualität. Zudem ist der erbliche Brust- und Ovarialkrebs mit einer Menge anderer bedrohlicher Unsicherheiten verbunden:
- dem Risiko, Mutationsträger zu sein
- der unvollständigen Penetranz unter den Mutationsträgern
- dem Einfluss anderer Gene und von Umweltfaktoren und biologischen Faktoren, wie Hormonen und Ernährung
- der unsicheren Effizienz von Früherkennungsmethoden, prophylaktischer Chirurgie oder Chemo-Prävention
- der Frage der Behandlung und Prognose bei hereditärem Karzinom. (Decruyenaere 2000/B)
Vor allem die zweite Sitzung der genetischen Beratung ist auf die psychische Ebene ausgerichtet. Die Hauptanliegen hier sind die Bereitstellung emotionaler Unterstützung, die Erleichterung des Entscheidungsprozesses und die Diskussion über die familiäre Kommunikation. Sie beinhaltet eine Evaluation zu den kognitiven und emotionalen Prozessen der Patientin und ihren Ressourcen und Strategien für die Verarbeitung der gegebenen Information (Decruyenaere. 2000/B).
4.1.1 Die kognitive Verarbeitung der Information (Decruyenaere 2000/B)
Das individuelle Verhalten, in Bezug auf Gesundheit in einem bedrohlichen genetischen Kontext beruht auf einer Interaktion zwischen dem Wissen der Patientin über die Genetik und der Art, wie die negative Information verarbeitet wird. Verarbeitung ist ein dynamischer Prozess, der sich mit der Zeit wandelt, abhängig von der kognitiven und der subjektiv-emotionalen Wahrnehmung, der belastenden Situation und den Verarbeitungsstrategien und -ressourcen. Die individuellen Erfahrungen, Meinungen, Ziele, Werte und die Kultur beeinflussen diesen Prozess. Basierend auf der gegebenen Information und den persönlichen Erfahrungen und Ansichten bildet die Patientin ein kognitives Bild von der Krankheit. Bei dieser kognitiven Vorstellung vom hereditären Mamma- und Ovarialkarzinom existieren beachtliche Unterschiede zwischen den Betroffenen. Studien haben gezeigt, dass einige Ratsuchende die Informationen aus der genetischen Beratung nicht erfassen, geschweige denn verstehen oder sich daran erinnern können
(Lloyd, Watson, Evans zitiert in Decruyenaere 2000/B). Daher ist es wichtig zu prüfen, wie die Betroffene die Informationen interpretiert hat (geschätztes Risiko, empfundene Schwere der Erkrankung, Vorteile und Grenzen des genetischen Tests etc.), denn Testpatientinnen sollten vollständig beurteilen können, was die Ergebnisse des genetischen Tests für sie bedeuten, bevor er durchgeführt wird (Tiefensee 1998).
Eine Erklärung für das schlechte Verständnis und/oder Gedächtnis für die Informationen, alternativen Verläufe und Optionen ist, dass die genetischen Zusammenhänge sehr komplex sind und sich nur schwer erklären bzw. verstehen lassen. Die Wissensvermittlung ist hier wie jede Aufklärung und Instruktion in der Medizin eine Sache des kommunikativen Geschicks. Der Arzt muss die in seiner Fachsprache präsentierten Fakten in eine verständliche Laiensprache übersetzen, in didaktisch sinnvolle Einheiten verpacken, eingängige Metaphern und Formulierungen wählen und sich des erreichten Verständnisses versichern (Tiefensee 1998). Auf der Grundlage der sachlichen Information soll das spezifische Risiko der Ratsuchenden vermittelt werden. Die intellektuelle Situation des Patienten, sein Vorwissen und die Erfahrungen spielen dabei eine wichtige Rolle und sollten in den Kommunikationsprozess mit eingerechnet werden. Auch haben die sachlichen Informationen des Beraters für die Betroffenen eine emotionale Bedeutung und werden daher häufig falsch interpretiert. Auch wenn Risiken verständlich und objektiv richtig wiedergegeben werden, können sie dennoch subjektiv verschieden gewichtet werden. Bei den Genen BRCA 1 und 2 gibt es (im Gegensatz zu Chorea Huntington) keine sicheren Aussagen, sondern lediglich eine Wahrscheinlichkeitsaussage über einen Ausbruch der Erkrankung. Je nach persönlicher Beziehung und individueller Erfahrung mit Krebserkrankungen kann die Relevanz solcher Informationen sehr unterschiedlich gewertet werden (Tiefensee 1998). Ein Merkblatt mit Schlüsselinformationen, welches zu Hause gelesen werden kann, verbessert signifikant das Verständnis und die Erinnerung an den Gesprächsstoff.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Art und Weise der Risikopräsentation. Sie kann den Informationsprozess und die unterschwellige Entscheidungsfindung entscheidend beeinflussen. Das Risiko kann unterschiedlich präsentiert werden: als Prozentzahl oder Proportion, numerisch oder verbal, als absolutes oder relatives Risiko und unter Gewichtung der positiven oder negativen Konsequenzen. Auch der sprachliche Rahmen ist entscheidend, denn es macht schon einen Unterschied, ob vom Risiko einer Erkrankung oder der Chance des Gesundbleibens gesprochen wird (Tiefensee 1998). Werden während des Beratungsgespräches mehrere Arten der Risikodarstellung gewählt, können die Effekte der einzelnen Präsentationen relativiert werden.
Zudem gibt es gut bekannte kognitive Neigungen, die ebenfalls eine Rolle im Informationsprozess spielen. Je leichter ein Ereignis beispielsweise vorzustellen und zu behalten ist, desto wahrscheinlicher ist sein Eintreffen für die Betroffene. Hat die Ratsuchende aus einer BRCA 1/2-Familie zum Beispiel eine Schwester mit diagnostiziertem Mammakarzinom, könnte es sein, dass sie ihr Risiko überschätzt, auch ein Genträger zu sein. Missverständnisse und Verwirrung sollten in der Beratung dann diskutiert und korrigiert werden.
4.1.2 Kognitive Auffassungen und Gesundheitsverhalten
(Decruyenaere 2000/A)
Kognitive Krankheitseinsichten dienen als Auslöser für die Entwicklung von Maßnahmen zur Krankheitsbewältigung (problemorientierte Verarbeitung). Die empirischen Belege für die direkte Rolle des Ursachendenkens in der Entwicklung von Gesundheitsverhalten sind im Allgemeinen nicht groß. Der Einfluss basiert offensichtlich auf einem großen Ausmaß miteinander verknüpfter Variablen, einschließlich der Selbsteinschätzung und den Auffassungen zur Anfälligkeit bzw. Kontrollierbarkeit der Krankheit. Es sind aber noch weitere Studien notwendig, um die direkte und indirekte Rolle des Ursachendenkens im genetischen Kontext abzuklären.
Die Auffassung über die Schwere der Erkrankung zeigt im Allgemeinen eine normale bis gar keine Verbindung zum Gesundheitsverhalten. Ein Problem hierbei ist, dass einige Studien nicht unterscheiden zwischen der empfundenen Schwere der Erkrankung und dem krankheitsbedingten Stress. Die Wertigkeit der empfundenen Stärke bei der Erklärung des Gesundheitsverhaltens in genetischen Situationen muss ebenfalls noch weiter untersucht werden.
Im Gegensatz dazu haben Meinungen zur Anfälligkeit einen enormen Einfluss auf das Gesundheitsverhalten. Viele verschiedene Studien belegen, dass die empfundene Anfälligkeit in einem signifikanten Verhältnis zur Durchführung des BRCA 1-Tests bei direkten Verwandten von Brustkrebs-Patientinnen steht. Ebenso steht sie in Verbindung mit dem Durchführen regelmäßiger Mammographien, klinischer Vorsorge und Selbstuntersuchungen. Ebenso wird deutlich, dass die Auffassung von einer guten Kontrollierbarkeit der Erkrankung eher mit problemorientierten Strategien und einer besseren Anpassung einhergeht, weniger mit emotional beeinflussten Strategien wie Verdrängung, Wunschdenken und Scham.
4.1.3 Emotionale Verarbeitung (Decruyenaere 2000/B)
Die Wichtigkeit emotionaler Unterstützung ist bereits in zahlreichen Studien nachgewiesen worden. Das Aufdecken genetischer Prädispositionen wie für den erblichen Brust- und Ovarialkrebs können starke Emotionen, wie Angst, Depressionen, Ärger und Schuldgefühle hervorrufen. In den untersuchten Familien, in denen eine BRCA-Mutation vorkam, wurden nach Tiefensee (1998) hinsichtlich bestimmter psycho-logischer Merkmale folgende Beobachtungen gemacht: Diejenigen, welche die gute Nachricht erhielten, nicht Genträgerin zu sein, veränderten sich positiv in allen Bereichen. Die Trägerinnen des Gens unterschieden sich kaum von denen, die den Test abgelehnt hatten. Die schlechte Nachricht, Trägerin der Mutation zu sein, scheint sich also in dieser Untersuchung nicht abträglicher auf die Psyche auszuwirken als die Ungewissheit darüber, wie hoch das Risiko ist. Dabei muss man allerdings bedenken, dass die Entscheidung für oder gegen den Test schon eine Selbstselektion darstellt. Vermutlich lassen gerade diejenigen, die zu Recht davon ausgehen, dass sie mit einem positiven Befund psychisch umgehen können, den Test durchführen. Einige Untersuchungen haben gezeigt, dass direkte Verwandte von Mammakarzinom-Patientinnen aufgrund der Brustkrebs-Angst Beeinträchtigungen in ihrer täglichen Routine erfahren und unter Schlafstörungen leiden können (Taylor, Rippetoe, Conway, Evers-Kiebooms zitiert in Decruyenaere 2000/A). Das Wissen um die persönliche genetische Anfälligkeit für das hereditäre Mammakarzinom wird als lästig empfunden und die Patientinnen entwickeln unterschiedliche Verarbeitungsstrategien, um diese Gefühle zu bewältigen. (Decruyenaere 1999) Diejenigen, die am meisten Interesse am Gentest hatten, waren häufig auch die ängstlichsten und besorgtesten Patientinnen. Oft stehen Belastung und Angst vor dem Krebs in enger Verbindung zu dem Alter der Patientin, dem Alter der Mutter bei Diagnosestellung bzw. ihrem Sterbealter. In selbem Maße spielen die Anzahl der erkrankten und/oder verstorbenen Verwandten und deren Alter bei der Diagnose eine Rolle. Auch die empfundene Schwere und der Verlauf der Erkrankung bei diesen Familienmitgliedern und der zeitliche Abstand zu neu gestellten Diagnosen bzw. Todesfällen in der Familie lassen eine Verbindung zur Krebsangst erkennen. Besonders Töchter von Brustkrebs-Patientinnen, die im Kindesalter oder in der Pubertät von der Diagnose der Mutter erfahren, neigen zu nachteiligen emotionalen Reaktionen. In dieser Phase der Persönlichkeitsausprägung und sexueller Entwicklung ist die Identifikation mit der Mutter und dem weiblichen Körper von äußerster Wichtigkeit. Brust- und Ovarialkarzinome der Mutter, kombiniert mit der eigenen genetischen Anfälligkeit, stellen eine Gefahr für das Bild vom eigenen Körper, die emotionale Entwicklung, das Selbstbewusstsein und die Identität der Tochter dar.
Weitere Untersuchungen zeigen laut Tiefensee (1998), dass auch die Diskrepanz zwischen dem erwarteten und dem tatsächlichen Testergebnis Anpassungsprobleme hervorbringen kann, selbst wenn das Ergebnis negativ ist und die Patientin „aufatmen“ könnte (Decruyenaere zitiert in Tiefensee 1998). Das wird verständlich, wenn die untersuchten Patientinnen zum Beispiel ihr Leben darauf abgestimmt haben, dass sie Genträgerin sein könnten, indem sie auf eine Partnerschaft und Kinder verzichteten. Diese Betroffenen blicken dann voller Wut auf die verschenkten Jahre voller unbegründeter Angst zurück. Im Gegensatz dazu gibt es auch ähnlich überraschende Beobachtungen bei Betroffenen, die trotz positiven Befundes Erleichterung fanden, weil sie beispielsweise ihr persönliches Risiko vor der Beratung aufgrund ihrer Familienanamnese zu hoch einschätzten.
4.1.4 Meinungen zum Grund der Erkrankung (Decruyenaere. 2000/A)
Die Begründung für die Entstehung des Tumors prägen die ersten Vorstellungen der Patientin über die Erkrankung. In einigen Studien von 1984 wurden von den untersuchten Frauen folgende Erklärungen für ihren Krebs genannt: Stress (41 %), ein spezifisches Karzinogen (32 %), Vererbung generell (26 %), Ernährung (17 %) und traumatische Belastung der Brust (10 %). Laut einer Studie aus dem Jahr 1998 wurden von den betroffenen Frauen Stress, Vererbung und Umwelt als bedeutender angesehen als Rauchen, Alkohol und Ernährung (Julian-Reynier zitiert in Decruyenaere 2000/A). Diese Erklärungen für Brust- oder Ovarialtumoren können entstehen aus allgemeiner Information über mögliche krebsauslösende Faktoren, aus Erfahrungen mit Familienmitgliedern, die an Krebs erkrankt sind, oder aus Informationen, die von einem Mediziner oder Familienangehörigen gegeben wurden.
Untersuchungen zur Vorstellung von Laien über Gene und Vererbung erbrachten einige interessante Ergebnisse. Zunächst haben die Befragten die ganzheitliche Vorstellung, dass Gene in Gruppen vererbt werden, so dass Familienmitglieder, die dem Erkrankten körperlich oder charakterlich ähnlich sind, auch mit größerer Wahrscheinlichkeit dieselbe Krankheit entwickeln. Weiterhin wird die Vererbung von Eltern auf Kinder überbewertet, die genetische Verwandtschaft mit Geschwistern, Onkeln und Tanten jedoch unterschätzt. Untersuchungen zeigten, dass die empfundene genetische Übereinstimmung mit dem erkrankten Familienmitglied eher eine Sache der sozialen Verbundenheit als der genetischen Verwandtschaft ist. Nicht zuletzt glauben viele Familien, dass diese „Krankheit des weiblichen Geschlechts“ nur über die Linie der Mutter-Tochter-Vererbung weitergegeben wird, und vernachlässigen daher die väterliche Vererbungslinie. Diese Phänomene haben eine wichtige Bedeutung für die familiäre Kommunikation über den hereditären Brustkrebs und sind oft der Grund dafür, dass Betroffene ihre Partner nicht mit zur Beratung bringen.
Eine andere Beobachtung ist, dass die meisten Krankheiten als multifaktoriell eingestuft werden. Obwohl die Vererbung des Gens als wichtiger Ursachenfaktor angesehen ist, wird sie nicht allein für das Auftreten der Erkrankung verantwortlich gemacht. Hier wird dem Lebensstil noch eine große Bedeutung beigemessen. Das Einbeziehen dieser nicht-genetischen Faktoren könnte immer wieder auftauchen aufgrund des fehlenden Verständnisses der Ratsuchenden für Gene und Vererbung. Vielleicht ist es auch ein Versuch der möglicherweise Betroffenen, die Krankheit als weniger vorbestimmt zu betrachten, um wieder mehr Kontrolle über ihr Schicksal erlangen zu können.
Betrachtet man die Begründungsversuche der Betroffenen für das bei ihnen festgestellte erbliche Mamma- und Ovarialkarzinom, erwartet die Wissenschaft, dass die Vererbung einen wichtigen Faktor darstellt. Trotzdem wird die unvollständige Penetranz der BRCA 1/2-Gene und die unbestimmte Rolle der anderen Faktoren (Hormone, Ernährung) die Vorstellung vom Einfluss der Umwelt und des Lebensstils unterstützen.
Decruyenaere et al. vermuten, dass einige Individuen die Rolle der Gene unterschätzen und die der nicht genetischen überbewerten in dem Versuch, das Gefühl der Kontrolle zu steigern und das der Anfälligkeit für die Erkrankung zu mindern.
Die Erklärungen für das Auftreten des Tumors dienen der psychologischen Abwehr ebenso wie dem Versuch, die Krankheitsgeschichte der Familie besser zu verstehen. Diese Funktionen können gute Gründe für das Beibehalten des Laienwissens sein, auch wenn ein Experte widersprüchliche Informationen zum Grund der Erkrankung liefert.
4.1.5 Auffassungen zur Schwere der Erkrankung und Anfälligkeit
(Decruyenaere 2000/A)
Im Falle des erblichen Mamma- und Ovarialkarzinoms ist das Auftreten der Erkrankung in relativ jungem Alter mit einem hohen Risiko verbunden, multifokale, bilaterale Tumoren zu entwickeln. Da es eine genetische Erkrankung ist, wird sie zudem oft als irreversibel, komplex und familienbedingte Brandmarkung empfunden, die auch durch starke negative Emotionen hervorgerufen werden kann. Die Betroffenen handhaben die Gesundheitsgefahr durch emotionsgebundene Verarbeitungsmechanismen, einschließlich der Minimierung des Problems oder der positiven selbst-Evaluation, um Angst und Stress auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Je relevanter die Bedrohung für den Einzelnen wird, desto defensiver werden seine Verarbeitungstaktiken. Daraus ergibt sich die Hypothese, dass die Ernsthaftigkeit der erblichen Erkrankung von Patientinnen weniger empfunden wird als von asymptomatischen Personen mit hohem Risiko und dass der Krebs am gefährlichsten von Betroffenen mit dem geringsten Risiko eingeschätzt wird. Die meisten Untersuchungen basieren auf den Erkenntnissen aus den Reaktionen erkrankter Individuen. Decruyenaere et al. dagegen sind interessiert an den Vorstellungen und dem unterschwelligen präventiven Verhalten von asymptomatischen Ratsuchenden mit einem hohen Erkrankungsrisiko. Als Konsequenz daraus wird das Maß der empfundenen Anfälligkeit für die Erkrankung zu einem entscheidenden Element des Krankheitsbildes des Risikopatienten. Zuerst sollte erwähnt werden, dass die Ratsuchenden auch nach der genetischen Risikoberatung meist wenig Ahnung von den Risikokonstellationen beim familiär erblichen Brust- und Ovarialkrebs haben. Einige Studien haben gezeigt, dass die Genauigkeit der Risikoeinschätzung nach der Beratung zwar zugenommen hatte, zwei Drittel der Frauen aber weiterhin ihr Risiko überschätzten.
Die subjektive Interpretation der Risikoinformation wird sowohl von kognitiven als auch von emotionalen Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel können auffällige und lebhafte Erinnerungen an Erfahrungen mit Krebs in der Familie zu überhöhter Risikoeinschätzung führen. Das liegt an dem sogenannten ‚available heuristic‘, einer kognitiven Neigung, bei der auffällige Ereignisse besser in Erinnerung bleiben und ihr Eintreffen als wahrscheinlicher empfunden wird. Es kann von den Beratern beispielsweise kein verbessertes Risikoverständnis erreicht werden, wenn die Betroffenen große Angst vor dem Krebs haben.
Eine andere wichtige Beobachtung, welche in enger Beziehung zu dem oben genannten Phänomen steht, ist, dass die Risiko-Information in einer persönlichen Art und Weise interpretiert wird. Studien haben gezeigt, dass die Patientinnen nach der Beratung ihr persönliches genetisches Risiko aus ihren Vorstellungen über Vererbung, ihren familiären Erfahrungen mit dem Brustkrebs und ihrem Lebensstil rekonstruieren. Diese persönliche Risikostruktur ist meist weniger bestimmt als die vom Genetiker definierte, welche eine Kombination von genetischen, Verhaltens- und Umweltfaktoren einbezieht.
Es gibt Untersuchungen über das Ausmaß, das der Familiengeschichte beim Berechnen der Gesundheitsanfälligkeit beigemessen wird (Ponder zitiert in Decruyenaere 2000/A). Hier zeigt sich deutlich, dass Frauen eher die Präsenz bzw. das Fehlen von erkrankten Verwandten als relevant für die eigene Risikokonstellation ansehen als Männer. Zudem glauben die Betroffenen, dass ihre eigenen Aktivitäten mit großer Wahrscheinlichkeit zur Senkung ihrer Anfälligkeit beitragen, während Familiengeschichte und Umwelt als steigernder Faktor angesehen werden.
4.1.6 Auffassungen zur Kontrollierbarkeit der Erkrankung
(Decruyenaere 2000/A)
Als Erstes muss man unterscheiden zwischen Kontrollierbarkeit und Prophylaxe. In Bezug auf die Prophylaxe belegen einige Untersuchungen, dass die mögliche Verhinderung der Krankheit durch Vorsorge als geringer angesehen wird, wenn eine genetische Mutation zu Grunde liegt (Senior zitiert in Decruyenaere 2000/A). Bei anderen Studien zur empfundenen Kontrollierbarkeit und Prophylaxe des Mammakarzinoms konnte zwischen der Kontrollierbarkeit der Brustkrebs- Früherkennung und der Kontrollierbarkeit der Heilung unterschieden werden (Welkenhuysen zitiert in Decruyenaere 2000/A). Das erbliche Mammakarzinom wurde grundsätzlich als weniger vermeidbar eingestuft als das nicht-erbliche, wobei es in der Vorstellung der Kontrollierbarkeit keine signifikanten Unterschiede gab.
Die größten individuellen Unterschiede gab es in der empfundenen möglichen Prophylaxe. Wie bereits erwähnt, konstruieren die Betroffenen ein subjektives Ursachengerüst der Erkrankung, einschließlich genetischer und nicht genetischer Faktoren. Diese individuellen Unterschiede im Ursachendenken sind möglicherweise der Grund für die unterschiedlichen Meinungen zur Vorsorgemöglichkeit. Es sind verschiedene kognitive Einstellungen benutzt worden, um das Konzept der Kontrollierbarkeit zu untersuchen. Dabei sind die Überzeugungen zur Kontrollierbarkeit (interne/externe Kontrolle) und der Glaube an die eigene Einwirkungskraft (die Fähigkeit, die notwendigen Maßnahmen durchzuführen) als die wichtigsten und am meisten auftretenden Einstellungen hervorgegangen:
Die Betroffenen fühlen sich möglicherweise verantwortlich für ihre Gesundheit (interner Sitz der Kontrolle), sehen sich aber dennoch nicht in der Lage, die nötigen Maßnahmen vorzunehmen (geringe Selbsteinwirkung). Ebenso kann die Krankheit durch medizinische Wissenschaft überwacht werden (externer Sitz der Kontrolle), aber die Betroffenen haben Zweifel an der Effektivität dieser Wissenschaft. Der individuelle Glaube an die Effektivität, Vor- und Nachteile der DNS-Tests und der Überwachung und Behandlung der Krankheit sind möglicherweise ein wichtiger Aspekt der Empfindungen zur Kontrollierbarkeit der Erkrankung. Diese Auffassungen können sich im Laufe der Zeit durch positive bzw. negative Erfahrungen ändern. Beispielsweise können Frauen nach einem falsch positiven bzw. falsch negativen Befund oder nach der Erkenntnis, dass das Screening nicht zur Senkung ihrer Brustkrebsangst beiträgt, das Vertrauen in die Effektivität des Screeningverfahrens verlieren.
4.1.7 Emotionaler Stress und Gesundheitsverhalten
(Decruyenaere 2000/A + B)
Emotionale Reaktionen werden in erster Linie von konkreten persönlichen Erfahrungen und dem geschätzten Risiko, der bedrohlichen Situation kombiniert mit den kognitiven Überzeugungen und den Verhaltensmaßnahmen hervorgerufen, weniger von mündlichen Erklärungen darüber. Diese Gefühle fördern emotionsgebundene Verarbeitung einschließlich selbst hergeleiteter Einschätzungen, defensivem Pessimismus, Minimierung des Problems oder Verdrängung. Diese Verarbeitungsstrategie kann ein problemorientiertes Denken beeinträchtigen oder auch erleichtern. Sind die Emotionen sehr stark, können sie entscheidende Barrieren im Informationsprozess, der Entscheidungsfindung und dem Vorsorgeverhalten darstellen. Studien belegen, dass die Risikoberatung in einer Gruppe direkter Verwandter von Brustkrebs-Patientinnen kein verbessertes Verständnis hervorbringt, wenn die Betroffenen große Angst vor der Erkrankung haben.
Die Beziehung zwischen emotionaler Situation und Gesundheitsverhalten wird in der Literatur unterschiedlich wiedergegeben. In einigen Studien war die Angst vor dem Karzinom verbunden mit nachlässigem Screeningverhalten (Kash, Lernman zitiert in Decruyenaere 2000/A), während andere belegen, dass die Angst in keiner Beziehung zur Gesundheitsvorsorge steht (Lloyd zitiert in Decruyenaere 2000/A). Wieder andere Forschungsarbeiten beweisen, dass sich die Sorge um die mögliche Erkrankung stimulierend auf das Gesundheitsverhalten auswirkt (McCaul, Lerman z itiert in Decruyenaere 2000/A). Eindeutig war lediglich, dass karzinomspezifische Angst eher mit Gesundheitsverhalten einhergeht als allgemeiner Stress. Diese gegensätzlichen Modelle zeigen die Differenzen in der Natur der Verhaltensmuster, die untersucht werden, Unterschiede im Rahmen der Gesundheitsvorsorge und/oder einfach in den verschiedenen Charakteren. Darüber hinaus sind sie ein Indikator für die Schwierigkeiten bei der Messung der Angst und den Vorstellungen darüber.
Die unterschiedlichen Ergebnisse können zum Teil auch der Art und Weise zugeschrieben werden, wie das Gesundheitsverhalten untersucht wurde. Dabei muss zwischen zwei Gesundheitsverhalten unterschieden werden: Reduzierung des Krankheitsrisikos und Entdecken der bestehenden Krankheit.
Risikoreduzierende Maßnahmen fördern die Gesundheit, dienen aber nicht der Früherkennung der Krankheit einschließlich präventiver Mastektomie, Chemoprävention und Änderungen des Lebensstils. Früherkennungsmaßnahmen wie Mammographie, klinische Überwachung und Selbstuntersuchungen wiederum sind dazu geeignet, Symptome der Krankheit aufzudecken. Risikoreduktion ist mehr unter der Kontrolle kognitiver als emotionaler Prozesse. Angst und emotionaler Stress stellen keine Beeinträchtigung dar, weil die Gesundheit durch diese Maßnahmen nicht gefährdet ist. Im Gegenteil, sie wirken eher förderlich wegen ihres risikosenkenden Potenzials, dem Gefühl der Kontrolle und somit der Angstreduktion. Das Vorsorgeverhalten hingegen wird durch diese emotionalen Reaktionen eher behindert, denn es beinhaltet die potenzielle Entdeckung der Gesundheitsgefahr. Zum Beispiel das Vorhaben, eine Mammographie oder eine Selbstuntersuchung durchzuführen, konfrontiert die Betroffenen mit der Gefahr, dass Krebs entdeckt wird, was eine Steigerung der Angst und Besorgnis bedeuten würde. Das kann zu angstinduzierter Verdrängung des Screeningverhaltens führen. Daraus ergibt sich eine linear ansteigende Beziehung zwischen Angst und Risikoreduktion (Fig. 1) und eine kurvenförmige zwischen Angst und Vorsorgeverhalten (Fig. 2). Diese kurvenförmige Beziehung zeigt, dass Betroffene mit extrem starkem oder extrem niedrigem emotionalen Stress mit geringerer Wahrscheinlichkeit
Vorsorgemaßnahmen durchführen als Patientinnen mit mittlerem Stressniveau.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Decruyenaere 2000/A
4.1.8 Emotionaler Stress und Entscheidung zum DNS-Test (Decruyenaere 2000/A)
Was ist zu erwarten, wenn man die Beziehung zwischen emotionaler Belastung und der Entscheidung zum DNS-Test bei Hochrisikopatientinnen betrachtet? Durch den Test besteht die Möglichkeit einer Risikosenkung, aber ebenso kann es auch im Falle des Mutationsnachweises ein Anstieg des Brust- und Ovarialkrebsrisikos bedeuten. Decruyenaere et al. stellen die Hypothese auf, dass das Niveau der emotionalen Belastung in Wechselwirkung mit der empfundenen Kontrolle steht. Wichtig ist vor allem der praktische Nutzen, der dem Test beigemessen wird. Die Frage ist, ob und wie gut man bei einem positiven Testergebnis die Erkrankung verhindern bzw. ihren Verlauf beeinflussen kann (Tiefensee 1998). Ist die Betroffene der Meinung, dass sich eine gute Kontrolle ausüben lässt, wird eine linear ansteigende Beziehung zwischen DNS-Test und emotionalem Stress erwartet: Je größer die Brustkrebs- Angst, desto eher wird ein Test verlangt. Die Information über Möglichkeiten präventiven Handelns sind daher sehr wichtig und ihr Fehlen wird von den Frauen häufig kritisiert (Tiefensee 1998). Das Gefühl der Kontrolle über das hereditäre Karzinom kann zudem starke Angstzustände kompensieren, sodass die emotionsbedingte Verdrängung nicht gleichzeitig zur Unterlassung des DNS-Tests führen muss. Bei dem Gefühl einer geringen Kontrollierbarkeit der Erkrankung wird eine kurvenförmige Beziehung zwischen emotionaler Belastung und der Entscheidung für den Test erwartet: Extrem empfundene Bedrohung ohne das Gefühl, Kontrolle ausüben zu können, führt zu einem stressbedingten Aufschub bzw. Rückzug vom DNS-Test.
Eine andere Studie besagt, dass nach der Information über die statistischen Faktoren und den Risikostatus krebsbedingte Besorgnis und Durchführung des DNS-Tests in signifikanter positiver Relation stehen (Lerman zitiert in Decruyenaere 2000/A). Auch hier wird eine kurvenförmige Beziehung zwischen Krebsangst und Entscheidung zum Test erwartet. Bisher konnten diese Hypothesen nicht adäquat nachgewiesen werden, denn die Ergebnisse beruhen auf nur wenigen Testpersonen mit hohem Stressniveau. Es wird vermutet, dass die emotionale Belastung der meisten Studienteilnehmer, die alle Mitglied eines hereditären Krebsregisters sind, geringer ist als bei Personen, die erst vor kurzem als Hochrisikopatienten eingestuft worden sind. Beinhaltet die Gruppe der Teilnehmer aber nur Betroffene mit geringen oder mittleren Angstzuständen, gibt das Ergebnis ein falsches Bild über die Beziehung zwischen emotionalem Stress und Durchführung des DNA-Tests.
Die Entscheidung für oder gegen einen Test hängt nach Tiefensee 1998 auch davon ab, wie sich jemand grundsätzlich zum Nutzen prognostischer Informationen stellt. Ratsuchende, die den Nutzen prädiktiver Diagnostik positiv bewerten, können sich konfliktfreier für einen Test entscheiden. Eine negative Bewertung durch die Ratsuchenden macht im Gegenzug eine konfliktfreie Entscheidung gegen einen Test möglich. Starke Konflikte haben sich erwiesen, wenn die Betroffene zwar die Information eines negativen Befundes wünscht, einen positiven aber auf keinen Fall erfahren möchte. Zudem sollte darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Entscheidung für einen Test im Falle eines positiven Befundes weitere Entscheidungen nach sich ziehen kann. Dann muss geklärt werden, ob prophylaktische operative Maßnahmen erwogen werden sollen und ob bzw. wie und durch wen den betroffenen Familienmitgliedern der Befund vermittelt werden soll.
4.1.9 Verarbeitungsstrategien (Decruyenaere 2000/B)
Die Ratsuchenden weisen unterschiedliche Verarbeitungsstrategien auf, abhängig von der Höhe des geschätzten Risikos. Extrem niedrige bzw. hohe Level ergeben fehlerhafte Verhaltensmuster, während normale Risikoschätzungen mit großer Wahrscheinlichkeit eine effizientere Reaktion hervorrufen. Diese kurvenförmige Beziehung zwischen Stresslevel und Verarbeitungsreaktion bietet eine Erklärung für die oben genannten gegensätzlichen Modelle in der Literatur.
Sowohl die Verarbeitung durch Problemorientierung (wie Informationssammlung, Arztbesuche, Vorsorgeuntersuchungen etc.) als auch durch Emotionsfokussierung (wie defensiver Pessimismus, Minimalisierung des Problems, Verdrängung etc.) können sich störend oder erleichternd auswirken. Speziell Verdrängung bzw. Verleugnung beeinträchtigt zumeist ein problemorientiertes Verhalten. Das wirkt sich besonders destruktiv aus, wenn Aktivitäten wie Informationsbeschaffung, Diskussion in der Familie oder regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen dadurch untergraben werden. Auf der anderen Seite kann Verdrängung/Verleugnung aber auch sehr konstruktiv sein, wenn die Betroffene dadurch vor starker emotionaler Belastung geschützt wird und sie sich so besser auf die Informationen und Entscheidungen konzentrieren kann. Gerade in den ersten Stadien der Verarbeitung hat sich die Verdrängung oder Verleugnung als begrenzender Schutz gegen überwältigende Gefühle verdient gemacht, aber auf lange Sicht gesehen kann diese Art der Verarbeitung die Fokussierung auf das Problem untergraben. Ist die Verdrängung allerdings nur teilweise oder minimal vorhanden, ist eine Störung der gleichzeitig problemorientierten Verarbeitung nicht unbedingt zu erwarten.
Die subjektiven Wahrnehmungen, dass Zeit der wesentliche Faktor ist, kann zu übertriebener Wachsamkeit führen: impulsive Reaktionen, verminderte Erinnerungsfähigkeit und ungenügende Reflektion der Entscheidungskriterien. Daraus resultiert meist ein extremes Überwachungsverhalten wie tägliche Selbstuntersuchung oder sogar eine wenig begründete Entscheidung zu beidseitiger Mastektomie.
4.1.10 Anleitung und Unterstützung der familiären Kommunikation
(Decruyenaere 2000/B)
Genetische Analysen betreffen nie eine Einzelperson, sondern immer eine ganze Familie. Hier können laut Tiefensee (1998) selbst durch positive Befundergebnisse problematische Familiendynamiken entstehen. Obwohl es kaum etwas gibt, wofür ein Mensch weniger verantwortlich ist als für seine Gene, spielen Schuldgefühle eine große Rolle. Zum Beispiel kann sich ein Kind mit negativem Befund mit Schuldgefühlen gegenüber einem Geschwister quälen, das Mutationsträger ist. Ein wichtiges Ziel der genetischen Beratung ist die Anleitung und Unterstützung der familiären Kommunikation über das erbliche Karzinom. Auch wird versucht, die Auswirkungen eines fehlenden Informationsflusses zu verdeutlichen, denn diese ethische Problematik des Wissens und Nicht-Wissens innerhalb einer Familie ist ein großer Konfliktfaktor. Sollte der Wissende nun potentielle Mutationsträger in der Familie informieren und so psychische Belastungssituationen auslösen oder ist in bestimmten Situationen ein Verschweigen angemessener? Decruyenaere et al. sind der Meinung, dass es eine moralische Verpflichtung der Betroffenen ist, andere Verwandte über das genetische Risiko zu informieren, und es ist die Pflicht des Genetikers, die Ratsuchende an diese Verantwortung zu erinnern und die Verbreitung dieser Informationen innerhalb der Familie anzuregen und zu unterstützen. Dennoch stimmen sie überein mit der ethischen Ansicht, dass die Schweigepflicht des Mediziners nicht gebrochen werden sollte, wenn Ratsuchende es nicht wünschen, dass die Familie über die genetische Mutation unterrichtet wird. Die Patientinnen könnten gute Gründe haben, die Information zurückzuhalten, die sonst einen Bruch in den familiären Beziehungen bedeuten kann. Diese Ansichten stehen im Gegensatz zu der Meinung, dass unter bestimmten Bedingungen doch die ärztliche Schweigepflicht gebrochen werden sollte.
Die bereits beschriebenen Unterschiede in der Handhabung der Emotionen können die Diskussionen über genetische Informationen in der Familie komplizieren. Die Verwandten entwickeln ihren eigenen Weg, mit dem Risiko fertig zu werden. Einige lehnen eine Diskussion grundsätzlich ab, wohingegen andere ihre Erfahrungen und Gefühle mit den Angehörigen teilen. Speziell die Betroffenen, welche die Familie informieren möchten, um die Bedrohung und ihre eigene Angst zu kontrollieren, bzw. solche, die sich selbst als Übermittler der schlechten Nachricht sehen, können eine riskante Situation durchlaufen und benötigen zusätzliche Unterstützung und Anleitung in einer solchen Rolle. Sie sollten in der Beratung darauf vorbereitet werden, dass sie als Überbringer der „schlechten Nachricht“ möglicherweise für die emotionale Belastung verantwortlich gemacht werden. Dabei sind es nach Tiefensee (1998) nicht nur die Blutsverwandten, die unter der Belastung leiden, denn indirekt sind auch (Ehe-) Partner betroffen, vor allem, wenn Nachkommen geplant sind. Möglicherweise werden einzelne Partner den jeweils anderen bedrängen, genetische Information einzuholen bzw. gerade das zu unterlassen.
In einigen Familien werden Familiengeheimnisse und Mythen über den hereditären Krebs und seine Vererbung entwickelt. Ein Beispiel solcher Phänomene ist die Selektion durch die Verwandten. Beispielsweise wird ein Bruder oder eine Schwester von den anderen Geschwistern als potentieller Patient ausgesucht, sodass sie selber das Gefühl eines reduzierten Risikos haben. Identifikationsprozesse unterstützen diese Illusion für gewöhnlich. Ähnlichkeiten des Verhaltens oder des Körperbaus zwischen der „Auserwählten“ und dem erkrankten Elternteil sind die Hauptfaktoren, welche den Selektionsprozess forcieren. Solch eine Schutzreaktion kann stärker sein als Fakten und Informationen. Diese geheimnisvolle Atmosphäre voller Tabus durchkreuzt den produktiven Kommunikationsprozess und die soziale Unterstützung, die in der Familie benötigt werden, und endet meist in Konflikten und familiären Aufspaltungen.
Die meisten der Patientinnen, die gefragt wurden, ob sie ihre Verwandten unterrichten wollen, taten dies aus den oben beschriebenen Gründen der problematischen Familiensituation nicht. Aber es gibt auch andere signifikante Hürden, die Angehörigen zu informieren, zum Beispiel Scham, Angst, Schuldgefühle oder Depressionen. Studien haben gezeigt, dass Kommunikation, egal ob gegebene oder erhaltene Information, auch durch Adoption, Scheidung und Wiederheirat, Familienspaltungen und großen Altersabständen zwischen Geschwistern erschwert wird (Green zitiert in Decruyenaere 2000/B).
Die Diskussion über die familiäre Kommunikation ist komplex und empfindlich wegen des Zusammenspiels von individuellen und familiären Ansichten, Vorstellungen, Haltungen und intensiven Emotionen. Zudem spielen die unterschiedlichen konfliktverursachenden Werte eine Rolle in der Verbreitung der Information: das Recht zu wissen und das Recht, nicht zu wissen, Autonomie, Intimsphäre und Solidarität. Es stellt sich die Frage, in welchem Ausmaß solche ethischen Dilemmata in der Realität entstehen und wie sie gelöst werden können.
4.1.11 Ergebnis
Es ist deutlich, dass die Beziehungen zwischen kognitiven Auffassungen, Krebsangst und Gesundheitsverhalten sehr komplex sind und eine Menge Fragen offen bleiben. Zum Beispiel scheinen mittlere Stressniveaus für ein Screeningverhalten optimal zu sein, aber was ist ein mittleres Stressniveau? Und was bedeutet ein hoher AngstLevel? Der optimale Grad der Besorgnis ist bei den verschiedenen Personen sehr unterschiedlich, da ein Zusammenspiel mit vielen anderen Faktoren, wie zum Beispiel empfundener Kontrollierbarkeit, auch eine Rolle spielt.
Eine andere Frage ist, wie man Personen mit großer Krebsangst und mit wenig Glauben an Kontrollierbarkeit erreicht, egal ob in klinischem Kontext oder für Studien. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Betroffenen die bestehenden Krebs- Screening-Programme und genetischen Kliniken ignorieren und so nicht in den betreffenden Studien auftauchen (Decruyenaere 2000/A). Wie erreicht man diese Individuen, um sie umfassend über mögliche Gesundheitsmaßnahmen zu informieren und zu beraten, so dass sie freie Entscheidungen zu ihrem Gesundheitsverhalten treffen können? Medienberichte und Empfehlungen des Hausarztes, der die möglichen Vorteile der Gesundheits-Maßnahmen hervorheben sollte, können helfen, starke Emotionen zu reduzieren und das Gefühl der Kontrolle zu stärken. Das kann dem Einzelnen eine Hilfe sein, mehr Zeit und Energie in begründete Entscheidungen zu investieren.
4.2 Möglichkeiten der Prävention
Im Rahmen allgemeiner Präventionsempfehlungen sollte die Ratsuchende über die prinzipielle Möglichkeit einer individuellen Risikoreduktion informiert werden
(Untch 1998). Nach Schmutzler (1998) kann man Krebsprävention in 3 verschiedene
Bereiche gliedern:
1. Primäre Prävention (Verhütung), die ein Auftreten der Erkrankung verhindern soll. Dazu zählen die Chemoprävention und die operative Maßnahme. Chemoprävention wird zum Beispiel durch die Gabe von Tamoxifen (Östrogenrezeptor-Antagonist) erreicht. Die Effizienz wird zur Zeit in Studien überprüft. Gerade für Frauen mit einem erblichen Brustkrebsrisiko ist die Wirksamkeit dieser Prophylaxe noch nicht bewiesen, denn die meisten familiären Tumoren sind Östrogenrezeptornegativ und Tamoxifen könnte so unwirksam sein. Zu den operativen Maßnahmen zählt die Entfernung der betroffenen Organe, hier Brust und Ovarien. Der Eingriff hat schwere physische und psychische Belastungen zur Folge, die gewonnene Sicherheit aber ist bisher fraglich geblieben. Nach Schmutzler (1998) kann wöchentlich 3 - 4 Stunden sportliche Betätigung das Risiko ebenfalls um bis zu 50 % senken. Dieser Effekt wird auf eine Veränderung der ovariellen Funktion im Sinne einer Downregulation zurückgeführt.
2. Sekundäre Prävention (Früherkennung), die helfen soll, den Krebs in einem Stadium zu entdecken, in dem noch gute Heilungschancen bestehen (Mammographie, klinische Untersuchung, Selbstuntersuchung etc.). Ein spezifisches Problem der Früherkennung des familiären Mammakarzinoms liegt in der niedrigen Sensitivität der Mammographie bei Frauen unter 50 Jahren, da das Brustdrüsengewebe noch sehr dicht ist.
3. Therapie und Tertiäre Prävention (Nachsorge), die absichern soll, dass der Tumor vollständig entfernt wurde und keine Rezidive auftreten. Die Therapie richtet sich in aller Regel nach den herrschenden kurativen und palliativen Maßstäben. Beim erblichen Mammakarzinom ist allerdings bekannt, dass eine Reihe von Tumorgenen eine Rolle in der DNA-Reparatur spielen. Daher wird diskutiert, dass familiäre Tumoren auf Chemo- oder Bestrahlungstherapien modifiziert reagieren könnten. Das könnte zu einer erhöhten Sensibilität, aber auch zu einer erhöhten Resistenz gegenüber bestimmten Therapien führen. Da Patientinnen mit einem familiären Tumorleiden ein deutlich erhöhtes Risiko haben, an einem Zweitkarzinom zu erkranken, muss das Nachsorgeprogramm dem Vorsorgeprogramm angepasst und ebenfalls lebenslang durchgeführt werden.
Da das hereditäre Mamma- und Ovarialkarzinom mit einem frühen Erkrankungsalter einhergeht, müssen auch die präventiven Maßnahmen eher eingeleitet und in kürzeren Abständen wiederholt werden, als es in den allgemeinen Vorsorgeprogrammen vorgesehen ist (Untch 1998). Dabei wird das Schaden-Nutzen- Verhältnis der einzelnen Präventionsmaßnahmen in der Literatur teilweise sehr konträr diskutiert. Vor allem betreffend der Effizienz präventiver Medikamenteneinnahme und der höheren Strahlenbelastung durch die halbjährliche bis jährliche prophylaktische Mammographie liegen der Wissenschaft noch keine adäquaten Ergebnisse vor. Zudem ist bekannt, dass Brüste junger Frauen sehr dicht sind und eine maligne Entartung auf dem Mammogramm nur schwer erkennbar ist. Dennoch hat die Patientin jederzeit die Möglichkeit, die Fortführung der präventiven Maßnahmen, zum Beispiel aus Gründen der Unverträglichkeit oder des Zweifels, zu ändern oder sogar zu beenden. Im Unterschied dazu ist die schwerwiegende Entscheidung für eine prophylaktische Operation am Ende irreversibel und soll daher hier besondere Beachtung finden.
4.2.1 Prophylaktische Mastektomie
Angehörige aus Familien mit der genetischen BRCA-Disposition setzen sich häufig mit der Frage der prophylaktischen Chirurgie auseinander und erwarten hier eine kompetente Beratung. Dazu sollte betont werden, dass endgültige Auswertungen größerer bereits vorliegender Zahlen zu Vor- und Nachteilen nach prophylaktischer Chirurgie noch ausstehen. Zuverlässige Daten sind erst in 10 - 20 Jahren zu erwarten (Untch 1998).
Die Frage der prophylaktischen Mastektomie ist sehr komplex. Die Entscheidung für eine Operation fällt bei nur 50 - 80 %iger Penetranz des familiären Mammakarzinoms schwerer, als wenn die Erkrankung mit 100 %iger Wahrscheinlichkeit ausbrechen würde. Nach Vasen (1994) sollten folgende individuelle Faktoren bei der Entscheidung in Betracht gezogen werden: das geschätzte Risiko, Brustkrebs zu entwickeln, die Erreichbarkeit der Brust für Mammographie und Tastbefunde, eine umfassende Auswertung zu einem Leben als Hochrisikopatient sowie den physischen und psychischen Konsequenzen einer Brustoperation.
Die Effizienz der beidseitigen Mastektomie ist bisher allerdings weder bewiesen noch ist eine vollständige Entfernung des Brustdrüsenkörpers möglich (Schmutzler 1998). Die Entscheidung für oder gegen einen operativen Eingriff hängt also im Wesentlichen ab von der gewonnenen Sicherheit und den alternativen Möglichkeiten der sekundären Prävention. Ebenso muss die Problematik des verbleibenden Restdrüsengewebes mit nachfolgender möglicher Mammakarzinom- entwicklung nach der prophylaktischen Chirurgie angesprochen werden.
Laut Untch (1998) lassen retrospektive Analysen zur Effektivität der beidseitigen Mastektomie eine Risikosenkung um bis zu 90 % erwarten, und so sollte dem diesbezüglichen Patientinnenwunsch bei nachgewiesener Mutation nicht generell ablehnend begegnet werden. Hier sollte besonders der Zeitpunkt der Interventionen sorgfältig gewählt und die Möglichkeit einer plastischen Rekonstruktion erörtert werden. Ob die vielfach durchgeführte subkutane Mastektomie ein geeignetes Verfahren ist, wird derzeit noch konträr diskutiert. Da hierbei die Mammille und ein kleiner Teil des Drüsenkörpers nicht entfernt werden, besteht weiterhin das Risiko, ein Karzinom zu entwickeln. Im angloamerikanischen Raum wird aufgrund der höheren Sicherheit die einfache Mastektomie unter Mitnahme der Mammillenkomplexe empfohlen.
5 Schlussbetrachtung
Das familiär erbliche Mammakarzinom ist erst seit 1994 mit der Entdeckung der BRCA-Mutationen genetisch nachweisbar geworden. Die darauf basierenden Beratungssituationen und wissenschaftlichen Untersuchungen stecken dementsprechend noch in den Anfängen, denn gerade bei Krebserkrankungen können nur Langzeitstudien verwertbare Ergebnisse liefern. Zweifelsfrei nachzuweisen ist lediglich, ob eine Mutation vorliegt oder nicht. Viele andere Faktoren basieren weiterhin nur auf Vermutungen und Wahrscheinlichkeitsrechungen. Brisante Diskussionen gibt es dabei vornehmlich zum fraglichen Nutzen der prophylaktischen Chirurgie und der Entscheidungshilfe in der genetischen Beratung. Wie bereits erwähnt fehlen bei letzterer bisher prospektive und kontrollierte Studien, welche die Effektivität der bilateralen prophylaktischen Mastektomie belegen. Die meisten Publikationen untersuchen retrospektiv Patientinnen, bei denen zur damaligen Zeit eine exakte Risikodefinition noch gar nicht möglich war. Auch wenn diese Arbeiten teils den Eindruck einer Risikosenkung um bis zu 90 % vermitteln, offenbaren sie bei kritischer Betrachtung doch einige Probleme. Da es sich meist um ein heterogenes Patientinnenkollektiv handelt, kann durch die fehlende exakte Risikodefinition davon ausgegangen werden, dass das Erkrankungsrisiko der untersuchten Gruppen teilweise überschätzt wurde (Gerber 1999). Das Mammakarzinomrisiko ließ sich so für Patientinnen mit mäßigem und hohem Risiko gleichermaßen um 90 % senken. Bei der Mamma handelt es sich zudem um ein sensorisches Organ, dessen Entfernung starke physische und psychische Folgen für die Betroffene haben kann.
Diese Problematik macht es für mich äußerst schwierig, mir eine eigene Meinung zu bilden, denn es ist nicht abzusehen, was die Untersuchungen in 10 - 20 Jahren ergeben werden. Bisher existieren nur Vermutungen, die mir nicht für eine umfassende Beurteilung ausreichen. Ich bin lediglich der Ansicht, dass bei den heutigen Möglichkeiten der Früherkennung und wissend, dass sich Patientinnen mit hereditärem und nicht-erblichem Mammakarzinom hinsichtlich der Prognose nicht unterscheiden (Gerber 1999), eine prophylaktische Mastektomie nicht empfehlenswert ist. Risikopatientinnen werden zudem besser überwacht und man kann die Karzinome so eher, in prognostisch günstigeren Stadien entdecken, als dies in der Gesamtpopulation der Fall ist.
Ein weiteres großes Problem ist die Komplexität psychosozialer Aspekte, die sich, anders als beispielsweise die Größe eines Tumors, nicht messen lassen. Es fließen sehr viele dieser nicht messbaren Faktoren in die genetische Beratung ein (Familiensituation, psychische Stabilität, Vorwissen etc.), die für jede einzelne Ratsuchende immer andere Voraussetzungen und Folgen mit sich bringen. Es ist also schwerlich möglich, die Reaktionen der Betroffenen und die bestmögliche Beratung in ein Schema pressen zu wollen, was aber die Grundlage einer Untersuchung darstellt und in den Studien immer wieder versucht wird. Schon die Erstellung der Fragebögen einer Studie zu psychosozialen Aspekten stellt eine Schwierigkeit dar, weil deren Beantwortung rein subjektiver Natur ist und je nach Ermessen ein breites Antwortspektrum aufweist. Das verschlungene Gewebe aus Ängsten, Verdrängung, Vorwissen und Verarbeitung der Informationen hat vielerlei Muster und sollte nach meinem Empfinden daher bei jeder Patientin grundlegend neu erarbeitet werden.
6 Zusammenfassung
Ziel dieser Arbeit ist es - neben den genetischen Aspekten und dem klinischen Verlauf - die durch die Entdeckung der Brustkrebsgene BRCA 1 und 2 möglich gewordene Nachweisbarkeit und ihre Folgen (vor allem für die Betroffenen) darzustellen. Durch das positive Ergebnis des genetischen Tests sind die Patientinnen einem Wissen „ausgesetzt“, mit dem sie fertig werden müssen (selbst und in Bezug auf ihre Familien) und das nicht rückgängig zu machen ist. Wer sich für einen genetischen Test entscheidet und so mit der Tatsache konfrontiert wird, dass er diese Mutation aufweist, hat sozusagen hinter sich eine Tür geschlossen und ist vor vielerlei weitere Entscheidungen gestellt: Welche prophylaktischen Maßnahmen sollen ergriffen werden? Soll die Familie informiert werden? Kinder, ja oder nein? Mir war es wichtig aufzuzeigen, dass nicht nur die Erkrankung selbst eine starke psychische Belastung darstellt, sondern viel mehr auch das Wissen um ein lebenslanges Risiko. Erschwerend hinzu kommt, dass diese genetische Disposition nur eine unvollständige Penetranz aufweist und so der Entscheidungskonflikt für oder gegen prophylaktische Maßnahmen ein sehr viel größerer ist, als bei eindeutig Erkrankten oder 100 %igem Risiko.
Andererseits kann die Erkenntnis, dass es Gene gibt, die Brustkrebs verursachen können, sehr hilfreich für die Prophylaxe sein. Patientinnen mit einer BRCA- Mutation werden in ein dichtes Netz von Früherkennungsmaßnahmen eingespannt und haben so oft eine bessere Heilungschance, weil ihre Karzinome in prognostisch günstigeren Stadien entdeckt werden. Es ist nur die Frage, ob eine genetische Testung in diesem Fall nicht unverantwortlich ist, wenn sich in der notwendigen Beratung nicht auf verlässliche Daten gestützt werden kann, was Prognose, prophylaktische Chirurgie oder Penetranz betrifft. Da aber der Nachweis möglich geworden ist, kann man es den Betroffenen nicht mehr vorenthalten und sie in belastender Ungewissheit leben lassen. Dieser Konflikt zwischen ethisch- moralischen Aspekten und medizinischer Forschung sollte hier dargestellt werden, denn zumeist sind es medizinische Laien, die dann einschneidende Entscheidungen treffen müssen, bei denen selbst Experten mangels signifikanten Ergebnissen weder zu- noch abraten können.
Als Abschluss möchte ich dazu einen Satz aus „ Die graue Erde “ von Galsan Tschinag zitieren, der die (psychische) Situation der Betroffenen nach einem positiven Testergebnis sehr treffend beschreibt:
Zitat: „Ich bin ein Stein, der bewegt worden ist, unmöglich wird sein für mich, zurückzukehren dorthin, wo ich hingefallen war, als es anfing, mich zu geben.“
Ich versichere, dass ich die Arbeit ohne fremde Hilfe verfasst und mich dabei nicht anderer als der angegebenen Hilfsmittel bedient habe.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ich bin mit einer späteren Ausleihe der Arbeit einverstanden.
Unterschrift:
7 Literaturverzeichnis
BACKE J., Mulfinger L., „Untersuchungsmöglichkeiten beim familiären Mammaund Ovarialkarzinom“ In: Krankenpflege Journal, 34, 1996, 440 - 445
BECK T., Knapstein P., Kreienberg R., Das Mammakarzinom: interdisziplinäre Diagnostik, Therapie und Nachsorge, Ferdinant Enke Verlag, 1994
DECRUYENAERE M., Evers-Kiebooms G., Claes E., Denayer L., Welkenhuysen M., Legius E., Demyttenaere K., „Psychosocial Aspekts of Familial Breast and Ovarian Cancer: Psychological Guidelines for Genetik Testing“ In: Disease Markers, 15, 1999, 152 - 153
DECRUYENAERE M., Evers-Kiebooms G., Welkenhuysen M., Denayer L., Claes
E. „Cognitive Representations of Breast Cancer, Emotional Distress and Preventive Health Behaviour: A Theoretical Perspective“
In: Psycho-Oncology, 9, 2000, 528 - 536, (A)
DECRUYENAERE M., Evers-Kiebooms G., Denayer L., Welkenhuysen M., Claes E., Legius E., Demyttenaere K. „Predictive testing for hereditary breast and ovarian cancer: a psychological framework for pre-test counselling“
In: European Journal of Human Genetics, 8, 2000, 130 - 136, (B)
ERBAR P., Onkologie, Einführung in Pathophysiologie, Klinik und Therapie maligner Tumoren, Schattauer Verlag, 1994
GROEBEN C. von der, Neef K., Rohde A., Bodden-Heidrich R., Schmutzler R.,
„Psychosoziale Aspekte der prädiktiven Gendiagnostik bei familiärem Mamma- und Ovarialkarzinom“ In: Deutsche medizinische Wochenschrift, 124, 1999, 361 - 362
GERBER B., Friese K., „Effektivität der bilateralen Mastektomie bei Frauen mit familiärer Brustkrebsanamnese“
In: Strahlentherapie Onkologie, 175, 1999, 293 - 298
HAMPL M., Chang-Claude J., Schwarz P., Saeger H.-D., Schackert H. K., „Molekulargenetik des hereditären Mammakarzinoms“
In: Zentralblatt für Chirurgie, 122, 1997, 67 - 73
HOFFBERT S., Backe J., Worringen U., Caffier H., Faller H., Grimm T., Weber B., Institut für Humangenetik, Würzburg, „Familiäres Mamma- und Ovarial-Carcinom: Interdisziplinärer Ansatz zur genetischen Testung“
In: Medizinische Genetik, 10, 1998, 253 - 255
HOLINSKI-FEDER E., Brandau O., Nestle-Krämling C., Derakhshandeh-Peykar P., Murken J., Untch M., Meindl A., „Genetik des erblichen Mammakazinoms“ In: Deutsches Ärzteblatt 95, 11, 1998, 494 - 499
MEIJERS-HEIJBOER E., Verhoog L., Brekelmans C., Seynaeve C., Tilanus-
Linthorst M., Wagner A., Dukel L., Devilee P., Ouweland A. van der, Geel A. van, Klijn J., „Presymptomatic DNA-testing and prophylactic surgery in families with BRCA1 or BRCA2 mutation.“ In: Lancet, 355, 2000, 2015 - 20
MÜLLER H., Scott R., „Familiäres Kolorektal- und Mammakarzinom- genetische Beratung und präsymptomatische Diagnostik“
In: Therapeutische Umschau, 12, 1995
PETO J., Easton D., Matthews F., Ford D., Swerdlow A., „Cancer Mortality in Relatives of Women with Breast Cancer: The OPCS Study“ In: International Journal Cancer, 65, 1996, 275 - 283
SCHERNEK S., Hofmann W., „BRCA 1 und BRCA 2: Mutationen und andere genetische Veränderungen - praktische Relevanz“
In: Der Chirurg, 70, 1999, 373 - 379
SCHMUTZLER R., Universitäts-Frauenklinik, Bonn, „Die Bedeutung von Tumorgenen für die klinische Diagnostik und Therapie“ In: Medizinische Genetik, 10, 1998, 259 - 261
THOMSEN K., Trams S., Aktuelle Probleme des Mammakarzinoms, Ferdinant Enke Verlag, 1981
TIEFENSEE J., Klusmann D., „Psychische Aspekte prädiktiver genetischer Diagnostik bei Brust- und Eierstockkrebs“
In: Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische Psychologie, 48, 1998, 369 - 374
TILING R., Mammakarzinom - nuklearmedizinische und radiologische Diagnostik, Springer Verlag, 1998
TSCHINAG G., Die graue Erde (Roman), Suhrkamp Verlag, 2001
UNTCH M., Konecny G., Sittek H., Keßler M., Reiser M., Hepp H., Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms, Zuckschwerdt Verlag, 1998
VASEN H., „Screening in Breast Cancer Families: Is it Useful?“ In: Annals of Medicine, 26, 1994, 185 - 190
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptfokus dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über das hereditäre Mammakarzinom (erblichen Brustkrebs), einschließlich klinisch-medizinischer Aspekte, genetischer Grundlagen und psychosozialer Überlegungen.
Welche klinisch-medizinischen Aspekte des Mammakarzinoms werden behandelt?
Das Dokument behandelt morphologische Grundlagen (nicht-invasive und invasive Mammakarzinome, Besonderheiten bei BRCA 1-/2-Karzinomen), Diagnostik des Mammakarzinoms und Therapieoptionen.
Welche genetischen Aspekte werden im Zusammenhang mit dem Mammakarzinom diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet Tumorsuppressor- und Protoonkogene, die Rolle der Gene BRCA 1 und BRCA 2 (Eigenschaften, Mutationen), funktionelle Gemeinsamkeiten von BRCA 1 und 2, weitere genetische Faktoren, Risikoeinschätzung bei Mutationsträgerinnen, Mutationsnachweis/Gentest und die genetische Beratung.
Welche psychosozialen Aspekte werden im Dokument behandelt?
Es werden die genetische Beratung als psychosoziales Gefüge, kognitive und emotionale Verarbeitung der Information, Meinungen zum Grund der Erkrankung, Auffassungen zur Schwere und Kontrollierbarkeit, emotionaler Stress, Verarbeitungsstrategien, familiäre Kommunikation und Möglichkeiten der Prävention (prophylaktische Mastektomie) diskutiert.
Was sind Carcinoma ductale in situ (CDIS) und Carcinoma lobulare in situ (CLIS)?
CDIS und CLIS sind nicht-invasive Mammakarzinome, also Karzinomvorstufen. CDIS entwickelt sich in den Milchgängen, CLIS in den Läppchenstrukturen der Brustdrüse.
Was sind die Hauptformen invasiver Mammakarzinome?
Die beiden Hauptformen sind das invasiv-duktale und das invasiv-lobuläre Mammakarzinom.
Welche Besonderheiten gibt es bei BRCA 1-/2-Karzinomen in Bezug auf Histologie?
BRCA 1-assoziierte Tumoren sind häufiger aneuploid und weisen häufiger ein Grading 3 auf. Duktale In-situ-Karzinome sind seltener. BRCA 1-Karzinome sind häufiger östrogen- und progesteronrezeptor-negativ.
Welche diagnostischen Verfahren werden zur Erkennung von Mammakarzinomen eingesetzt?
Die Verfahren umfassen nicht-invasive Methoden (körperliche Untersuchung, Mammographie, Sonographie, Kernspintomographie) und invasive Methoden (Biopsie).
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es für Mammakarzinome?
Therapieoptionen sind brusterhaltende Operation, brustentfernende Operation (Mastektomie), Radiatio, Chemotherapie und Hormontherapie.
Was sind Protoonkogene und Tumorsuppressorgene?
Protoonkogene können zu Onkogenen mutieren und unkontrolliertes Zellwachstum auslösen. Tumorsuppressorgene (TSG) blockieren die Umwandlung von Protoonkogenen zu Onkogenen und verhindern so die maligne Entartung.
Was ist die Funktion der Gene BRCA 1 und BRCA 2?
BRCA 1 und BRCA 2 sind Tumorsuppressorgene, die an DNS-Reparaturprozessen und der Regulation der Zellteilung beteiligt sind.
Welche Rolle spielt die Genetik bei der Entstehung von Mammakarzinomen?
Mutationen in den Genen BRCA 1 und BRCA 2 erhöhen das Risiko, an Brust- und Eierstockkrebs zu erkranken. Diese Mutationen werden autosomal dominant vererbt.
Wie wird das Risiko für Mutationsträgerinnen eingeschätzt?
Die Risikoeinschätzung berücksichtigt Faktoren wie die Anzahl betroffener Familienmitglieder, Verwandtschaftsgrad, Alter bei der Erkrankung, Bilateralität und das Auftreten anderer Tumoren.
Welche Probleme gibt es beim Mutationsnachweis/Gentest?
Zu den Problemen zählen Unsicherheiten bei der Risikoabschätzung, Interpretation von Mutationsdaten, Notwendigkeit methodischer Entwicklungen, Unklarheiten über Beratungskonzepte und psychische Belastung Betroffener.
Was beinhaltet die genetische Beratung?
Die genetische Beratung umfasst die Abschätzung des Erkrankungsrisikos, Erläuterung des Erbgangs, Erklärung der Vorgehensweise bei einer molekulargenetischen Untersuchung und Aufklärung über den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Welche psychosozialen Folgen hat die genetische Beratung?
Die psychosozialen Folgen umfassen emotionale Reaktionen (Angst, Depressionen, Schuldgefühle), Veränderung des Selbstbildes, familiäre Kommunikation und die Entscheidung für oder gegen einen Gentest.
Welche Möglichkeiten der Prävention gibt es?
Die Prävention umfasst primäre Prävention (Chemoprävention, operative Maßnahmen), sekundäre Prävention (Früherkennung) und Therapie/tertiäre Prävention (Nachsorge).
Was ist eine prophylaktische Mastektomie?
Eine prophylaktische Mastektomie ist die vorbeugende Entfernung der Brustdrüse, um das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, zu senken.
Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidung für oder gegen eine prophylaktische Mastektomie?
Die Entscheidung wird beeinflusst durch das geschätzte Risiko, Brustkrebs zu entwickeln, die Erreichbarkeit der Brust für Mammographie und Tastbefunde, eine umfassende Auswertung zu einem Leben als Hochrisikopatient sowie den physischen und psychischen Konsequenzen einer Brustoperation.
- Quote paper
- Bettina Pfadt (Author), 2001, Der familiär erbliche Brustkrebs (Mammakarzinom): klinisch-medizinische, genetische und psychosoziale Aspekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106204