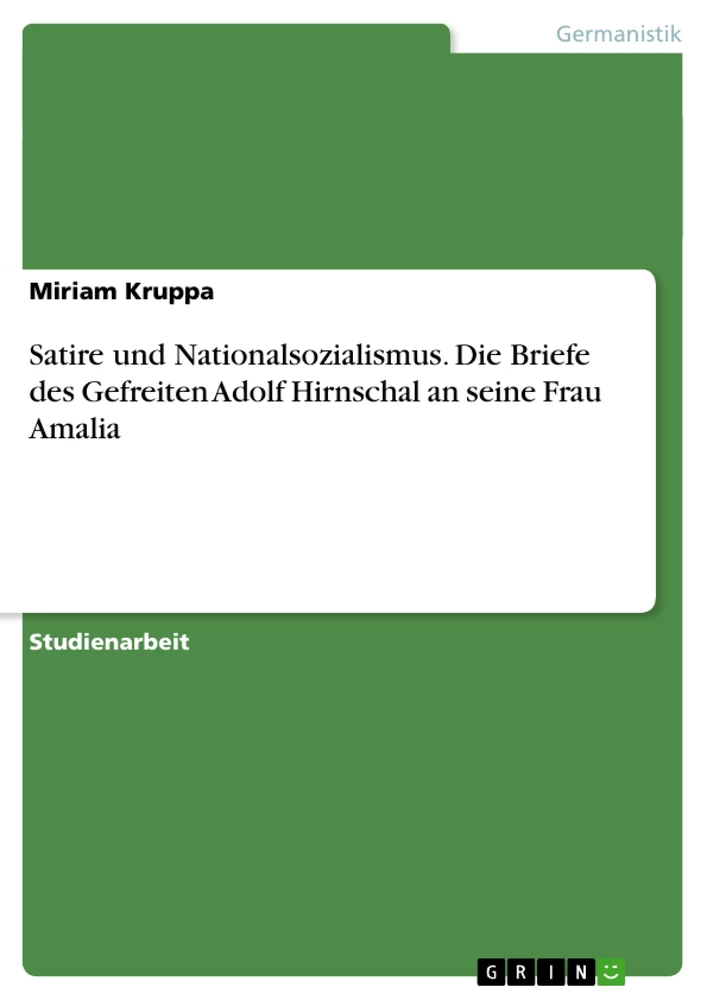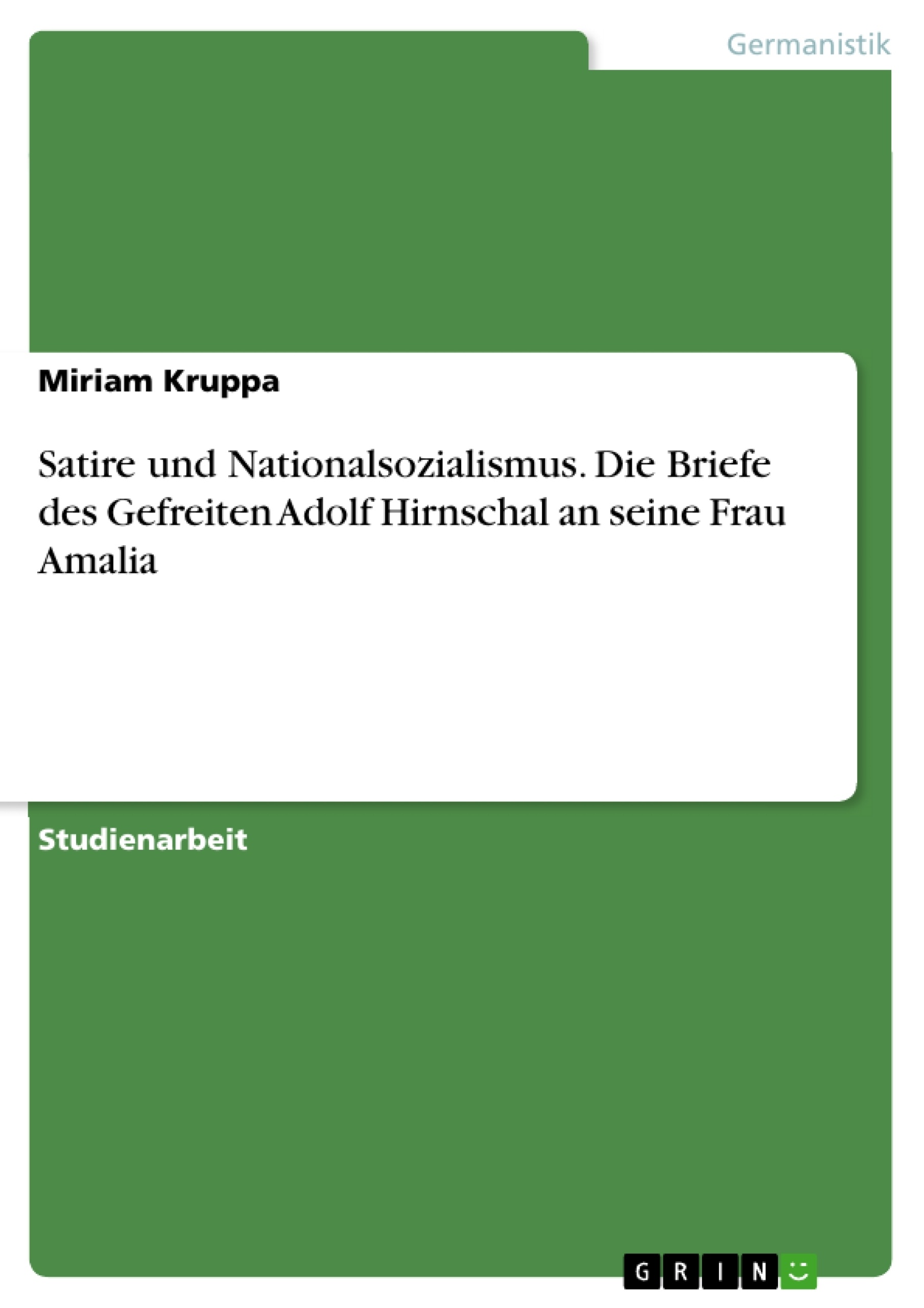Stellen Sie sich vor, ein kleiner Gefreiter namens Adolf Hirnschal, eine fiktive Figur, wird zur schärfsten Waffe gegen das Dritte Reich. In einer Zeit, in der offene Kritik am Nationalsozialismus einem Todesurteil gleichkam, schuf Robert Lucas, ein Exilant in London, eine satirische Radiosendung für die BBC, die das deutsche Volk auf subtile und urkomische Weise unterwanderte. Diese Arbeit untersucht, wie Lucas' "Briefe des Gefreiten Adolf Hirnschal" zu einem subversiven Akt wurden, der die Propaganda des Regimes entlarvte und den Widerstand im Inneren stärkte. War es möglich, mit Humor eine Diktatur zu Fall zu bringen? Die Analyse der Hirnschal-Briefe enthüllt die satirischen Strategien, die Lucas einsetzte, um die Absurdität des Faschismus aufzudecken, von der Parodie auf militärische Befehle bis hin zur subtilen Kritik an der Ideologie der Nationalsozialisten. Diese Studie beleuchtet die Bedeutung von Satire als Mittel des Widerstands im Angesicht von Unterdrückung und untersucht die komplexen Herausforderungen, mit denen Künstler und Schriftsteller im Exil konfrontiert waren, als sie versuchten, ihre Botschaften zurück in ihre Heimat zu tragen. Die Arbeit ergründet die historischen Rahmenbedingungen, die die Entstehung und Verbreitung dieser subversiven Radiosendung ermöglichten, und analysiert die Rezeption beim deutschen Publikum, das trotz der Risiken das Abhören ausländischer Sender wagte. Entdecken Sie, wie ein einfacher Soldat, erschaffen in den Studios der BBC, zu einem Symbol der Hoffnung und des stillen Protests wurde, indem er das Regime mit seinen eigenen Waffen schlug: mit intelligentem Witz und scharfer Beobachtungsgabe. Dies ist nicht nur eine Analyse von Satire, sondern eine Hommage an den Mut derer, die es wagten, in dunklen Zeiten zu lachen, und an die Macht des Humors, die selbst die stärkste Mauer der Propaganda durchbrechen kann. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Widerstandskraft des Geistes und der Bedeutung von künstlerischem Ausdruck im Kampf gegen Totalitarismus, bietet diese Analyse neue Perspektiven auf die Rolle der Satire im Zweiten Weltkrieg und ihre anhaltende Relevanz in Zeiten politischer Unruhen. Die Arbeit ist eine Hommage an die subversive Kraft des Humors und die Fähigkeit der Kunst, selbst in den dunkelsten Zeiten Hoffnung zu säen und Widerstand zu leisten.
Einleitung
Die meiste Kritik an der nationalsozialistische Diktatur entstand aus gegebenem Anlass im Ausland. Exilierte Schriftsteller, Künstler und Intellektuelle konnten von dort das Geschehen im damaligen Deutschen Reich beobachten und kommentieren, ohne sich damit in Lebensgefahr zu begeben. Eine der Schwierigkeiten war jedoch, nicht nur im Ausland eine Stimme und damit Zuhörer zu haben, sondern die Kritik auch in die Heimat zurückzutragen, um dort zu wirken, wo Kritik angebracht war. Eine der besten Möglich- keiten war der Auslandsdienst der BBC, denn die professionelle Organisation, die weite Verbreitung des Volksempfängers und die einfache Möglichkeit der Publikation – in Relation zu Flugblätter, eingeschmuggelter Literatur usw. – garantierten zumindest eine gewisse Anzahl Zuhörer. Robert Lucas, geborener Ehrenzweig, emigrierte 1934 von Wien nach London; dort arbeitete er zunächst als Korrespondent der Neuen Freien Presse, Wien und wechselte 1938 zum Rundfunk. Seine Briefe des Gefreiten Adolf Hirnschal sind ein Stück satirischer Faschismuskritik, witzig, pointiert, scharfsinnig, schnell, oft verglichen mit Haseks Schwejk, an dessen literarische Qualität die Arbeit von Lucas jedoch nicht heranreicht. Man merkt den Briefen an, dass sie für das Radio produziert wurden, dass sie ein Bestandteil britischer Propaganda waren und auch ein Stück der täglichen Arbeit von Lucas. Die Sendung erfreute sich im Deutschen Reich vor allem gegen Ende des Krieges großer Beliebtheit. Im historischen Kontext kommt ihr eine Bedeutung zu, die in der folgenden Arbeit skizziert werden soll.
Um dies zu bewerkstelligen, möchte ich zunächst einen Arbeitsbegriff für Satire im Nationalsozialismus formulieren. Was bedeutet Satire in dem speziellen historischen Kontext? Welche besonderen Voraussetzungen hatte Satire im Nationalsozialismus, mit welchen Schwierigkeiten war sie konfrontiert, welche Wirkung war intendiert und welche konnte sie unter den gegebenen Umständen tatsächlich erzielen?
Im zweiten Teil folgt eine Analyse einiger Hirnschal-Briefe. Im Hinblick auf den zu- vor formulierten Arbeitsbegriff für Satire wird erarbeitet, wem der Angriff in den Briefen gilt und welche Wirkung damit erzielt werden soll. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den satirischen Mitteln, die Lucas verwendet, um Kritik am Faschismus zu üben. Dafür konn- ten nicht alle Briefe herangezogen werden, da eine vollständige Archivierung der über 100 Sendungen nach dem Krieg nicht vorgenommen wurde. In Buchform sind lediglich 53 Briefe erschienen, die vor Erscheinen teilweise gekürzt, zusammengefasst und redaktio- nell überarbeitet wurden. Aus diesen Briefen habe ich einige repräsentative Briefe ge- wählt, an Hand derer sich die formulierten Fragestellungen analysieren lassen.
„Nur nebenbei sei angemerkt, dass es fürs Denken gar keinen besseren Start gibt als das Lachen. Und insbesondere bietet die Erschütterung des Zwerchfells dem Gedanken gewöhnlich bessere Chancen dar als die der Seele“
Walter Benjamin, 1934
Satire und Nationalsozialismus. Bemühung um einen Arbeitsbegriff
Zunächst einmal stellt sich die Aufgabe, einen passenden Arbeitsbegriff für Satire in der NS-Zeit zu erarbeiten. Ich wähle bewusst das Wort „Arbeitsbegriff“, weil es eine um- fassende, allgemeingültige Definition von Satire nicht geben kann. Satire ist immer abhängig vom historischen Kontext, in dem diese entsteht. Ihr ist zu eigen, dass sie mal mehr, mal weniger mit Mitteln der Indirektheit arbeitet, um Personen oder gesellschaft- liche Zustände zu kritisieren, und diese Indirektheit muss vom Publikum jeweils verstanden werden, damit die implizierte Kritik darin überhaupt zum Tragen kommt. Das bedeutet, dass weder die Satire selbst noch ein möglicher Satirebegriff zeitlos sein kann. Einige konstitutive Elemente lassen sich jedoch für Satiren, wie sie heute verstanden werden, formulieren. Jürgen Brummack setzt in seinem Aufsatz „Zu Begriff und Theorie der Satire“1 drei solcher konstitutiven Elemente fest. Das erste sei ein psychologisches, individuelles Moment, ein persönlicher Hass, Wut und Aggression des Autors. Das zweite Element definiert Brummack als sozial. Satire sei ein Angriff, dessen Zweck es sei, gesellschaftlich etwas Bestimmtes zu bewirken. Das dritte schließlich stellt er dar als die ästhetische Komponente, die konkrete Ausführung der Satire mit bestimmten Mitteln. Diese drei Elemente implizieren, dass Satire sich im jeweiligen persönlichen, sozialen und ästhetischen Kontext anders darstellt.
Um Satire, die während der NS-Zeit entstanden ist, analysieren zu können, ist es also notwendig, die persönlichen Umstände des Autoren zu berücksichtigen, das Ziel sei- nes Angriffes genauer zu definieren, die intendierte Wirkung und die tatsächliche Wirkung genauer zu untersuchen. Aus dieser Zielsetzung geht hervor, dass Satire hier nicht als Gattungsbegriff, sondern als „künstlerische Methode“2, als besonders Mittel zur Kritik am Nationalsozialismus zu verstehen ist.
Die Umstände, unter denen Satire in der NS-Zeit wirken konnte, wurden durch den Terror der Nazis äußerst erschwert. Aus diesem Grund mache ich bewusst die Unter- scheidung zwischen der intendierten Wirkung des Autors und der tatsächlichen, war letz-
tere doch gerade in den letzten Kriegsjahren äußerst beschränkt. Satire oder satireähnliche Produktionen waren seit 1941 im deutschen Reich grundsätzlich verboten. In einer Anordnung vom 30. Januar 1941, unterschrieben von Josef Goebbels, heißt es:
„Trotz meiner wiederholten Erlasse vom 8. Dezember 1937, 6. Mai 1939 und 11. Dezember 1940, in denen ich eindringlich die Forderung erhob, das Kabarett- und Vortragswesen den Erfordernissen des öffentlichen Geschmacks, besonders aber denen des Krieges anzugleichen, treiben sogenannte Conferenciers, Ansager und Kabarettisten [] weiterhin ihr Unwesen. [...]
- Jegliche sogenannte Conference oder Ansage wird ab sofort für die ganze Öffentlichkeit grundsätzlich verboten. [...]
- Glossierungen von Persönlichkeiten, Zuständen oder Vorgängen des öffentlichen Lebens, auch angeblich positiv gemeinte, sind in Theatern, Kabaretts, Varietes und sonstigen öffentlichen Unterhaltungsstätten verboten.“3
Die Androhung und reale Gefahr hoher Strafen und die lebensgefährliche Situation, in der sich Kritiker des Regimes befanden, machte die Produktion von Satire fast unmöglich. Es blieb die Möglichkeit, den „Angriff“ aus dem Exil heraus zu machen, was jedoch die Wir- kungsmöglichkeiten auf diejenigen Leute beschränkte, die sich ebenfalls im Exil befanden. Für diese allein, die sich schon von vorne herein in Opposition zu den Nationalsozialisten befanden, konnte Satire nicht bestimmt sein4. Absicht der Satire musste sein, diejenigen, die sich im Deutschen Reich selber in Opposition befanden und die anderen, die schon zweifelten an der Rechtmäßigkeit der Diktatur, zu bestärken, Zweifel zu säen, den Widerstand in der Bevölkerung anzustacheln. Dafür war es jedoch nötig, die Bevölkerung erst einmal zu erreichen. Satire im Faschismus muss also unter dem Aspekt ihrer relativen Unmöglichkeit analysiert werden.
Robert Lucas hatte den Vorteil, für seine Arbeit den deutschen Service des BBC in Anspruch nehmen zu können. Der Europäische Dienst des BBC wurde 1938 aufgenom- men und als Instrument psychologischer Kriegsführung verstanden. Die Hirnschal-Briefe wurden zwischen dem 21. Dezember 1949 und dem 1. Mai 1945 regelmäßig ausgestrahlt. Obwohl das Abhören von ausländischen Sendern im Deutschen Reich unter Androhung hoher Strafen verboten war - auf den Sendersuchknöpfen wurden sogar kleine Aufkleber angebracht, auf denen unter Androhung hoher Zuchthausstrafen davor gewarnt wurde, ausländische Sender abzuhören – verfolgten nach britischen Erhebungen ca. zehn Millionen Zuhörer regelmäßige die Briefe des Gefreiten Hirnschal.5 Angesichts der Tatsache, dass zwischen 1933 und 1943 ca. 4,3 Millionen Volksempfänger und 2,8 Millio- nen Deutsche Kleinempfänger produziert und im Umlauf waren6, sind 10 Millionen
[...]
1 Brummack, Jürgen: „Zu Begriff und Theorie der Satire“. Zu den drei konstitutiven Elementen der Satire vgl. insbesondere Seite 282f.
2 Den Begriff „künstlerische Methode“ im Zusammenhang mit Satire verwendet Uwe Naumann in seiner Dissertation „Zwischen Tränen und Gelächter. Satirische Faschismuskritik 1933 bis 1945“, vgl. Seite 28.
3 Die Anordnung ist u.a. abgedruckt bei Naumann, Anhang, Seite 402.
4 vgl. dazu auch Patricia Meyer Spacks, die zur Absicht der Satire anmerkt, dass nur das den Namen Satire verdiene, was den Leser betroffen mache und ein aktivierendes Gefühl des Unbehagens bewirke; was nur die schon Überzeugten bestärkt, sei Pseudosatire. Spacks, „Some Reflections on Satire“.
5 vgl. dazu das Nachwort von Uwe Naumann in Lucas, „Teure Amalia, vielgeliebtes Weib“, S. 195.
Häufig gestellte Fragen zum Text
Worum geht es in der Einleitung?
Die Einleitung thematisiert die Kritik an der nationalsozialistischen Diktatur, die hauptsächlich im Ausland entstand. Exilierte Schriftsteller und Intellektuelle konnten von dort das Geschehen im Deutschen Reich beobachten und kommentieren. Eine Herausforderung war es, die Kritik zurück in die Heimat zu tragen. Der Auslandsdienst der BBC bot hierfür eine gute Möglichkeit. Robert Lucas' "Briefe des Gefreiten Adolf Hirnschal" werden als satirische Faschismuskritik vorgestellt, die im historischen Kontext der BBC-Sendungen eine Bedeutung hatte.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, einen Arbeitsbegriff für Satire im Nationalsozialismus zu formulieren. Es soll untersucht werden, was Satire in diesem speziellen Kontext bedeutet, welche Voraussetzungen sie hatte, mit welchen Schwierigkeiten sie konfrontiert war und welche Wirkung sie erzielen konnte.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit besteht aus zwei Teilen: Zuerst wird ein Arbeitsbegriff für Satire im Nationalsozialismus formuliert. Im zweiten Teil werden einige "Hirnschal"-Briefe analysiert, um zu untersuchen, wem der Angriff in den Briefen gilt und welche Wirkung damit erzielt werden soll. Dabei wird besonders auf die satirischen Mittel geachtet, die Lucas verwendet, um Kritik am Faschismus zu üben.
Warum wurden nicht alle Briefe analysiert?
Nicht alle Briefe konnten analysiert werden, da nach dem Krieg keine vollständige Archivierung der über 100 Sendungen vorgenommen wurde. Lediglich 53 Briefe sind in Buchform erschienen, die teilweise gekürzt und redaktionell überarbeitet wurden. Aus diesen Briefen wurden repräsentative Beispiele für die Analyse ausgewählt.
Welches Zitat von Walter Benjamin wird in der Einleitung erwähnt?
Das Zitat von Walter Benjamin lautet: „Nur nebenbei sei angemerkt, dass es fürs Denken gar keinen besseren Start gibt als das Lachen. Und insbesondere bietet die Erschütterung des Zwerchfells dem Gedanken gewöhnlich bessere Chancen dar als die der Seele“ (1934).
Was wird unter einem "Arbeitsbegriff" für Satire verstanden?
Ein "Arbeitsbegriff" wird gewählt, weil es keine allgemeingültige Definition von Satire gibt. Satire ist immer abhängig vom historischen Kontext, in dem sie entsteht. Sie arbeitet mit Mitteln der Indirektheit, um Personen oder gesellschaftliche Zustände zu kritisieren, und diese Indirektheit muss vom Publikum verstanden werden.
Welche drei konstitutiven Elemente von Satire werden nach Jürgen Brummack genannt?
Jürgen Brummack nennt drei konstitutive Elemente von Satire: ein psychologisches, individuelles Moment (persönlicher Hass, Wut), ein soziales Element (Angriff mit dem Ziel, etwas gesellschaftlich zu bewirken) und eine ästhetische Komponente (konkrete Ausführung der Satire mit bestimmten Mitteln).
Wie wurde die Satire im Nationalsozialismus erschwert?
Die Satire wurde durch den Terror der Nazis äußerst erschwert. Seit 1941 waren satireähnliche Produktionen im Deutschen Reich grundsätzlich verboten. Kritiker des Regimes befanden sich in einer lebensgefährlichen Situation.
Welche Rolle spielte der BBC?
Robert Lucas hatte den Vorteil, für seine Arbeit den deutschen Service des BBC in Anspruch nehmen zu können. Die Hirnschal-Briefe wurden zwischen 1949 und 1945 regelmäßig ausgestrahlt und erreichten schätzungsweise zehn Millionen Zuhörer im Deutschen Reich.
Wie war die Situation der Volksempfänger im Deutschen Reich?
Zwischen 1933 und 1943 wurden ca. 4,3 Millionen Volksempfänger und 2,8 Millionen Deutsche Kleinempfänger produziert und im Umlauf gebracht. Trotz des Verbots, ausländische Sender abzuhören, verfolgten viele Menschen die Sendungen der BBC.
- Quote paper
- Miriam Kruppa (Author), 2001, Satire und Nationalsozialismus. Die Briefe des Gefreiten Adolf Hirnschal an seine Frau Amalia, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106228