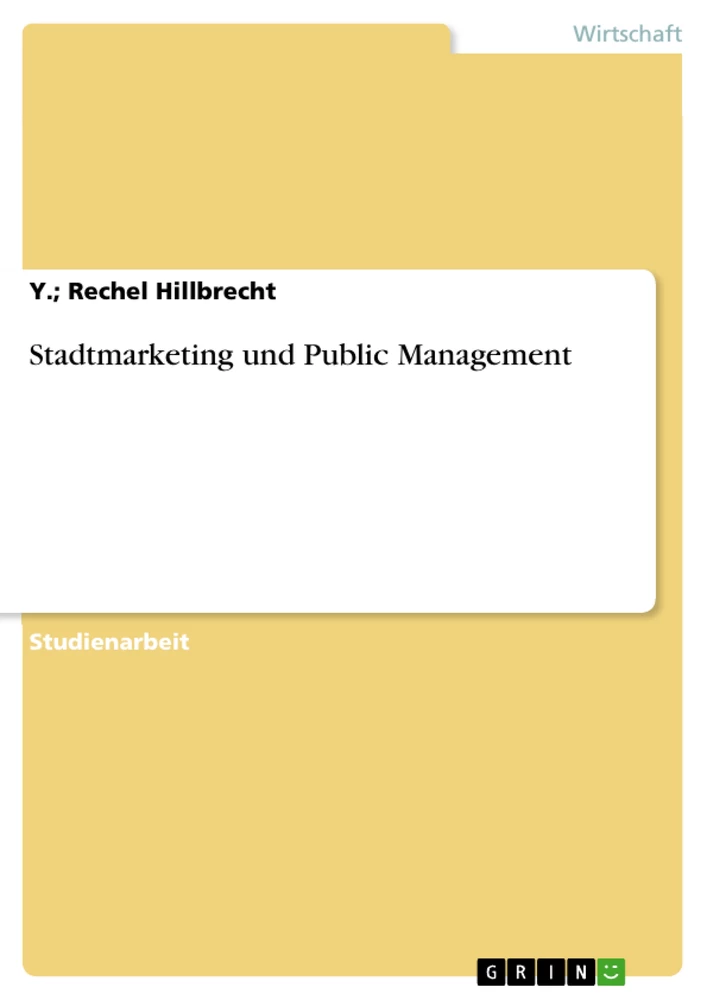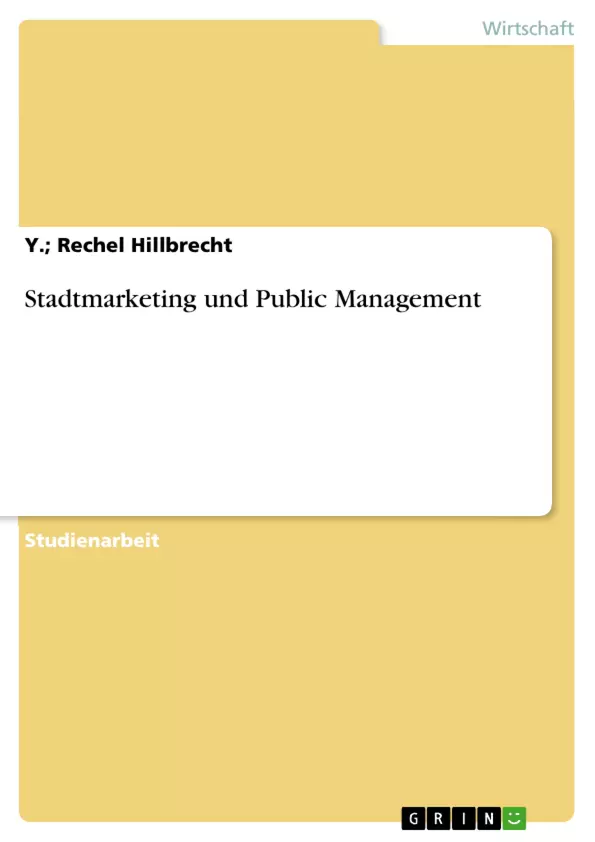Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Stadtmarketing
2.1. Ursachen und Gründe für Stadtmarketing
2.2. Was ist Stadtmarketing?
2.3. Ziele und Aufgaben des Stadtmarketing
2.4. Ablauf eines Stadtmarketingprozesses
2.5. Die Institutionalisierung
2.6. Nutzenaspekte von Stadtmarketing
2.6.1. Kommunikation und Kooperation
2.6.2. Kommunalpolitik und -verwaltung
2.6.3. Wirtschaft
2.6.4. Bürger
2.7. Stadtmarketing - Zukunft der Städte?
3. Public Management
3.1. Begriffsabgrenzung "Public Management", " New Public Management", "Neues Steuerungsmodell"
3.2. Hintergründe des Reformmodells
3.3. Entstehungsgeschichte des Public Management
3.4. Merkmale und Absichten der Neuorganisation
3.5. Ziele des Public Management
3.5.1. Das Programm der Bundesrepublik von 1999
3.6. Bisherige Veränderungen durch das Neue Steuerungsmodell
3.7. Zusammenfassung zum Public Management
4. Zusammenhang zwischen Stadtmarketing und Public Management
5. Zusammenfassung
6. Literatur- und Quellenverzeichnis
1. Einleitung
Das Thema "Stadtmarketing" ist ein breites Gebiet, das in den letzten Jahren immer geläufiger wurde. Bei der Recherche im Internet erscheinen unter dem Stichwort "Stadtmarketing" Tausende Beispiele - fast alle Seiten sind von Städten, Gemeinden oder Orten aufgebaut worden - man bekommt den Eindruck, dass heutzutage in jedem Dorf Stadtmarketing betrieben wird. Stadtmarketing wird häufig von den Stadtverwaltungen oder Kommunen selbst betrieben, und man stößt dann bei Untersuchungen und Nachforschungen zum Thema leicht auch auf den Begriff "Public Management".
Um diese Begriffe besser zu verstehen, haben wir uns in dieser Arbeit mit den Begriffen "Stadtmarketing" und "Public Management" auseinandergesetzt, und versucht, eine Verbindung zwischen beiden Begriffen herzustellen und zu beschreiben. Da die Aufgabenstellung nicht konkretisiert ist, werden wir die Begriffe einzeln erklären und zum Abschluss den Zusammenhang zwischen beiden darstellen.
Diese Arbeit basiert hauptsächlich auf zwei Büchern, "Stadtmarketing und kommunales Audit", herausgegeben von Pfaff-Schley, erschienen 1997 im Springer Verlag und "Stadtmarketing im Kontext eines Public Management" von Angela Wiechula, erschienen 2000 im Kohlhammer Verlag. Letzteres wurde uns als Quelle angeraten. Außerdem haben wir weitere Literatur hinzugezogen und auch einige Quellen aus dem Internet verwendet.
2. Stadtmarketing
2.1. Ursachen und Gründe für Stadtmarketing
Stadtmarketing hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die Ursachen hierfür liegen darin, dass der Druck auf die Städte immer größer wird. Fast jede Stadt betreibt Stadtmarketing. Es vollzog sich ein Strukturwandel. Die Märkte unterliegen der Globalisierung und Städte sind von demographischen Problemen geprägt (z. B. Abwanderung). Weiterhin leiden Städte unter Imageprobleme und es herrschen Konflikte zwischen wichtigen Gruppen in der Stadt vor.1 Die Bürger sind zunehmend unzufrieden, so dass die Kaufkraft sinkt. Der Wettbewerb hat sich also verschärft, und zwar (regional, national und international), zwischen den Städten und den umliegenden Standorten ebenso wie zwischen Innenstädten und Stadtteilen.
Die Reaktion auf diese Situation ist die zunehmende Marketingorientierung der Städte. Es gilt, die Stadt zu stärken, sie als ein Kultur- und Bildungszentrum, Veranstaltungsort und ein Touristenziel zu fördern. Sie als Versorgungsmittelpunkt für Waren und Dienstleistungen zu positionieren und natürlich auch die endogenen und exogenen Faktoren einer Stadt zu befrie digen. Dazu gehören die Einkaufskunden, die Bürger, die Besucher, Gäste und Unternehmen.2
2.2. Was ist Stadtmarketing?
Stadtmarketing ist ein modernes Managementinstrument für eine ganzeinheitliche und optimale Stadtentwicklung. Es ist ein nie endender Kommunikationsprozess, der sich an inneren und äußeren (exogene und endogene Faktoren) Zielgruppen, Wettbewerbsstädten und eigenen Zielen der Stadt orientiert. Im Mittelpunkt steht die Stadt.3 Der Begriff des Stadtmarketings ist jedoch nicht eindeutig definiert.
Es unterliegt einer Begriffsvielfalt und damit Abgrenzungsproblemen. Eine Definition lautet wie folgt:
"Als Stadtmarketing wird der geplante Prozess und die Summe aller Aufgaben und Aktionen bezeichnet, mit dem erfolgreiches Interessenmanagement im Unternehmen Stadt geleistet wird. Stadtmarketing gibt die Möglichkeit, in einem geordneten, offenen Verfahren aus individuellen Wünschen, Zielen und Interessen durch offene Kommunikation die gemeinsamen Visionen und die Ziele für die Entwicklung des Unternehmens Stadt zu vereinbaren. Auf der Basis dieser gemeinsamen Ziele ist für jeden einzelnen Entscheider individuelles, jetzt aber abgestimmtes Handeln möglich." 4
Stadtmarketing ist ein komplexes Beziehungsgeflecht mit unterschiedlichen Interessen. Dieser Fakt stellt an das Stadtmarketing sehr hohe Anforderungen, damit es zu einem Austausch der Akteure im Stadtmarketing kommt bzw. sich verbessert und damit die Vorstellungen der Akteure besser koordiniert werden können.5 Wie bereits schon erwähnt, ist das Stadtmarketing ein permanenter Prozess, der sozusagen wie eine Spirale organisiert ist. Diese Spirale wird von den folgenden 10 Komponenten geprägt:
- Kundenorientierung, welches die Richtlinie für alle Aktivitäten darstellt.
- Kommunikation, womit die Austauschprozesse nach innen und außen gemeint sind
- Konsens, d.h. es ist ein möglichst weitgehender Konsens anzustreben, denn es ist die Voraussetzung für das Leitbild, die Identifikation und die Maßnahmen-Planung.
- Koordination, welche die organisatorische Grundvoraussetzung darstellt und die Kräfte bündelt.
- Kooperation, die Synergieeffekte freisetzt und die Prozesse stärkt.
- Kreativität, d.h. alte Strukturen brechen und innovative Wege und Maßnahmen finden.
- Konzeption, d.h. klare Ziele und organisiertes Vorgehen.
- Kampagne, welche die Maßnahmen umsetzt.
- Kontinuität, was langfristige Strategie und Ausdauer bedeutet.
- Kontrolle bzw. Erfolgskontrollen!6
2.3. Ziele und Aufgaben des Stadtmarketing
In erster Linie möchte das Stadtmarketing die Sichtweise aktivieren und fördern, dass Tätigkeiten der städtischen Akteure sich umfassend am Kunden und auf den Kunden orientieren müssen. Die Grundfragen heißen somit "Was will der Kunde?" (Orientieren am Kunden) und "Was bieten wir dem Kunden schon an und was fehlt?" (Orientieren auf den Kunden). Der Begriff Kunde umfasst auf der einen Seite die internen und auf der anderen Seite die externen Kunden.
Die internen Kunden sind die Bürger und die einheimische Wirtschaft. Die externen Kunden stellen die Touristen, potentielle Einzelhandels- und Dienstleistungskunden und Investoren dar. Die folgende Grafik gibt einen anschaulichen Überblick über die Kunden des Stadtmarketing:7
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Stadtmarketing muss zuerst seine Hauptziele definieren, damit Synergien und Konflikte sichtbar werden können. Durch das Hauptziel bildet man ein Leitbild für die Stadt, welches die Basis für das Stadtmarketing darstellt. Nachdem man das Hauptziel definiert hat, werden die Teilziele überlegt und man erstellt einen Maßnahmenkatalog.
Die Stadt soll als einzigartig und unverwechselbar dargestellt werden (USP = Unique Selling Proposition), um sich von anderen Städten abzuheben.
Die typischen Ziele eines Stadtmarketing sind:
- Steigerung der Attraktivität
- bessere Positionierung gegenüber Wettbewerbern
- Verbesserung des Image
- Zufriedenheit der "Kunden" steigern
- Identifikation der Bürger mit "ihrer Stadt"
- Innenstadtbelebung, Kaufkraft erhöhen
- Erschließung von Entwicklungspotentialen
- bessere Nutzung städtischer Ressourcen
- Zusammenarbeit zwischen Handlungsträgern verbessern
- Aufbau von innerstädtischen Netzwerken
- Einbindung öffentlicher und privater Akteure in die Stadtentwicklung8
2.4. Ablauf eines Stadtmarketingprozesses
Die Basis für einen Stadtmarketingprozess stellt die Situationsanalyse. D.h. man nimmt eine Standortuntersuchung vor und entwickelt ein Stärken / Schwächen - Profil.
Die erste Phase, genannt Konzeptionsphase, beinhaltet die Leitbild- und Zieldiskussion. Auch werden schon hier erste Maßnahmen festgelegt, um somit zu versuchen, zügig erste sichtbare Erfolge zu erzielen. Somit würde sich die Akzeptanz bei den Kunden erhöhen. Die Öffentlichkeitsarbeit sollte hier nicht vergessen werden.9
Die zweite Phase ist die Strategieentwicklung. Hier werden die Zielgruppen, für die man eine Verbesserung erreichen will, und auch die Wettbewerber bestimmt. In dieser Phase ist es ratsam, gezielt Fachleute mit ein zubinden, z. B. das Fremdenverkehrsbüro. Die Finanzierung muss geklärt und der organisatorische Rahmen festgelegt werden.
Die dritte Phase, die Maßnahmenplanung, beinhaltet, wie die Bezeichnung der Phase schon aussagt, die konkrete Planung der Maßnahmen in bestimmten Handlungsfeldern. Typische Handlungsfelder sind Verkehr, Tourismus, Umwelt, Kultur, Wirtschafts-förderung, etc. Beispiele für Maßnahmen können sein:
- einheitliche Öffnungszeiten der Geschäfte in der Innenstadt
- Veranstaltung von Märkten parallel zu Kulturveranstaltungen
- gemeinsamer Lieferservice der Innenstadthändler
- Einrichtung von Stadtrundgängen nach Themen10
Die Planung schließt ebenfalls den Einsatz des Marketingmix mit ein. Das Marketingmix ist das Zusammenspiel einzelner Marketinginstrumente, d. h. die Produktpolitik, Kommunikationspolitik, Kontrahierungspolitik und die Distributions-politik. Weiterhin müssen die Instrumente weiter in Einzelinstrumente aufgeteilt und miteinander verbunden werden. Die folgende Abbildung zeigt eine mögliche Strukturierung des Stadtmarketingmix:11
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die vierte Phase beschreibt die Umsetzung der Maßnahmen. Diese Phase hat eine entscheidende Bedeutung. Hier lauten die Stichworte: Zeitplanung, Finanzmanagement, personelle Verantwortung und Planung, Organisation und Umsetzung der Aktivitäten.
Die letzte Phase beinhaltet das Controlling, nämlich das Erfolgs- und Finanzcontrolling. Gleichzeitig wird ein Follow-up und Abweichungsanalyse erstellt. Sollte es Abweichungen, Änderungen oder Fehler geben, wird erneut eine Situationsanalyse erstellt, die Strategien modifiziert und die Maßnahmen erneut geplant und umgesetzt.12 Die genannten Phasen könnte man wie folgt auch in drei Phasen zusammenfassen13:
Konzeptionsphase:
- Situationsanalyse
Konkretisierungsphase:
- Zielformulierung
- Strategieentwicklung
Realisierungsphase:
- Maßnahmenplanung
- Maßnahmenumsetzung
- Controlling
2.5. Die Institutionalisierung
Es gibt drei Einrichtungen, die am Anfang die Organisations- und Koordinationsfunktion übernehmen. Zu diesen zählt das städtische Amt, welches meist das Amt für Wirtschaftsförderung ist, ein informeller Arbeitskreis, wo die Stadtverwaltung vertreten ist und ein externes Beratungsbüro.
Nach der Konzeptionsphase , d.h. in der Umsetzungsphase, sind die häufigsten Formen der Institutionalisierung die Stadtverwaltung, GmbH oder der Verein. Letztendlich kann man jedoch sagen, dass es keine richtige bzw. perfekte Lösung gibt, denn man muss jeweils im Einzelfall darüber entscheiden, welche Form der Institutionalisierung die optimale wäre.
In der Praxis sind häufig Mischungen aus mehreren Formen vorzufinden. Man versucht, die Vorteile einer GmbH, welche durch eine effiziente und wirtschaftliche Umsetzung charakterisiert ist, mit den Vorteilen eines Vereins, der durch Offenheit, die für einen langlebenden Stadtmarketing-Prozess wichtig ist, gekennzeichnet ist, zu verbinden. Jedoch ist die Eignung der Persönlichkeiten von größerer Bedeutung, als die Form der Institutionalisierung, denn sie stellt nur den Rahmen.14
2.6. Nutzenaspekte von Stadtmarketing
Stadtmarketing hängt von vielen Akteuren mit unterschiedlichen Interessen, die Zeit und sogar auch Geld aufbringen müssen, ab. D.h. Stadtmarketing muss "etwas bringen"! Allerdings ist der Nachweis über erfolgreiche Arbeit in dem Sinne schwer aufzuzeigen. Jedoch gibt es Nutzenaspekte, die ich näher beleuchten möchte.
2.6.1. Kommunikation und Kooperation
Durch ein Stadtmarketing werden diese beiden Aspekte gefördert bzw. verbessert. Die Beteiligten führen direkt ein Interessen- und Konfliktmanagement. Es gibt keinen Austausch über die Presse, sondern direkt in den Arbeitsgruppen. Es entsteht somit eine Vertrauensbasis.
2.6.2. Kommunalpolitik und -verwaltung
Die Politik und Verwaltung profitieren vom Stadtmarketing, wenn sie die Facharbeitskreise des Stadtmarketing nicht als Konkurrenten sondern als Entscheidungsvorbereitung sehen. Durch organisie rte Gespräche mit den Interessengruppen hat die Stadt die Möglichkeit, ,,kundenorientierter" zu agieren.
2.6.3. Wirtschaft
Der Auslöser für ein Stadtmarketing ist meistens der Handel. Sie sorgen sich um die Lebendigkeit der Innenstadt. Ein Stadtmarketing stellt für die Wirtschaft die Gelegenheit, mit ihr direkt ins Gespräch zu kommen und auf die Stadtentwicklung Einfluss zu nehmen. Die Gewerbetreibenden können sich an der Entstehung der Entwicklungsziele und Maßnahmenplanung und -umsetzung beteiligen. Durch ein Stadtmarketing würde sich die Kaufkraftbindung erhöhen.
2.6.4. Bürger
Die Bürger stellen das endogene Potential einer Stadt dar. Sie gehören zu den "Kunden" des Stadtmarketing, die angesprochen werden. Die Bürger werden im Stadtmarketing voll mit eingebunden und permanent informiert.15
Weitere Erfolgsfaktoren des Stadtmarketings zeigt die folgende Übersicht:16
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.7. Stadtmarketing - Zukunft der Städte?
Stadtmarketing wird oft auch als Citymanagement bezeichnet, welches jedoch eher ein modisches Schlagwort ist. Das Stadtmarketing ist ein Teil einer langfristig angelegten Stadtkonzeption. Die Stadt ist ein offenes System, das in gesellschaftliche Regeln und Werte eingebunden ist. Das bedeutet, dass kurzfristige Handlungsansätze keine Chance haben. Die Anforderungen an Städte wachsen und der Wettbewerb zwischen Städte ist spürbar. "Wer heute als Stadt einen ganzeinheitlichen Stadtmarketingansatz verfolgt, hat kurzfristig einen Wettbewerbsvorteil und langfristig eine positive Entwicklungschance." 17 D.h. dass das Stadtmarketing in Zukunft immer wichtiger und vor allem zu einer Pflicht wird, um auf den Markt bestehen zu können - jedoch nur mit einer langfristigen Strategie.18
3. Public Management
Nicht nur in Deutschland hat man inzwischen erkannt, dass kommunale Verwaltungen überorganisiert sind, ineffizient arbeiten und die Einstellung der Mitarbeiter zum Bürger eine Überarbeitung benötigt. Der Bürger wird in Verwaltungen jeglicher Art - sei es bei der Beschaffung eines neuen Personalausweises, bei der Zulassung eines Fahrzeuges oder bei sonstigen Verwaltungsangelegenheiten - oft als "Störenfried" angesehen bzw. bekommt das Gefühl, ein solcher zu sein. Verwaltungsabläufe dauern lange und sind nicht effizient. Weltweit wurde deshalb vor einigen Jahren begonnen, die öffentlichen Verwaltungen, Gemeinden, Städte und auch ganze Staaten umzuorganisieren, um die bestehenden Probleme zu lösen oder zumindest zu verbessern.
Diese Umstrukturierung wird international als "Public Management", "New Public Management", in Deutschland als "Neues Steuerungsmodell" bezeichnet, worauf wir im Folgenden näher eingehen.
3.1. Begriffsabgrenzung "Public Management", "New Public Management", "Neues Steuerungsmodell"
Bei den Recherchen für diese Arbeit sind wir auf Beiträge zu allen drei Begriffen gestoßen, wobei in Deutschland der Begriff "Neues Steuerungsmodell" vorherrscht. Wiechula grenzt die Begriffe "New Public Management" und "Public Management" gegeneinander in "Stadtmarketing im Kontext eines Kontext Management", S. 3, von dem von ihr behandelten Publik Management insofern ab, dass
" New Public Management bezieht sich in der internationalen Debatte flächendeckend auf Reformmaßnahmen von Staat und Verwaltungen. Publik Management zielt auf die Steuerung des internen Verwaltungsbereiches, resultierend aus der Mikroökonomisierung desöffentlichen Sektors, allerdings unter ausdrücklicher Einbeziehung der Einbindung in das Gesamtgefüge von Politik und Verwaltungsumfeld ab (vgl. Budäus 1995b, S. 47)."
Diese Abgrenzung erscheint uns auch deshalb nicht schlüssig, weil laut Online- Verwaltungswörterbuch19 der Begriff "New Public Management" in Deutschland als "Neues Steuerungsmodell" in Abgrenzung zum englischen Begriff definiert ist.
Das Neue Steuerungsmodell ist ein umfassendes Modell zur Steigerung von Effektivität, Bürgerorientierung und Effizienz bzw. Wirtschaftlichkeit von Verwaltungsbereichen. Die Steigerung soll u. a. durch Deregulierung, Dezentralisierung, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Kontraktmanagement und vor allem durch die Führung der Verwaltungen als Konzern erreicht werden.20 Nach unserem Verständnis ist hier kein wesentlicher Unterschied zur Definition von Wiechula, S. 3 zu finden:
"... Public Management, das vor dem Hintergrund privatwirtschaftlicher Managementerfahrungen die Einführung von Dezentralisierung, Deregulierung und Delegation in der kommunalen Verwaltung postuliert, um so eine intensive Kundenorientierung der kommunalen Leistungsprozesse und eine Stärkung des Wettbewerbsgedankens zu erreichen.".
Außerdem sagt die Autorin auf S. 68 dass die Begriffe in der deutschen Literatur synonym verwendet werden und gleichgesetzt werden mit dem von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle in Köln entwickelten Neuen Steuerungsmodell21. Wir haben deshalb alle Begriffe als gleichrangig eingestuft und bei der Recherche benutzt und werden sie in dieser Arbeit synonym benutzen.
3.2. Hintergründe des Reformmodells
Wie eingangs erwähnt, haben sich die Zustände in den Verwaltungen und die Ansprüche an Verwaltungen in den letzten Jahren geändert. Nationale Regierungen sind durch die zunehmende Globalisierung immer öfter auf die Zusammenarbeit mit externen Partner (extern sowohl im Sinne von außerhalb der Regierung als auch außerhalb des eigenen Landes) angewiesen. Die steigende internationale Abhängigkeit, neue technische Entwicklungen und die wachsende Bedeutung internationaler Vereinigungen (wie z. B. UNO und NATO) macht Regierungsverwaltungen zunehmend komplexer und multi-dimensionaler als je zuvor.
Außerdem haben viele Verwaltungen durch allgemeine Dezentralisation mehr Autonomie bekommen, und nicht-staatliche Organisationen und Bürgerinitiativen üben einen zunehmenden Druck in politischen Diskussionen aus, stellen mehr und höhere Anforderungen auch an Serviceleistungen der Verwaltungen. Viele früher staatliche Unternehmen sind privatisiert worden.22 Aus diesen Veränderungen mussten Konsequenzen gezogen werden, die zur Entwicklung des Neuen Steuerungsmodells bzw. des Public Management führten.
3.3. Entstehungsgeschichte des Public Management
1991 wurde von der KGSt der erste Bericht zum Neuen Steuerungsmodell vorgelegt. Dieses Modell ist ein international diskutiertes und verwendetes Konzept, das in Deutschland zunächst für die Kommunalverwaltung entwickelt wurde, wobei die KGSt23 maßgeblich beteiligt war. Laut Kurzdefinition im Online-Verwaltungslexikon ist es ein
"Umfassendes Modell zur Steigerung von Effektivität , Bürgerorientierung und Effizienz / Wirtschaftlichkeit u.a. durch Deregulierung , Dezentralisierung , Kosten- und Leistungsrechnung , Controlling , Kontraktmanagement und durch die Führung der Verwaltungsbereiche als Konzern ." 24
Dem ersten Bericht von 1991 folgten weitere, und es wurde eine bemerkenswerte Verwaltungsreform in Deutschland ausgelöst. Inzwischen gibt es kaum noch Kommunen, die nicht versuchen, sich in dieser Richtung weiterzuentwickeln - Bund und Länder ziehen nach25, und inzwischen ist das Modell für alle Verwaltungsbereiche einschließlich der Bundesverfaltung als Reformmodell akzeptiert worden.
Begriffe und Elemente werden allerdings zum Teil unterschiedlich verwendet. Sowohl als ein übergeordnetes Konzept als auch als ein Teil des Public Management kann das Konzept des "Aktivierenden Staates" angesehen werden, das von der rot-grünen Bundesregierung 1999 zum Leitbild für die Modernisierung von Staat und Verwaltung erklärt wurde.26
Definition "Aktivierender Staat"
Der aktivierende Staat ist ein Konzept einer "neuen Verantwortungsteilung zwischen Staat und Gesellschaft", das der Selbstregulierung Vorrang vor staatlicher oder hierarchischer Steuerung oder Aufgabenübernahme einräumt.
Im Verhältnis des Staates zur Gesellschaft bedeutet es die Weiterentwicklung des Gedankens der Subsidiarität der katholischen Soziallehre: Begrenzung staatlicher Regulierung zugunsten gesellschaftlicher Kräfte (der Einzelne, Gruppen, Verbände), ggf. Unterstützung dieser Aktivitäten.
Auch intern (innerhalb der Exekutive) gilt der Vorrang der Selbstregulierung, z.B. durch die Aufstellung von Zielvereinbarungen, oder umfassender durch das Neue Steuerungsmodell.27
3.4. Merkmale und Absichten der Neuorganisation
Wie man aus der Entstehung des Public Management ersehen kann, bezieht sich die Debatte auf den öffentlichen Sektor, dessen Zusammensetzung aus der folgenden Grafik ersichtlich ist:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Wiechula, Stadtmarketing im Kontext eines Public Management, S. 68
Reformen in Richtung des Public -Management-Modells können hier zur Überwindung zentralistischer, undemokratischer und ineffizienter Strukturen beitragen. Mehr kommunale Selbstverwaltung soll auch mehr Bürger- und Problemnähe bedeuten, eine größere Effizienz und eine bessere Kontrolle politischer Macht. Allerdings tun sich die Verwaltungen schwer, sich von den alten Strukturen zu verabschieden und neue Wege einzuschlagen. Das PublicManagement-Konzept zielt vor allem auf die Umstrukturierung der in letzter Zeit in die Kritik geratenen veralteten Verwaltungsstrukturen und -prozesse ab.
Bei der Optimierung der kommunalen Leistungen sind die hierarchischen Organisationsform und das kameralistische Finanzierungsprinzip große Hindernisse, die durch eine Umstellung in Richtung des Public Management verkleinert werden sollen. Hauptsächlich geht es bei den Umstrukturierungsmaßnahmen zum Public Management um die Sparte der öffentlichen Verwaltungen in obigem Schaubild.
Im Bereich der öffentlichen Unternehmen sind in den letzten Jahren zunehmend Privatisierungen vorgenommen worden, was einen großen Beitrag zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit getan hat. In der Bremer Praxis erlebt man dies bei den ehemaligen Stadtwerken, der swb Enordia, wo man telefonisch rasche und gute Auskünfte bekommt.
Ein Gegenbeispiel ist allerdings die Deutsche Post AG, wo bisher kaum eine Besserung festgestellt werden kann - die Verfahren, z. B. beim Versand von Katalogen per Infopost - sind kompliziert, die Mitarbeiter selten hilfsbereit und wenig Kundenfreundlich. In der Kleinstadt Achim bei Bremen ist das örtliche Krankenhaus in eine private Aktiengesellschaft umgewandelt worden - diese nur als einige Beispiele für den Strukturwandel.28
Diese und auch die öffentlichen Vereinigungen und Non-Profit-Organisationen sind allerdings nur am Rande betroffen bzw. Ziel der derzeitigen Diskussion.
Ein Aspekt für die Umstrukturierung der öffentlichen Verwaltungen ist die finanzielle Problematik, die vom Online-Verwaltungslexikon wie folgt darstellt wird:
"Die finanzielle Situationen deröffentlichen Verwaltungen sind in weit geringerem Maße durch interne Rationalisierung beeinflussbar als vielfach vermutet wird. 1999 betrug der Anteil der Personalausgaben am Haushalt des Bundes nur ca. 10 % 29 Der Anteil der Personalausgaben am Haushalt des Bundes betrug 1999 nur etwa 10%. Das Hausaltsdefizit kann also nicht durch Personalabbau behoben werden. Drastisch gestiegen sind vor allem die Einkommensübertragungen durch den Staat (um 420% innerhalb von 40 Jahren 30 ).
Die Gesamtbilanz ist allerdings Besorgnis erregend: die Verschuldung nährt sich selbst 31, weshalb es nicht einmal ausreicht, die Netto-Neuverschuldung zu stoppen. Allerdings erfordert eine rationale Politik dass dort Lösungen gesucht werden, wo sie auch gefunden werden könnten. Personalabbau kann dazu nur begrenzt beitragen, und Personalabbau ohne Reduzierung der Aufgaben erreicht eher das Gegenteil." 32
Dies ist aber nur ein Aspekt, den Wiechula (S. 68) zusammen mit den folgenden als zentrale Anliegen des Public Management auf Grundlage von Reichhard33 zusammenfasst:
- Konzentration auf ein professionelles und verantwortungsbewusstes Management mittels des Einsatzes privatwirtschaftlicher Managementinstrumente und -praktiken
- Anwendung von Instrumenten und Standards der administrativen Leistungsmessung und Output-Kontrolle
- Disaggregation, Verselbständigung und Dezentralisation von Verwaltungseinheiten
- Stärkung des Wettbewerbsgedankens (intra- und interkommunal, extern mit der Privatwirtschaft)
- Größere Disziplin und Sparsamkeit in der Ressourcennutzung ·
Diesen Vorhaben stehen die in den Verwaltungen vorherrschenden Strukturen entgegen, die Wiechula, S. 69, mit Bezug auf Krajinski34 wie folgt darstellt:
- Kommunalverwaltungen basieren auf einem staatlichen Auftrag und sind deshalb von der Zufriedenheit ihrer Kunden - im Unterschied zu privatwirtschaftlichen Organisationen - nur wenig abhängig.
- Kommunalverwaltungen sind heterogene Systeme, die für die Bürger nur schwer zu überschauen sind. Die Heterogenität betrifft die vielen Prozesse und Ziele ebenso wie die verschiedenen Kundengruppen.
- Die Struktur der Kommunalverwaltungen, die aus kooperativen und organisatorischen Beziehungen zwischen ihren Elementen besteht, erforderte eine entsprechende Ausrichtung auf den Systemzweck.
Die Auswirkungen dieser Merkmale betreffen hauptsächlich den Bürger, der als Kunde der öffentlichen Verwaltungen angesehen werden kann. Im Gegensatz zu bisher angestrengten Reformen in den Verwaltungen, die sich hauptsächlich auf Kostentransparenz und Sparmaßnahmen bezogen, wurde dies nicht berücksichtigt.35 Das Public Management soll dies ändern und den Kunden als Ziel von Reformmaßnahmen mehr in den Vordergrund rücken.
3.5. Ziele des Public Management
Die Ziele des Public Management kann man wie folgt kurz beschreiben:
- Mehr Leistung
- Weniger Kosten
- Bürgerfreundlichere Verwaltung mit mehr Bürgerorientierung und Transparenz
- Höhere Mitarbeiterzufriedenhe it, motivierte Beschäftigte36
Konkreter bedeutet dies eine Verbesserung der Dienstleistungen für die Bürger mit mehr Serviceorientierung, Bürgernähe und verstärktem Gedanken an Marketing. Auch soll die Dezentralisierung der Verwaltungsorgane fortgesetzt werden, d. h., die einzelnen Kommunen sollten mehr Handlungsfreiheiten bekommen und selbst auch umdenken und sich z. B. dem Wettbewerb mit privaten Anbietern stellen wo es sich anbietet. Hierzu wurden von der KGSt, die in Deutschland hauptverantwortlich für das Public Management bzw. das Neue Steuerungsmodell schreibt, einige Prinzipien aufgestellt, nach denen die Verwaltungen umstrukturiert werden sollen:37
1. Steuern statt Rudern:
Leistungen sind zu gewährleisten und zu kontrollieren, nicht alles ist selbst zu machen
2. Resultate statt Regeln:
Orientierung an Ergebnissen und Kosten statt Fixierung auf Verfahren und Regeln
3. Eigenverantwortlichkeit statt Hierarchie:
klare Zuweisung und ungeteilte Verantwortung für die Ressourcen
4. Wettbewerb statt Monopol:
Ermittlung von Kosten und Qualitäten öffentlicher Leistungen im Vergleich zu anderen Anbietern
5. Motivation statt Alimentation:
Neubestimmung der "Ressource Personal", die weit über eine Änderung des Dienstrechts hinausgeht
Um diese Prinzipien zu verstehen, möchten wir eine von Wiechula gemachte Aufstellung der Unterschiede zwischen Kommunalen Verwaltungen und Privatwirtschaftlichem Management an dieser Stelle übernehmen, da sie eine kurze aber prägnante Gegenüberstellung der Problematik darstellt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Wiechula, Stadtmarketing im Kontext eines Public Management, 2000, S. 64
Wie aus dieser Aufstellung sehr gut zu erkennen ist, differieren die Strukturen in Kommunalverwaltung und Privatwirtschaft sehr stark. Es sind deshalb einige Reformmaßnahmen in Angriff genommen worden, um diese veralteten Strukturen zu durchbrechen. Es handelt sich hierbei um Dinge, die in den althergebrachten Verwaltungsstrukturen nicht vorhanden waren.
Im einzelnen sieht dies in den verschiedenen Bereichen wie folgt aus:
1) Aufgaben (Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft): Beschränkung auf Kernaufgaben:
- (materielle) Privatisierung
- Deregulierung und Stärkung des Freiraums gesellschaftlicher Akteure
- Förderung gesellschaftlicher Aktivitäten, auch als Ersatz staatlicher Aktivitäten
2) Struktur (Innenverhältnis)
- Neue, klare Rollenverteilung zwischen Politik und Verwaltung
- Dezentralisierung
- Einheit von Fach- und Ressourcenverwaltung
- Eigenverantwortung/Delegation
3) Verfahren
- Budgetierung
- Kosten- und Leistungsrechnun
- Controlling
- Berichtswesen
- Zielvereinbarung/Kontraktmanagement
- Qualitätsmanagement
- Organisationsentwicklung
4) Personal
- Qualifikation
- Anreizsysteme schaffen
- Führungssysteme
- Verwaltungsstruktur38
Diese Bereiche sollten nicht einzeln betrachtet werden, sondern als Elemente eines Systems aufeinander bezogen werden. Generell sollten die Bereiche Aufbau- und Ablauforganisation, Personalentwicklung und Management aufeinander abgestimmt werden.
Die Vernetzung der verschiedenen Elemente ist wichtig für eine solche Reform, die nur beim Zusammenfügen aller Elemente zu einem Netzwerk wirksam und dauerhaft sein kann.39
Die Umstrukturierungsmaßnahmen sollen die in folgender Tabelle, die dem OnlineVerwaltungslexikon entnommen ist, Änderungen erwirken:
[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]vom Bürokratiemodell zum Public Management
- Angebotsorientierung mit Zwangsnachfrage
- Nachfrageorientierung und Entwicklung eines "Produkt-Markt-Konzeptes"
- Ausgeprägte Hierarchisierung · Kontraktmanagement verselbständigter Organisationseinheiten
- Organisation nach Funktionen · Organisation nach Geschäftsprozessen
- normgeleitete Standardproduktion · kundenorientierte Spezialisierung
- kameralistische Prinzipien · kaufmännische Prinzipien
- Konditionalsteuerung · Ergebnissteuerung
- Gleichheit · Wirksamkeit
- Papierbindung und Aktenmäßigkeit · Informations- und Kommunikationstechnologie
- Kommunikation in festgelegten Kanälen · vernetzte Systemarchitekturen
- Alimentationsprinzip · leistungsorientiertes Entgelt
Es ist also ein sehr umfangreiches Paket, das den öffentlichen Verwaltungen in Haus steht. Da wir es für wichtig und interessant halten, dass die Bundesregierung hierzu ein Programm verabschiedet hat, geben wir hierüber einen kurzen Überblick.
3.5.1. Das Programm der Bundesrepublik von 1999
Auch in dem Programm wird festgestellt, das Gesellschaft40 und Staatsverständnis sich in den letzten Jahren stark verändert haben. Die staatlichen Strukturen müssen sich deshalb den neuen Anforderungen und Wünschen der Bürger anpassen. Die Koalitionsvereinbarung "Aufbruch und Erneuerung - Deutschlands Weg ins 21. Jahrhundert" wird hier als Zielsetzung bezeic hnet. Der aktivierende Staat soll das neue Leitbild sein. Es wurden einige Projekte zur Verwaltungsmodernisierung ins Leben gerufen, die dieses Leitbild umsetzen sollen.
Zuständig für die Durchführung und Steuerung dieser Vorhaben sind der Staatssekretärausschuss unter Leitung des Bundesministeriums des Inneren und die Stabsstelle.
Der Staatsekretärausschuss legt hierbei die Aktivitäten fest und koordiniert diese mit den Ministerien. Die Stabsstelle im Bundesinnenministerium hat dabei die Aufgabe, das gesamte Programm zur Modernisierung von Staat und Verwaltung zu koordinieren und zu fördern.
Ziel ist es, die Verwaltung bürgernah zu organisieren. Dazu soll der Staat den Bürger als Partner begreifen. Notwendig dafür ist nicht nur mehr Service, kürzere Wege und schnellere Entscheidungen, sondern auch eine neue Form des Dialogs. Der Staat soll von den Bürgern lernen, neue Informationstechnologien sollen für eine intensivere Kommunikation zwischen Bürgern und Staat genutzt werden. So könnten Ideen schneller umgesetzt werden. Auf der anderen Seite sollen die Handlungen der Verwaltungen besser verständlich und nachvollziehbar sein was bedeutet, dass der Staat den Dialog mit den Bürgern verstärkt und mehr Informationen und Wissen für alle transparent macht. Bürger und Staat sollen so zu Partnern werden.
Der "aktivierende Staat" bedeutet eine neue Verantwortungsteilung zwischen Bürger und Staat. Eigeninitiative und Freiraum sollen stärker gefördert werden. Der Staat bleibt natürlich weiterhin verpflichtet, für individuelle Freiheit und Sicherheit der Bürger zu sorgen. Das gilt zum Beispiel für Innere Sicherheit, Rechtsschutz und die Finanzverwaltung. Aber in vielen anderen Bereichen müssen öffentliche Aufgaben nicht unbedingt direkt von staatlichen Organen wahrgenomme n werden, zum Beispiel in Dienstleistungsbereichen wie Post, Kommunikation und Verkehr. Hier kann sich der Staat darauf beschränken, den Rahmen festzulegen. Bei Konflikten tritt er als Moderator auf, mit dem Ziel, mehr Freiraum für gesellschaftliches Engagement zu schaffen.
Wir können leider nicht beurteilen, in wieweit diese Vorhaben bisher durchgeführt werden, wollen aber die bei der Recherche gefundenen Ergebniskommentare im Folgenden aufführen.
3.6. Bisherige Veränderungen durch das Neue Steuerungsmodell
Dr. Rainer Heinz, Leiter des KGSt-Programmbereichs "Bürger, Politik und Verwaltung", hat Ende 2000 einige bereits durchgesetzte Errungenschaften des Public Management bzw. des Neuen Steuerungsmodells zusammengefasst.41
Demnach lässt sich allgemein eine deutliche Leistungssteigerung der Kommunen feststellen, was konkret kürzere Wartezeiten, umfassendere Informationen, verständlichere Formulare, mehr Leistungen in einem Amt u. a. bedeutet. Die Kommunen sind bürgerfreundlicher, wirtschaftlicher und effektiver geworden. Im August 2000 wurde bei einer Bürgerumfrage festgestellt, dass 41 % der Bevölkerung den Eindruck haben, dass sich die Ämter und Behörden tiefgreifend verändern und von staatlichen Bürokratien zu modernen Dienstleistern entwickeln.
Nur ein Drittel der Bevölkerung sieht die Kommunen heute noch als staatliche Bürokratie, und für 59 % sind die Kommunen auch oder sogar primär Dienstleister im Interesse der Bürger. Bemerkenswert ist, dass insbesondere Personen, die häufigen Kontakt mit Ämtern haben, festgestellt haben, dass der Service verbessert wurde und die Abläufe schneller und weniger kompliziert sind.
Obwohl noch keine Kommune in Deutschland die Verwaltungsreform voll ausgeschöpft hat, ist der Staat auf dem Weg dorthin. Einen großen Anteil an der Verwirklichung haben natürlich die Mitarbeiter der einzelnen Verwaltungsapparate, ohne deren Mitwirkung jegliche Änderungen nahezu unmöglich werden.
Es wird sich zukünftig zeigen, inwiefern die Reformen greifen werden und wie lange es dauert, bis sie sich in allen Verwaltungsbereichen durchsetzen kann.
3.7. Zusammenfassung zum Public Management
Das Thema "Public Management" hat sich als wesentlich interessanter und weitreichender herausgestellt, als wir zu Beginn dieser Arbeit angenommen hatten. In Zukunft werden wir das Thema mehr verfolgen, um besser persönlich darüber urteilen zu können.
4. Zusammenhang zwischen Stadtmarketing und Public Management
Es ist ein häufiges Argument ist, das Marketing in öffentlichen Verwaltungen unmöglich sei, da diese Verwaltungen keine Märkte haben. Damit ist die Monopolstellung der Kommunen gemeint. Im Gegensatz zu Unternehmen der freien Wirtschaft sind Verwaltungen auch nicht auf Gewinn angewiesen um überleben zu können. Allerdings findet zwischen den Kommunen und anderen Beteiligten (z. B. Bürgern, anderen Verwaltungen, Unternehmen) ein Austausch von Ideen, Waren und Dienstleistungen statt. Die Anwendung von Marketing und seine Organisation innerhalb der Kommune ist deshalb berechtigt.42
Für die Anwendung von Marketing benötigt man generell die Organisatoren und individuelle Zielgruppen. Dies lässt sich in der Privatwirtschaft eindeutig zuordnen, ebenso wie die Zielsetzung in diesen Bereich. Normalerweise wird Marketing zum Bestehen gegen die Konkurrenz angewendet. Beim Stadtmarketing steht diesem der kommunale Versorgungsauftrag gegenüber, d.h. die öffentlichen Verwaltungen "versorgen" ihre Bürger, z.B. mit den notwendigen bürokratischen Dokumenten. Dies stellt somit eine Besonderheit zum unternehmerischen Marketing dar. Ein Unternehmen kann seine Ziele bzw. sein Marketing am Markt und seiner Zielgruppe orientieren. Eine Verwaltung dagegen hat aufgrund von Beschlüssen der Bundesrepublik Deutschland eine feste Zielsetzung (öffentliche Ziele), die sie nicht frei wählen kann. Das Marketing einer öffentlichen Verwaltung ist nicht den Schwankungen des Marktes unterworfen und es müssen die verwaltungsinternen Vorschriften beachtet werden.
"Ein erfolgreiches Marketing in Kommunalverwaltungen setzt (...) voraus, dass sich die einzelnen kommunalenämter und Einrichtungen bei der Auswahl und Gestaltung der Informations- und Aktionsinstrumente des Marketing konsequent an den vorgegebenen kommunalen Aufgaben und Verwaltungszielen orientieren sowie die relevanten Rechtsvorschriften, Organisationsstrukturen und Ressourcenausstattungen (...) berücksichtigen." (Homann 1986, S.610). 43
Die Marketingaktivitäten soll einerseits kostendeckend arbeiten oder sogar Überschüsse erzielen und andererseits die optimale Bedarfsdeckung der Bevölkerung gewährleisten. Privatisierungspotentiale sind dabei sorgfältig zu prüfen. Bereiche, die für eine Privatisierung vorgeschlagen wurden oder schon privatisiert sind, sind z.B. die Abfallbeseitigung, Stadtreinigung, Energieversorgung und Gebäudereinigung.44
Mit dem Aufbau eines Stadtmarketings im Rahmen eines Public Management versucht man nicht, vorhandene Aktivitäten zu ergänzen, sondern es bedarf einer besonderen Regelung, dessen Ziele in einem besonderen Marketingmix bestimmt sind und den Bürger in den Mittelpunkt stellt.45 Das Modell des "Public Management" gibt hier Anregungen zur Realisierung, denn dadurch sollen die festeingefahrenen Strukturen der öffentlichen Verwaltung durchbrochen und neue innovative Wege und Maßnahmen gefunden bzw. umgesetzt werden.
Als Fazit kann man feststellen, dass durch ein Stadtmarketing im Rahmen des Public Managements mehr Bürgernähe und bürgerfreundliche Verwaltung realisiert werden kann. Insbesondere ist dies der Fall, wenn den Bürgern die Möglichkeit gegeben wird, am Stadtmarketing aktiv mitzuwirken. Auch muss in Betracht gezogen werden, dass die Möglichkeit für ein Stadtmarketing durch eine nach dem neuen Steuerungsmodell strukturierte Verwaltung wesentlich verbessert werden.
5. Zusammenfassung
Das Thema Stadtmarketing und Public Management hat sich als sehr umfangreich herausgestellt und es wird hierzu in den nächsten Jahren noch sicherlich viele weitere Beiträge geben. Beide Komponenten zusammenzuführen ist nicht ganz einfach, da sie sich teilweise auseinander ergeben: Stadtmarketing ist ein Ansatz, der mit zu einer Entwicklung in Richtung des Public Management an Bedeutung gewann und erst durch die neuen Strukturen und das neue Management von Verwaltungen möglich wurde. Einerseits kann man Public Management als Voraussetzung für Stadtmarketing sehen, andererseits kann auch durch das Stadtmarketing die Umstrukturierung zum Public Management in Gang gesetzt werden.
Das Thema Stadtmarketing wird heute in fast jeder Kleinstadt debattiert und entwickelt, und dies ist sicher ein wichtiger Schritt in Richtung der vollständigen Reformierung der öffentlichen Verwaltungen. Aus unserer Sicht ist dieser Ansatz des Public Managements in der heutigen Gesellschaft ein wichtiger Bereich, in dem die öffentlichen Verwaltungen noch ein langer Weg bevorsteht.
6. Literatur- und Quellenverzeichnis
Literatur:
Pfaff-Schley, H.: Stadtmarketing und kommunales Audit: Chance für eine ganzeinheitliche Stadtentwicklung, Springer Verlag, Berlin, 1997
Wiechula, A.: Stadtmarketing im Kontext eines Public Management: Kundenorientierung in der kommunalen Leistungserbringung, dargestellt am Beispiel der Stadt Potsdam, Kohlhammer Verlag, Stuttgart, Berlin, Köln 2000
Internetquellen:
Ammermann, D: www.ammermann.de/stadtmar.htm#Stadtmarketing, 04. Dez. 2001 (Stadtmarketing in der Stadt Meschede)
Krems, B.: www.olev.de, 04. Dez. 2001 (Online-Verwaltungslexikon) Stichworte: Neues Steuerungsmodell, KGSt
Rainer, H.: www.kgst.de, 08. Dez. 2000 (Verwaltungsreform: quo vadis?)
Thesing, J.: www.kas.de/publikationen/1999/standort/vorwort.html, 04. Dez. 2001 (Bürger und Kommunen im 21. Jahrhundert)
o. V. www.staat-modern.de/programm/, 04. Dez. 2001 (Programm der Bundesregierung von 1999)
o. V. www.oecd.org/oecd/pages/home/displaygeneral/ 0,3380,EN-about-notheme-9-no-no-no-0,FF.html, 04. Dez. 2001 (Organi-sation for Economic Co-Operation and Development)
[...]
1 Vgl. Pfaff-Schley: Stadtmarketing und kommunales Audit, 1997, S.5
2 Vgl. ebd. S.1
3 Vgl. ebd. S .2
4 Ebd. S. 26
5 Vgl. ebd. S.2
6 Vgl. ebd. S. 11 f.
7 Vgl. ebd. S. 3
8 Vgl. ebd. S. 4 f.
9 Vgl. ebd. S. 5
10 Vgl. ebd. S. 6
11 Vgl. ebd. S. 48 f.
12 Vgl. ebd. S. 7
13 Vgl. ebd. S. 43
14 Vgl. ebd. S. 10
15 Vgl. ebd. S. 32 ff.
16 Vgl. www.ammermann.de/stadtmar.htm; 06.12.2001
17 Pfaff-Schley: Stadtmarketing und kommunales Audit, 1997, S. 13
18 Vgl. ebd. S. 12 f.
19 Vgl. Online-Verwaltungslexikon 12/01
20 Vgl. Online-Verwaltungslexikon 12/01
21 Vgl. Wiechula: Stadtmarketing im Kontext eines Public Management, 2000, S. 68, Fußnote 43
22 Vgl. Organisation for Economic Co-Operation and Development, 12/01
23 Vgl. Online-Verwaltungslexikon, 12/01: Die KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle fürVerwaltungsvereinfachung/Verband für kommunales Management) ist eine überparteiliche kommunale Fachorganisation mit Mitgliedern (Gemeinden, Kreise, Städte, Stadtstaaten) aus Deutschland und Österreich. Sie berät ihre Mitglieder in Fragen des Verwaltungsmanagements und ist Initiator und Promotor des zur Zeit in vielen Kommunen laufenden Reformprozesses. Die KGSt ist ein Solidarverband, der im Austausch mit seinen Mitgliedern Empfehlungen erarbeitet sie weitergibt.
24 Vgl. Online-Verwaltungslexikon 12/01
25 Vgl. Heinz, R.: Verwaltungsreform: quo vadis?, www.kgst.de, 11. Dez. 01
26 Vgl. Online-Verwaltungslexikon 12/01, Programm der Bundesregierung von 1999
27 Vgl. Online-Verwaltungslexikon 12/01, Programm der Bundesregierung von 1999
28 Angabe nach eigenen Erfahrungen
29 Online-Verwaltungslexikon 12/01: Quelle: Statistisches Bundesamt. Bei den Ländern ist dieser Anteil allerdings wesentlich höher und liegt bei 38%, im Durchschnitt aller öffentlichen Haushalte beträgt er 19%. Der höhere Anteil bei den Ländern beruht aber gerade auf Leistungen, die für die Zukunftsfähigkeit entscheidend sind (Bildung) und deshalb kaum nennenswert verringert werden könnten.
30 Online-Verwaltungslexikon 12/01, Zitat aus: Rürup: Effizienzrevolution in der öffentlichen Verwaltung. Wann, wenn nicht jetzt? In: Verwaltung und Management, 2000, S. 267. Diese Zahlen beziehen sich auf den Staat insgesamt, nicht nur den Bundeshaushalt.
31 Online-Verwaltungslexikon 12/01, Zitat aus ebd., unter Verweis auf die Bundesbank
32 Online-Verwaltungslexikon 12/01, Stichwort Neues Steuerungsmodell
33 Bezug auf Reichard, Christoph: Kommunales Management im internationalen Vergleich, in: Der Städtetag, 45. Jg. (1992), Heft 12/1992, S. 843-848
34 Bezug auf Krajinski, Roman: Bürgerberatungs- und Informationssystem der Stadt Magdeburg, in: Hill, Hermann (Hrsg.): Die kommunikative Organisation. Change Management und Vernetzung in öffentlichen Verwaltungen, Köln, Berlin, Bonn, München 1997, S. 83-95
35 Wiechula: Stadtmarketing im Kontext eines Public Management, 2000, S. 70
36 Vgl. Online-Verwaltungslexikon, 12/01 und Programm der Bundesregierung von 1999
37 Vgl. Online-Verwaltungslexikon, 12/01
38 Vgl. Online-Verwaltungslexikon, 12/01
39 Vgl. Online-Verwaltungslexikon, 12/01
40 Vgl. Programm der Bundesregierung von 1999 im Internet, 12/01
41 Vgl. Heinz, Rainer: Verwaltungsreform: quo vadis?, www.kgst.de
42 Vgl. Wiechula, Stadtmarketing im Kontext eines Public Management, 2000 unter Bezug auf Palupski, Rainer: Marketing kommunaler Verwaltungen, München, Wien 1997
43 Ebd. S. 65
44 Vgl. ebd. S. 64 ff.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Stadtmarketing laut dieser Arbeit?
Stadtmarketing ist ein modernes Managementinstrument für eine ganzheitliche und optimale Stadtentwicklung. Es ist ein nie endender Kommunikationsprozess, der sich an inneren und äußeren Zielgruppen, Wettbewerbsstädten und eigenen Zielen der Stadt orientiert. Im Mittelpunkt steht die Stadt.
Welche Ursachen und Gründe gibt es für Stadtmarketing?
Der Druck auf die Städte wird größer. Es vollzieht sich ein Strukturwandel, Märkte globalisieren sich, demographische Probleme (z.B. Abwanderung), Imageprobleme und Konflikte zwischen Gruppen in der Stadt sind Gründe für die zunehmende Bedeutung des Stadtmarketings.
Welche Ziele und Aufgaben hat Stadtmarketing?
Hauptziel ist die Aktivierung und Förderung der Sichtweise, dass Tätigkeiten der städtischen Akteure sich am Kunden orientieren müssen. Teilziele sind beispielsweise die Steigerung der Attraktivität, bessere Positionierung gegenüber Wettbewerbern, Imageverbesserung, Erhöhung der Kundenzufriedenheit und die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt.
Wie läuft ein Stadtmarketingprozess ab?
Der Prozess startet mit einer Situationsanalyse (Standortuntersuchung, Stärken/Schwächen-Profil). Es folgen Konzeptionsphase (Leitbild- und Zieldiskussion), Strategieentwicklung (Zielgruppen, Wettbewerber), Maßnahmenplanung (konkrete Planung in Handlungsfeldern wie Verkehr, Tourismus, etc.) und Umsetzung der Maßnahmen. Abschließend erfolgt das Controlling (Erfolgs- und Finanzcontrolling).
Was ist Public Management, "New Public Management" oder "Neues Steuerungsmodell"?
Die Begriffe werden in dieser Arbeit synonym verwendet und bezeichnen ein umfassendes Modell zur Steigerung von Effektivität, Bürgerorientierung und Effizienz bzw. Wirtschaftlichkeit von Verwaltungsbereichen. Die Steigerung soll u. a. durch Deregulierung, Dezentralisierung, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Kontraktmanagement und die Führung der Verwaltungen als Konzern erreicht werden.
Welche Hintergründe gibt es für die Entwicklung des Public Management?
Zunehmende Globalisierung, steigende internationale Abhängigkeit, neue technische Entwicklungen, wachsende Bedeutung internationaler Vereinigungen, mehr Autonomie für Verwaltungen durch Dezentralisierung, zunehmender Druck durch nicht-staatliche Organisationen und Bürgerinitiativen.
Was sind die Ziele des Public Management?
Mehr Leistung, weniger Kosten, bürgerfreundlichere Verwaltung mit mehr Bürgerorientierung und Transparenz, höhere Mitarbeiterzufriedenheit und motivierte Beschäftigte. Es werden Prinzipien wie Steuern statt Rudern, Resultate statt Regeln, Eigenverantwortlichkeit statt Hierarchie, Wettbewerb statt Monopol und Motivation statt Alimentation angestrebt.
Welche Veränderungen hat das Neue Steuerungsmodell bisher bewirkt?
Allgemein lässt sich eine deutliche Leistungssteigerung der Kommunen feststellen (kürzere Wartezeiten, umfassendere Informationen, verständlichere Formulare). Kommunen sind bürgerfreundlicher, wirtschaftlicher und effektiver geworden. Bürger haben den Eindruck, dass sich Ämter und Behörden tiefgreifend verändern und von staatlichen Bürokratien zu modernen Dienstleistern entwickeln.
Wie hängen Stadtmarketing und Public Management zusammen?
Obwohl oft argumentiert wird, dass Marketing in öffentlichen Verwaltungen unmöglich sei, tauschen Kommunen Ideen, Waren und Dienstleistungen mit Bürgern und Unternehmen aus. Public Management gibt Anregungen zur Realisierung von Stadtmarketing, da es die festgefahrenen Strukturen der öffentlichen Verwaltung durchbrechen und neue innovative Wege und Maßnahmen finden bzw. umsetzen soll. Stadtmarketing ist ein Ansatz, der mit zu einer Entwicklung in Richtung des Public Management an Bedeutung gewann und erst durch die neuen Strukturen und das neue Management von Verwaltungen möglich wurde.
- Citar trabajo
- Y.; Rechel Hillbrecht (Autor), 2001, Stadtmarketing und Public Management, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106249