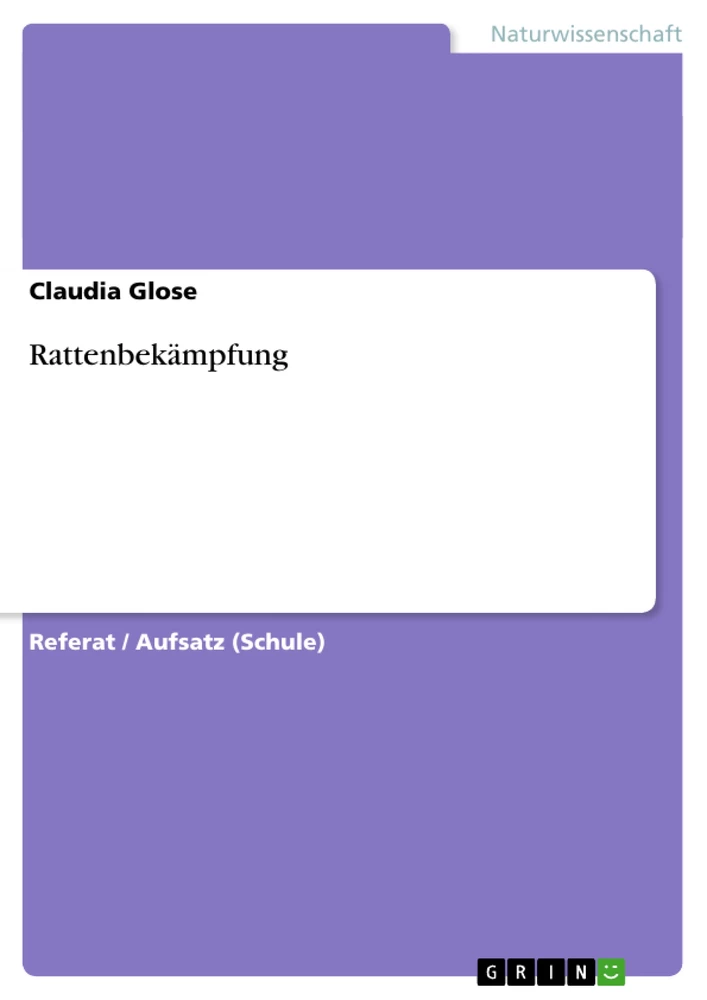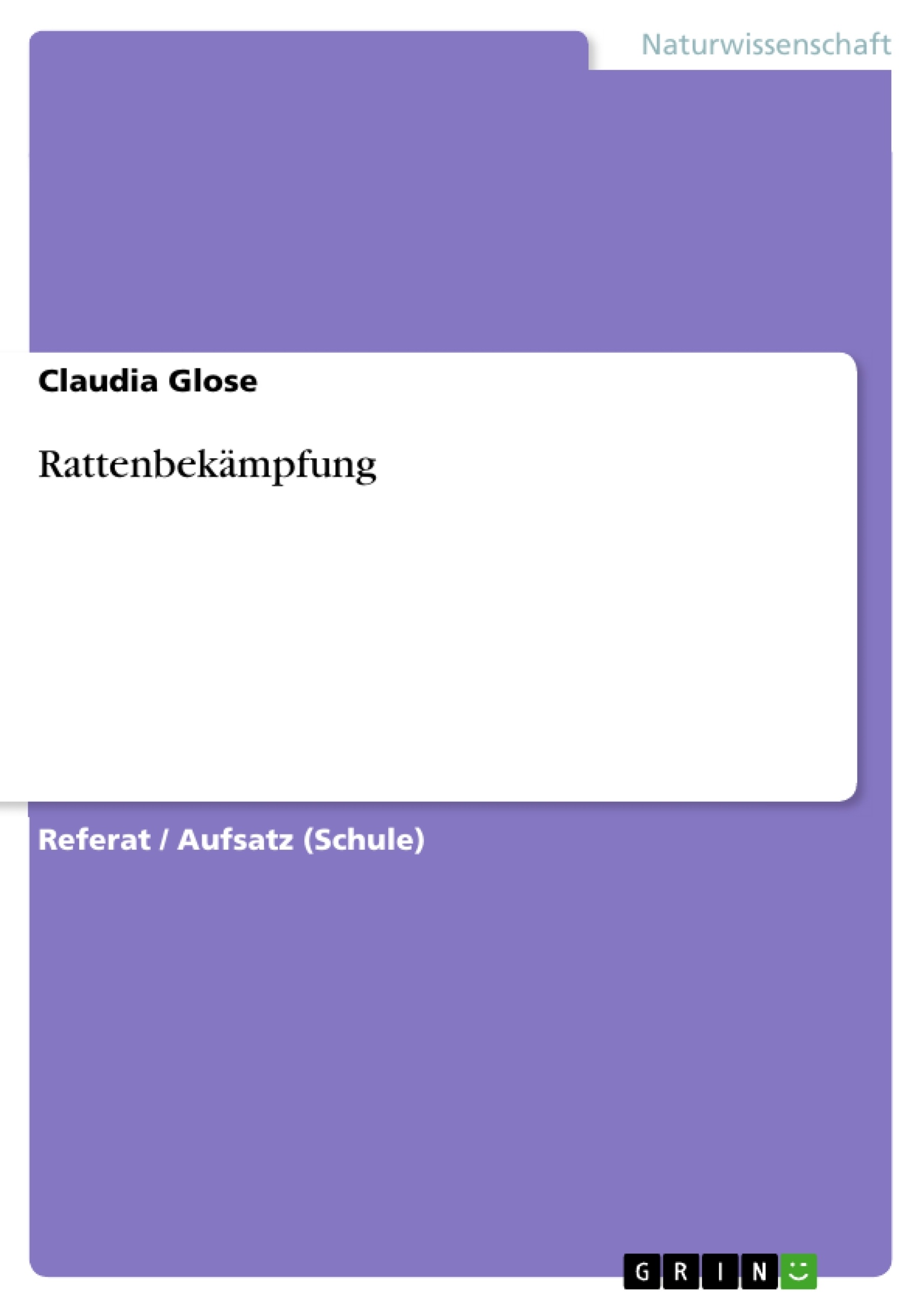Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Schatten mehr bergen als nur Dunkelheit – eine Welt, die von einer Spezies geprägt ist, die seit Jahrtausenden im Verborgenen agiert und das Schicksal der Menschheit unauffällig beeinflusst: die Ratte. Diese ebenso faszinierende wie gefürchtete Kreatur ist nicht nur ein Schädling, sondern auch ein Überlebenskünstler, dessen Anpassungsfähigkeit und Intelligenz uns immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Doch wie können wir uns vor den Gefahren schützen, die von diesen Nagern ausgehen, ohne dabei die ökologischen Zusammenhänge aus den Augen zu verlieren? Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine aufschlussreiche Reise durch die Welt der Rattenbekämpfung, von ihren Ursprüngen und ihrer Lebensweise bis hin zu den modernsten Methoden, um ihre Ausbreitung einzudämmen. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Rattenarten, ihre Sinnesorgane, ihren Lebensraum und ihre Ernährungsgewohnheiten, um die Biologie dieser Tiere besser zu verstehen. Entdecken Sie die vielfältigen Strategien der Rattenbekämpfung, von traditionellen Methoden bis hin zu innovativen Technologien, und lernen Sie, wie Sie diese effektiv einsetzen können. Untersuchen Sie die chemischen und nichtchemischen Verfahren, die zur Verfügung stehen, einschließlich Rattengifte, Lebendfallen, Totschlagfallen und Ultraschallgeräte, und erfahren Sie mehr über ihre Vor- und Nachteile. Beleuchtet werden die Probleme, die bei der Bekämpfung auftreten, wie die zunehmende Resistenz gegen Gifte. Diskutiert werden auch die ethischen Aspekte der Rattenbekämpfung und die Bedeutung des Tierschutzgesetzes. Abschließend wird auf die Vorbeugung eingegangen, um Ratten von vornherein keine Lebensgrundlage zu bieten. Dieses Buch bietet wertvolle Einblicke für Schädlingsbekämpfer, Hausbesitzer und alle, die sich für die komplexe Beziehung zwischen Mensch und Tier interessieren. Tauchen Sie ein in die Welt der Ratten und entdecken Sie die unerwarteten Fakten und Strategien, die Ihnen helfen werden, diese Herausforderung zu meistern. Werfen Sie einen Blick auf die gesetzlichen Aspekte der Rattenbekämpfung und erfahren Sie, welche Sicherheitsmaßnahmen beim Auslegen von Gift zu beachten sind. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Ratgeber für alle, die sich mit dem Thema Rattenbekämpfung auseinandersetzen müssen oder wollen, und bietet sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Tipps für eine erfolgreiche und nachhaltige Schädlingsbekämpfung.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Allgemeines zur Ratte
2.1 Ursprung
2.2 Aussehen
2.3 Sinnesorgane
2.4 Lebensraum
2.5 Nahrung
2.6 Vermehrung
2.7 Lebensweise
3 Rattenbekämpfung
3.1 Warum Ratten bekämpft werden
3.2 Wie Ratten bekämpft werden
3.3 Probleme bei der Rattenbekämpfung
3.4 Erfolge der Rattenbekämpfung
3.5 Vorbeugung
3.6 Gesetzliche Aspekte
4 Schluss
5 Anhang
6 Literaturverzeichnis
7 Selbstständigkeitserklärung
1 Einleitung
Meine Facharbeit über das Thema Rattenbekämpfung zu schreiben, schlug mir meine Biologielehrerin vor. Während ich über dieses Thema nachdachte, fiel mir auf, wie wenig ich darüber wusste. Dies macht mich neugierig und weckte mein Interesse. Während ich an meiner Facharbeit schrieb, merkte ich, wie wichtig das Thema Rattenbekämpfung ist. Schließlich gehen viele Gefahren für den Menschen von den Ratten aus. Es ist doch eigentlich verwunderlich, dass das interessante Thema Ratten und ihre Bekämpfung so wenig in der Öffentlichkeit behandelt wird. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Ratten überwiegend in der Kanalisation und damit außerhalb des menschlichen Blickfeldes leben.
Auch bei meiner Suche nach Informationen viel mir auf, dass in vielen Texten die Ratte immer noch als bösartiges und ekeliges Tier dargestellt wird. Ich fand nur wenige sachliche Berichte über die Rattenbekämpfung, was mir die Erstellung dieser Facharbeit erschwerte.
Dennoch werde ich versuchen, auf den folgenden Seiten möglichst viele Informationen über die Ratte und ihre Bekämpfung zusammen zu stellen.
2 Allgemeines zur Ratte
2.1 Ursprung
Ratten gehören zur Familie der echten Mäuse (Mirinae), einer Unterfamilie der Mäuse (Muridae). Weltweit gibt es viele verschiedene Rattenarten, wovon die Hausratte (Rattus rattus) und die Wanderratte (Rattus norvegicus) die bekanntesten sind. Ihre Ursprungsheimat liegt in Ost- und Südostasien, wobei die Hausratte als Baumbewohner in den Wäldern lebt und die Wanderratte in selbstgegrabenen Bau- und Gangsystemen die offene Steppe besiedelt.
Wann und wie die Ratten nach Europa gelangten, ist bis heute nicht ganz geklärt. Für die Wanderratte wird weitgehend angenommen, dass sie im 18. Jahrhundert nach Europa kam. Vermutlich verbreitete sie sich über Russland oder Norwegen (daher ihr lateinischer Name) bis nach Westeuropa. Auch die Einwanderungszeit der Hausratte ist nicht genau bekannt. Funde von Hausrattenknochen beweisen jedoch, dass sie schon im 2. Jahrhundert in Teilen Europas verbreitet gewesen seien muss. Ungewiss ist außerdem, ob sich die Hausratte durch natürliche Wanderung oder durch unwissentliche Mithilfe der Menschen verbreitet hat. Fest steht jedoch, dass beide Rattenarten im 16. Jahrhundert an Bord von Schiffen nach Nord- und Südamerika gelangten. Nach Australien und Neuseeland gelangten die Ratten aber nicht, wie häufig irrtümlich angenommen, mit den Schiffen der Europäer, sondern wurden bereits von den Maoris eingeschleppt. Dies beweisen Funde von 2000 Jahren alten Rattenknochen.
2.2 Aussehen
Die Wanderratte hat im Gegensatz zur Hausratte einen robusteren, plump wirkenden Körperbau. Die Körperlänge beträgt ca. 20-28 cm, wobei die Männchen meist etwas größer und schwerer sind. Der Schwanz ist etwa so lang wie der Körper, leicht behaart und mit Schuppenringen versehen. Eine ausgewachsene Wanderratte wiegt 300-500 g. Die Hausratte ist kleiner und erreicht nur eine Körperlänge von 15-23 cm, wobei der Schwanz etwas länger (17-25) ist. Sie hat eine spitzere Schnauze und ihre Ohren sind etwas größer als die der Wanderratte. Die Hausratte sieht insgesamt aus, wie eine große Maus, die Wanderratte hingegen hat eine stark ausgeprägte Kyphose (Wirbelsäulenkrümmung).
Auch in der Farbe unterscheiden sich Hausratte und Wanderratte voneinander.
Hausratten sind meist schwarz bis dunkelgrau. Es gibt aber auch Ausnahmen, wie z.B. den Frugivorus-Typ (Rückenfell graubraun, Bauchfell weiß) und den Alexandrinus-Typ (Rückenfell graubraun, Bauchfell mittelgrau). Wanderratten haben ein rot -bis graubraunes Rückenfell und ein weißliches bis gräuliches Bauchfell. Aber auch bei der Wanderratte gibt es Farbvariationen. Albinos, wie sie für Labore gezüchtet werden und gescheckte Ratten, wie man sie häufig in Tierhandlungen findet, treten in der Natur jedoch nur sehr selten auf (s. Abb. 1).
2.3 Sinnesorgane
Ratten können hervorragend hören, riechen und tasten. Sie nehmen Töne im Ultraschallbereich (über 20 kHz) wahr, die für den Menschen nicht zu hören sind und erzeugen diese auch. Tiefere Töne unter 8kHz hört die Ratte jedoch kaum noch. Der Geruchssinn ist besonders gut ausgebildet. Sie benötigen ihn, um ihre Nahrung zu finden und Feinde frühzeitig zu erkennen. Zum Tasten benutzen die Ratten ihre langen, an der Schnauze wachsende Tasthaare (Vibrissen). Damit können sie sich in der Dunkelheit zurecht finden. Weitere Tasthaare, die sogenannten Leithaare, die auch zur Orientierung dienen, befinden sich im Fell. Die Ratte muss sich ständig putzen, um sie von Staub und Dreck zu befreien, damit sie funktionstüchtig bleiben. Die Augen der Ratte sind eher schlecht. Sie befinden sich seitlich am Kopf. Ein räumliches sehen und das Abschätzen von Entfernungen ist kaum möglich.
2.4 Lebensraum
Ratten sind sehr anpassungsfähig und bewohnen daher sehr verschiedene Lebensräume. Die Hausratte lebte ursprünglich auf Bäumen. In Deutschland kommt sie jedoch fast nur in Gebäuden vor, da sie sehr kälteempfindlich ist. Sie bewohnt meist die oberen Geschosse eines Hauses, wie z.B. den Dach- oder Heuboden.
Wanderratten können Kälte besser vertragen. Deshalb leben 40% der Wanderratten in Deutschland im Freiland (Müllplätze, Komposthaufen, Reiterhöfe).Im Winter suchen sie aber auch häufig Häuser auf. Dort leben sie in den Untergeschossen und Kellern. Einen großer Teil der Ratten findet man in der Kanalisation. Im Freien baut die Wanderratte ein weitreichendes unterirdisches Gangsystem mit Wohn- und Nahrungskessel. In Gebäuden befinden sich die Nester in Hohlräumen, Zwischendecken und anderen Verstecken.
2.5 Nahrung
Ratten sind Allesfresser, die Hausratte bevorzugt jedoch pflanzliche Kost. Wanderratten fressen auch Fleisch und es kommt vor, dass sie in Geflügelfarmen eindringen und Hühnerküken töten. Meist suchen die Ratten ihre Nahrung in Müllcontainern, Komposthaufen, Scheunen, Vorratsräumen und in der Kanalisation. Dadurch, dass die Wanderratte, sowohl bei der Nahrung als auch beim Lebensraum, weniger spezialisiert ist, hat sie die Hausratte zum größten Teil verdrängt, so dass die Hausratte mittlerweile in Deutschland unter Artenschutz steht.
2.3 Vermehrung
Ratten sind äußerst fruchtbare Tiere. Die Weibchen werden schon mit 50-72 Tage geschlechtsreif. Sie paaren sich mit mehreren Männchen (s.Abb.2) und werfen nach ca. 20 Tagen 8-12 Junge. Ein Rattenpaar und seine Nachkommen können in einem Jahr 11000 Tiere erzeugen. Bedenkt man aber, dass nur etwa 5% der Jungen das erste Jahr überleben, ist die Zahl bei weitem nicht mehr so hoch. Die Ratten können ihre Schwangerschaft so beeinflussen, dass sie gleichzeitig ihre Jungen werfen. Diese werden gemeinsam groß gezogen und auch fremde Junge werden gesäugt (s.Abb.3+4).
2.4 Lebensweise
Ratten sind dämmerungs- und nachtaktiv. Sie leben in Rudeln von 20-60 Tieren, wobei sich die Männchen meist etwas abseits halten. Ratten sind sehr soziale Tiere und erkennen sich gegenseitig am Geruch. Jedes Rudel hat sein eigens Revier, das sie nur bei Nahrungsmangel oder Übervölkerung verlassen. Meist finden sie ihre Nahrung im Umkreis von einem Kilometer, in Ausnahmefällen legen sie aber auch bis zu drei Kilometer bis zur Futterquelle zurück. Dabei bewegen sie sich nur auf bestimmten Wegen, den sogenannten Wechseln, die sie fast nie verlassen.
3. Rattenbekämpfung
3.1 Warum Ratten bekämpft werden
Seitdem die Menschen sesshaft wurden und Vorräte anlegten, seitdem existiert das Problem der Rattenplage. Schon seit Jahrtausenden leben die Ratten im Umfeld der Menschen, weil sie hier besonders leicht Nahrung finden. Selbst heutzutage muss man davon ausgehen, dass in manchen Teilen der Erde fast die Hälfte aller Lebensmittel von Ratten gefressen oder durch ihren Kot und Urin für die Menschen ungenießbar gemacht werden. In Bangladesh wurden 1992 etwa 525.000 Tonnen Reis von Ratten gefressen - eine Menge, die 3 Millionen Menschen hätte ernähren können. Die durch Ratten entstehenden Fressschäden sind enorm (s.Abb.5).
Hinzu kommt, dass Ratten gefährliche Krankheiten übertragen kann. In ihren Eingeweiden befinden sich mindestens 11für den Menschen krankheitserregende Parasiten. Durch das Einatmen von Staub mit den Ausscheidungen der Ratten, durch Rattenbisse oder durch Parasiten, die auf der Ratte leben, können Krankheiten wie Gelbsucht, Lassa-Fieber, Salmonellen, Typhus, Cholera, Ruhr, Tuberkulose und Maul- und Klauenseuche auf Mensch und Tier übertragen werden. Die aber wohl bekannteste Krankheit ist die Pest. Sie wird durch den Bazillus „Yersinia pestis“, der im Verdauungstrakt des Rattenflohs vorkommt, ausgelöst. Wenn nun die Ratte auf Grund der Krankheitsübtragung stirbt, sucht sich der Floh einen neuen Wirt. Findet er jedoch keine Ratte, so springt er auch auf den Menschen über und löst bei ihm durch seine Bisse die Pest aus. Von 1347-1721 rollten mehrere Pestwellen über Europa und forderten 25 Millionen Opfer. Erst 1894 wurde der Zusammenhang zwischen Ratte, Rattenfloh und Pest festgestellt. Aber auch heute ist die Krankheit keineswegs gebannt. Jährlich sterben rund 4000 Menschen an der Pest.
Weitere Schäden richten Ratten an, indem sie Bau- und Verpackungsmaterialien annagen und Kabelmäntel fressen (s.Abb.6).
Aus diesen Gründen, aber auch weil sich viele Menschen vor Ratten ekeln, werden sie bekämpft. Dabei muss man jedoch festhalten, dass die Ratte auch ein natürlicher Bestandteil des ökologischen Gleichgewichtes ist. Sie ist Beutetier für Rotfuchs, Marder, Iltis, Schleiereule, Uhu und Waldkauz. Nur dort, wo Menschen den Ratten ein optimales Nahrungsangebot und Lebensmöglichkeiten schaffe, nur dort vermehren sich die Ratten so stark, dass sie für die Mensche problematisch werden und bekämpft werden müssen. Schätzungen gehen davon aus, dass in einer Stadt auf einen Einwohner 10 Ratten kommen. Um eine noch stärkere Vermehrung der Ratten zu verhindern, werden sie ständig bekämpft.
3.2 Wie Ratten bekämpft werden
Im Laufe der Jahrtausende entwickelte der Mensch viele verschiedene Möglichkeiten, um sich und seine Vorräte vor Ratten zu schützen. Schon im alten Ägypten wurden Katzen zur Rattendezimierung eingesetzt. Aus dem 18. Jahrhundert stammt der sogenannte „Spieker up Musepile“, ein auf Pfeilern errichteter Speicher, der verhindern soll, dass Mäusen und Ratten an das Getreide herankommen und es auffresse.(s.Abb.7). Heutzutage gibt es in jeder Stadt umfangreiche Rattenbekämpfungsmaßnahmen, die von speziell ausgebildetem Personal durchgeführt werden. Hauptsächlich werden dazu verschiedene Gifte und Köder benutzt. Doch um die Rattenplage langfristig erfolgreich zu bekämpfen, ist es wichtig, den Ratten ihre Nahrungsquellen und Lebensräume zu entziehen. Bei den Bekämpfungsarten unterscheidet man zwischen chemische und nichtchemischen Verfahren.
Chemische Verfahren:
Rattengift : Das Bekämpfen der Ratten mit Gift ist schwieriger als man denkt, denn Ratten sind sehr intelligent und haben ein angeborenes Fressverhalten. So würde keine Ratte von einem Köder fressen, wenn daneben eine tote Ratte läge. Auch fressen sie von jeder Futterquelle nur ein kleines Bisschen, so dass eine Ratte den Köder mehrmals aufsuchen muss, um schließlich eine tödliche Dosis zu sich zu nehmen. Unbekannten Nahrungsquellen stehen Ratten sehr vorsichtig gegenüber. Oft schicken sie ältere Tiere vor, um sie das neue Futter probieren zu lassen und beobachten sie. Erst wenn die Tiere in den nächsten1-2 Tagen kein auffälliges Verhalten zeigen und gesund wirken, gehen auch die übrigen Ratten an die neue Nahrungsquelle. Somit hat es also keinen Zweck sofort tödlich wirkende Köder auszulegen, denn daran würde nur eine einzige Ratte sterben. Alle anderen Ratten würden in Zukunft aber diese Art von Ködern nicht mehr fressen.
Deswegen verwendet man heutzutage Köder die Rodentizide enthalten. Dies sind Gifte, die erst nach 2-4 Tagen wirken. Dadurch können die Ratten Ursache und Wirkung nicht miteinander in Verbindung bringen. Rodentizide wirken hemmend auf die Vitamin-K- Synthese in der Leber. Vitamin-K regt die Bildung des Enzyms Prothrombin an, was wiederum zur Erzeugung von Fibrin beiträgt, das für die normale Blutgerinnung benötigt wird. Durch die Störung der Vitamin-K-Synthese kommt es zu einer verzögerten Blutgerinnung. Dadurch werden innere Blutungen hervorgerufen, so dass die Raten schließlich stirbt. Diese Methode sei, so steht es in einer Werbebroschüre der Leverkusener Bayer AG „wirkungsvoll, aber schmerzlos. Am Anfang stehen Symptome wie Freßunlust, Ermüdung, Apathie und taumelnde Bewegungen“ .Die Ratten sterben „nach einiger Zeit an einem Zustand der Erschöpfung...oft in der für sie typischen Schlafhaltung“ (1).
Mittlerweile wurden viele verschiedene Rodentizide entwickelt, die man in zwei Gruppen einteilen kann.
1.) Produkte der 1. Generation:
Warafin: anticoagulant (Blutgerinnungshemdend), wirk erst nach wiederholter Köderaufnahme, geeignet für die Bekämpfung nicht resistenter Ratten
Chlorphazinon: anticoagulant, wirkt erst nach wiederholter Köderaufnahme, geeignet für die Bekämpfung der Wanderratte.
2.) Produkte der 2. Generation:
Bromadiolon: anticoagulant, wirkt nach einmaliger Köderaufnahme
Difenacum: anticoagulant, sehr effektiv, Tod tritt nach 3-4 Tagen auf, geeignet bei sehr resistenten Ratten und starkem Befall
Brodifacoum: anticoagulant, sehr effektives Mittel, geeignet bei sehr resistenten Stämmen und starkem Befall
Die Rodentizide unterscheiden sich vor allem in ihren Giftigkeit. Dies zeigt die folgende Tabelle. Dargestellt ist die Ködermenge, die bei 50% der Versuchstiere zum Tode führte.
Tödliche Dosis bei einmaliger, bzw. mehrmaliger Köderaufnahme
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
* Daten nicht verfügbar
rote Zahlen - Tödliche Dosis bei 5-tägiger aufeinanderfolgender Köderaufnahme Die Prozentzahlen stellen den Anteil des Giftes am Köder dar.
In dieser Tabelle lassen sich gut die verschiedenen Eigenschaften der Gift erkennen. Auffällig ist, dass die beiden Gifte der ersten Generation (Warafin und Chlorphacinon) bei einmaligen Fressen für Ratten ungiftig sind, denn man kann davon ausgehen, dass keine Ratte 186g (2/3 ihres Tagesbedarfs) bzw,102g von der gleichen Nahrungsquelle zu sich nimmt. Erst wenn die Ratte das Gift mehrmals zu sich nimmt, wirkt es. Anders ist es bei den Giften der 2. Generation. Zwar wirken sie auch bei mehrmaligem Fressen besser, doch kann auch schon eine einmalige Dosis tödlich sein.
Anwendung: Köder, die Rodentizide enthalten, gibt es in vielen verschiedene Formen, in Haferflocken, Weizen, Mais, Reis, Paste, feste Blöcke usw. (s.Abb.8). Wichtig ist, dass die Köder an eine für Ratten attraktiven Stelle ausgelegt werden, so dass die Ratten die Möglichkeit haben, mehrere Tag an ihm zu fressen. Die gängigste Methode ist es, feste Köder an langen Fäden in die Kanalschächte zu hängen (s.Abb.9). Dabei werden die Auslegeorte genau notiert. Nach etwa zwei Wochen, werden die Köder kontrolliert. Bei Bedarf werden neue ausgelegt und diese Orte wiederum notiert. Durch die daraus entstandenen Aufzeichnungen erhoffen sich die „Rattenbekämpfer“ wichtige Aussagen darüber, an welchen Stellen die Ratten fressen , um sie so gezielter bekämpfen zu können.
Bei akutem Rattenbefall an einem bestimmten Ort werden auch an der Erdoberfläche Köder ausgelegt. Diese befinden sich jedoch in speziellen Behältern mit einer nur schmalen Öffnung, so dass keine Gefahr für die Umwelt entsteht. Auch werden die Köder direkt in die Rattenlöcher gegeben, die anschließend mit Erde verschlossen werden.
Puder und Schaum : Die Bekämpfung mit giftigem Puder und Schaum ist eine Ergänzung zu den Giftködern. Das Puder wird auf die Wechsel oder in die Baueingänge gestreut (s.Abb.10). Beim Belaufen gepuderter Strecken bleibt das Gift an den Pfoten und dem Bauch der Ratte heften. Da Ratten sehr reinliche Tiere sind, gelangt das Puder beim Putzen in den Magen der Ratte und entfaltet dort seine Wirkung. Nachteil des Puders ist es jedoch, dass er nur schlecht an der Ratte haftet und dadurch nur kleine Mengen aufgenommen werden. Auch ist der ausgestreute Puder nur eine kurze Zeit lang wirkungsvoll. Deshalb wurde von der Leverkusener Bayer AG der „Racumin Plus Schaum“ entwickelt, eine klebrige und lange haltbare Masse. Sie wird wie das Puder in die Baueingänge und auf die Wechsel der Ratten gesprüht. Auch bei dieser Methode macht man sich wieder zwei Verhaltensweisen der Ratten zu nutze. So versuchen die Ratten ihre Bauten und Wechsel frei zu halten. Dadurch kommt es zu einer starken Anhaftung des Schaums an den Rattekörper. Hinzu kommt, dass sich die Ratte wegen der Klebrigkeit des Schaums besonders gründlich putzt und somit eine große Menge des Gifts aufnimmt.
Der Schaum wird in Applikator-Dosen verkauft und ist sehr einfach zu handhaben.
Nichtchemische Verfahren:
Die nichtchemischen Verfahren werden meistens von Privatpersonen zu einer lokalen Rattenbekämpfung bei geringem Befall eingesetzt. Sie eignen sich nicht dazu, großflächig Ratten zu bekämpfen. Dort können sie höchstens als Unterstützung zur chemischen Rattenbekämpfung eingesetzt werden.
Lebendfallen: Bei Lebendfallen werden Ratten in einen Käfig geködert, der sich, sobald die Ratte ihn betreten hat, schließt (s.Abb.11). Anschließend setzt man die Tiere in einiger Entfernung wieder aus. Als Köder eignen sich süßer Kartoffelbrei, Schinken und Getreide. Wichtig ist, dass man die Fallen täglich kontrolliert. Um eine einzige Ratte zu fangen, müssen meistens mehrere Fallen aufgestellt werden.
Totschlagfallen: Wie bei den Lebendfallen werden die Ratten durch Köder angelockt. Durch Berühren der Falle wird ein Mechanismus ausgelöst. Ein Schlagbügel löst sich und bricht der Ratte das Genick (s.Abb.12)
Ultraschall: Die Ultraschallmethode macht sich das natürliche Verteidigungsverhalten der Ratten zu nütze. Dringt eine Ratte in ein fremdes Revier ein, so benutzt der Eindringling wie der Verteidiger einen paralysierenden Schrei (einen hohen, für Menschen nicht hörbaren Ultraschall-Laut) um den Gegner in die Flucht zu schlagen. Flüchtet die unterlegene Ratte nicht sofort, erstarrt sie und stirbt kurze Zeit später. Das Ultraschallgerät simuliert nun diesen paralysierenden Schrei und gibt den Raten somit zu verstehen, dass das Gebiet bereits von anderen Ratten besetzt ist. Somit halten sich in der Nähe dieses Gerätes keine Ratten auf. Jedoch wird das Problem der Rattenplage damit nicht behoben, sonder lediglich auf ein anderes Gebiet verlagert. Auch die in Deutschland mittlerweile verbotenen Leimfallen funktionieren nach dem gleichem Prinzip. Hierbei handelt es sich um ein mit klebriger Paste bestrichenem Brett, auf dem die Ratte festkleben. Während sie verzweifelt versuchen, sich zu befreien, stoßen sie paralysierende Schreie aus und vertreiben dadurch die anderen Ratten.
Parasiten:
Die Bayer AG hat mit der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) und der Stuttgarter Universität eine neue Methode der Rattenbekämpfung entwickelt. Sie wollen den einzelligen Parasiten „Sarcocystis singaporensis“ zur Rattenbekämpfung benutzen. Dieser Parasit stammt wie die Ratten aus Asien und verursachen bei Ratten starke Blutungen in der Lunge. Die Benotung dieser Methode ist umstritten. So heißt es zum einen, dass der Parasit „keinem anderen Organismus schade“ und bereits „in Ägypten erfolgreich eingesetzt worden sei“(2). Andere bezeichnen die Methode als „ein Mittel aus dem Arsenal der Biologischen Kriegsführung“ und behaupten, dass die „Parasiten- Invasion (...) das Tier in einigen Tagen qualvoll verenden lasse“. Weiterhin werfen sie den Forschern vor, dass „die Gefahren, die für Mensch und Umwelt von einer Parasiten- Freisetzung ausgehen, natürlich nicht Gegenstand der Labor-Experimente sind“. (3)
3.3 Probleme bei der Rattenbekämpfung
Ein großes Problem bei der Rattenbekämpfung mit chemischen Mitteln ist, dass die Gifte zunehmend an Wirkung verlieren, da sich die Ratten daran angepasst haben. „Noch ist keine Panik angesagt. Aber in einzelnen Gebieten sind Ratten bereits resistent, sagt Hans-Joachim Pelz von der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft “(4). Wie stark die Ratten bereits gegen Gift resistent sind, untersuchte Pelz 1990 in einem Versuch. Er fing in einem 8000 km² großem Gebiet im Münsterland Wanderratte und fütterte sie drei Wochen lang mit einer für normalen Ratten tödliche Dosis von Rattengift. 90 % der Tiere überlebten. Bisher sei das Problem, so Pelz, noch regional (...), könne sich aber wegen der Mobilität der Ratten auch in andere Bundesländer ausbreiten (5). Zu ähnlichen Ergebnissen gelangte man auch in England. Dort wurde 1993 ein Rattenstamm, „der auch gegen modernste Gift resistent sei“ (6) entdeckt. In den nächsten zwei Jahren wurde in dieser Region kein Gift mehr ausgelegt, um eine weitere Anpassung zu verhindern. Dennoch waren sämtliche Ratten, die anschließend untersucht wurden, gegen die Gifte resistent. Daraus lässt sich folgern, dass sich resistente Ratten bei der Vererbung gegenüber nicht resistenten Ratten durchsetzten.
Gegen Gifte können Ratten resistent werden, indem sie eine nicht letale Dosis des Giftes fressen. Diese können sie in ihrem Stoffwechsel abbauen. Dadurch gewöhnen sie sich an das Gift, so dass sich die Toleranzschwelle gegenüber dem Gift stetig erhöht. Diese Eigenschaft vererben sie auch an ihre Jungen weiter. Das Problem bei der Rattenbekämpfung ist also, dass man nicht garantieren kann, dass eine Ratte immer eine tödliche Dosis des Giftes frisst. Gerade bei Giften wie Warafin und Chlorphacinon aus der ersten Generation, die mehrmals gefressen werden müssen, um wirksam zu sein, besteht die Gefahr, dass die Ratten sie nur einmal fressen und sich somit langsam an sie gewöhnen. Vor allem Privatperson, die Ratten auf eigene Faust bekämpfen, fördern das resistent werden der Tiere. „Die streuen Gift, das eventuell für vier Ratten gereicht hätte, und dann kommen sechs oder sieben und fressen davon“ (7) ,so dass die Ratten nicht sterben, sondern ihr nächster Wurf weniger giftempfindlich ist. Pelz empfehlt nur Ratten, die gegen die Gifte der ersten Generation resistent sind, mit den giftigeren Produkten der zweiten Generation zu bekämpfen. Dann jedoch so intensiv, dass keine Ratte das Gift überlebt, damit es nicht zu einer neuen Bildung von Resistenzen kommt. Ein weiteres Problem bei der Rattenbekämpfung ist, dass durch das Gift keine anderen Tiere gefährdet werden dürfen. Deswegen wird darauf geachtet, dass das Gift nicht für Tiere, wie z.B. Hunde und Katzen erreichbar ist. Doch selbst wenn Tiere Rattengift fressen, ist es für sie meistens ungefährlich. In Tab.1 ist dargestellt, wie viel Gramm Rattengift ein 15 kg schwerer Hund fressen darf, um keinen gesundheitlichen Schaden zu nehmen. Dabei fällt auf, dass er von den Ködern mehr als ein Kilogramm fressen müsste, um zu sterben. Diese Menge Rattengift wird jedoch niemals an einer Stelle ausgelegt, so dass keine Gefahr für Hunde besteht. Lediglich bei dem Gift Brodifacium reicht eine Menge von 45-1000g aus, um einen Hund zu töten.
3.4 Erfolge der Rattenbekämpfung
Es lässt sich nur schwer sagen, ob eine Rattenbekämpfung erfolgreich war oder nicht, denn man hat keinen Überblick darüber, wie viele Ratten getötet wurden, da sie sich meist zum Sterben in Verstecke zurückziehen. Sowieso weiß man nie genau, ob die Anzahl der Ratten gerade steigt oder sinkt, da das Zählen der Tiere nahezu unmöglich ist. Außerdem werden nie alle Ratten vernichtet, so dass sich die Rattenpopulation meist schon nach kurzer Zeit erholt. Die Rattenbekämpfung kann also nicht zum Ziel haben, sämtliche Ratten in einem bestimmten Gebiet zu vernichten, sondern lediglich ihre Anzahl zu verringern bzw. konstant zu halten. Ob die Rattenbekämpfung aber überhaupt in dem Maße nötig ist, in dem sie betrieben wird, stellt ein Projekt (1994-97) in Zürich von Isabelle Landau (Zoologin) und Karl Dorn (Laborant) in Frage. Sie beobachteten die Rattenpopulation über drei Jahre hinweg, in denen kein Gift in die Kanäle ausgelegt wurde. Das Ergebnis ist erstaunlich: Die Rattenpopulation war nicht größer geworden. Dies hat verschiedene Ursachen. „Im Kanal können beispielsweise schlicht die Bankette fehle, auf denen die frischgeworfenen Jungen ihre ersten Stunden und Tage verbringen.“(8) Außerdem führt Platznot automatisch zu einer kleineren Geburtenrate. Es wurde jedoch nicht untersucht, inwiefern dieses Projekt auch auf andere Städte übertragbar ist.
3.5 Vorbeugung
Besser als die Ratten zu bekämpfen, ist es von vornherein dafür zu sorgen, dass Ratten keine Lebensgrundlage haben. Dies können vor allem Privatpersonen tun, um zu verhindern, dass Ratten sich im Haus oder auf dem Grundstück ansiedeln. Wenn man folgende Punkte beachtet, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Ratten sich ansiedeln.
- Einwanderungsmöglichkeiten im Kellerund Dachboden verschließen
- Keine Essensreste wie Brot und Fleisch auf den Komposthaufen tun
- Haustiernahrung nicht offen stehen lassen, Futternäpfe nach dem Füttern
reinigen
- Geschlossene Müllbehälter verwenden
- Unterschlupfmöglichkeiten z.B. Sperrmüllhaufen, beseitigen
3.5 Gesetzliche Aspekte
Ratten sind Wirbeltiere und fallen damit unter das Tierschutzgesetz. Nur ausgebildete Fachleute dürfen gewerbsmäßig der Rattenbekämpfung nachgehen. Bei dem Auslegen des Giftes sind ganz bestimmte Sicherheitsmaßnahmen (Schutzkleidung, Rauchverbot..) zu beachten. Außerdem dürfen nur vom Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin geprüfte und anerkannte Gifte verwendet werden.
4 Schluss
Die Auseinandersetzung mit dem Thema Ratten und ihre Bekämpfung hat mir gezeigt, dass Ratten sehr intelligente Tiere sind und daher ihre Bekämpfung nicht einfach ist. Um erfolgreich zu sein, muss man ihre Gewohnheiten (z.B. Fressverhalten) genau kennen und nutzen.
Überraschend war für mich das Ergebnis des Versuches von Isabelle Landau und Karl Dorn. Es wäre wünschenswert, wenn in diese Richtung weitere Untersuchungen gemacht würden und somit eine Übertragung auf andere Städte und Gebiete möglich wäre. Dadurch würde die Rattenbekämpfung eingedämmt werden und es würden weniger Tiere getötet werden. Auch wäre es ein Vorteil für die Städte, da sie nun nicht mehr so viele finanzielle Mittel für die Rattenbekämpfung aufbringen müssten.
5 Anhang
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1; oben: Wanderratte Mitte: Laborratte unten: Hausratte
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.2; oft paaren sich Weibchen mit mehreren Männchen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.3+4; Ratte bei der Aufzucht der Jungen im Nest
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6; Ratten können große Fressschäden anrichten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.5; Ratten fressen einen großen Teil der Lebensmittel
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.7; Ein auf Pfeilern errichteter Speicher, zum Schutz vor Ratten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.8; eine, durch vergiftetes Getreide gestorbene Ratte
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.9; Lagenser Rattenbekämpfer beim Gift auslege
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 10; Anwendung des giftigen Schaums an einer Wärmedämmung, die durch Ratten stark beschädigt wurde.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.11; Lebendfalle
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.12; Totschlagfalle
6 Literaturverzeichnis
Bibliographische Angaben der Zitate
(1) Heide Platen: Das Rattenbuch, 1997 Frankfurt/Main, Goldmann, S.101
(2) Heide Platen: Das Rattenbuch, S.105
(3) www.cbgnetwork.org/Ubersicht/Zeitschrift_SWB/SWB02_00/Pestitide
(4) www.schaedlinge-online.de/pestcontrol_news.html
(5) Heide Platen: Das Rattenbuch, S.103
(6) Heide Platen: Das Rattenbuch, S.101
(7) Heide Platen: Das Rattenbuch, S.99
(8) Paul Bösch: Tages Anzeiger, 9.7.1997, Zürich
Bildnachweis
Abb.1 GEO, 1990/5, S.180
Abb.2 GEO, 1990/5, S.173
Abb.3 GEO, 1990/5, S.174
Abb.4 GEO, 1990/5, S.174
Abb.5 GEO, 1990/5, S.183
Abb.6 GEO, 1990/5, S.183
Abb.7 Westfälisches Freilichtmuseum Detmold, 1982, S.69
Abb.8 GEO, 1990/5, S.184
Abb.9 Heike von Schulz, Lippische Regionalzeitung (Zeitungsverlag und Erscheinungsdatum unbekannt)
Abb.10 home.t-online.de/home/strothmann/aus%20der%20Praxis/ratten2.html
Abb.11 www.co.san-diego.ca.us/cnty/cntydepts/landuse/env_health/chd/vrathist.html Abb.12 www.co.san-diego.ca.us/cnty/cntydepts/landuse/env_health/chd/vrathist.html
Quellenangaben
Gisela Bulla: Ratten als Heimtiere, 1990 München, Gräfe und Unzer Verlag
Martin Meister: GEO, 1990/5, S. 168-190
Heide Platen: Das Rattenbuch, 1997 Frankfurt/Main, Goldmann
Meyer Grosses Taschen Lexikon, 1998 Mannheim, B.I.-Taschenbuchverlag
MorgenWelt Science-Ticker, 20.10.2000
Informationsblätter des Bauhofs Lage
www.schaedlinge-online.de
www.giftfrei.de/Rattentext.hat,l
home.t-online.de/home/strothmann/aus%20der%20Praxis/ratten2.html
home.t-online.de/home/secure/nager.htm
www.meb.uni-bonn.de/giftzentrale/rattengift.html
www.cbgnetwork.org/Ubersicht/Zeitschrift_SWB/SWB02_00/Pestitide
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Facharbeit?
Diese Facharbeit behandelt das Thema Rattenbekämpfung und untersucht die Ursachen, Methoden und Probleme bei der Bekämpfung von Ratten.
Welche Rattenarten werden in der Facharbeit hauptsächlich behandelt?
Die Facharbeit konzentriert sich hauptsächlich auf die Hausratte (Rattus rattus) und die Wanderratte (Rattus norvegicus), die beiden bekanntesten Rattenarten weltweit.
Warum ist die Rattenbekämpfung so wichtig?
Ratten können erhebliche Schäden verursachen, indem sie Lebensmittelvorräte verunreinigen, Bau- und Verpackungsmaterialien annagen und Krankheiten auf Menschen und Tiere übertragen.
Welche Krankheiten können von Ratten übertragen werden?
Ratten können Krankheiten wie Gelbsucht, Lassa-Fieber, Salmonellen, Typhus, Cholera, Ruhr, Tuberkulose, Maul- und Klauenseuche und die Pest übertragen.
Welche Methoden der Rattenbekämpfung werden in der Facharbeit behandelt?
Die Facharbeit behandelt chemische Methoden (Rattengifte, Puder, Schaum) und nichtchemische Methoden (Lebendfallen, Totschlagfallen, Ultraschall).
Was sind Rodentizide und wie wirken sie?
Rodentizide sind Gifte, die zur Rattenbekämpfung eingesetzt werden. Sie wirken hemmend auf die Vitamin-K-Synthese in der Leber, was zu einer verzögerten Blutgerinnung und inneren Blutungen führt.
Welche Probleme gibt es bei der Rattenbekämpfung?
Ein großes Problem ist die zunehmende Resistenz der Ratten gegen die eingesetzten Gifte. Außerdem dürfen die Gifte keine anderen Tiere gefährden.
Was kann man tun, um Rattenbefall vorzubeugen?
Um Rattenbefall vorzubeugen, sollte man Einwanderungsmöglichkeiten im Keller und Dachboden verschließen, keine Essensreste auf den Komposthaufen tun, Haustiernahrung nicht offen stehen lassen, geschlossene Müllbehälter verwenden und Unterschlupfmöglichkeiten beseitigen.
Was sind die gesetzlichen Aspekte der Rattenbekämpfung?
Ratten sind Wirbeltiere und fallen damit unter das Tierschutzgesetz. Nur ausgebildete Fachleute dürfen gewerbsmäßig der Rattenbekämpfung nachgehen. Es dürfen nur geprüfte und anerkannte Gifte verwendet werden, und es sind Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Facharbeit?
Die Facharbeit kommt zu dem Schluss, dass Ratten sehr intelligente Tiere sind und ihre Bekämpfung daher nicht einfach ist. Um erfolgreich zu sein, muss man ihre Gewohnheiten genau kennen und nutzen. Es wäre wünschenswert, wenn weitere Untersuchungen zur Reduzierung des Gifteinsatzes durchgeführt würden.
- Arbeit zitieren
- Claudia Glose (Autor:in), 2002, Rattenbekämpfung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106285