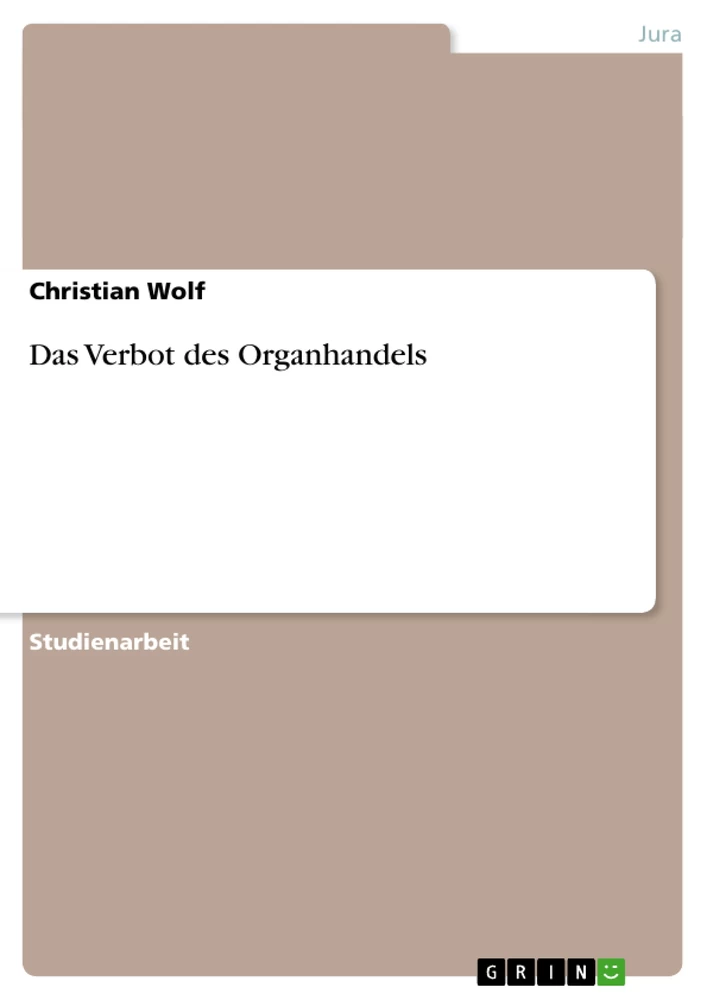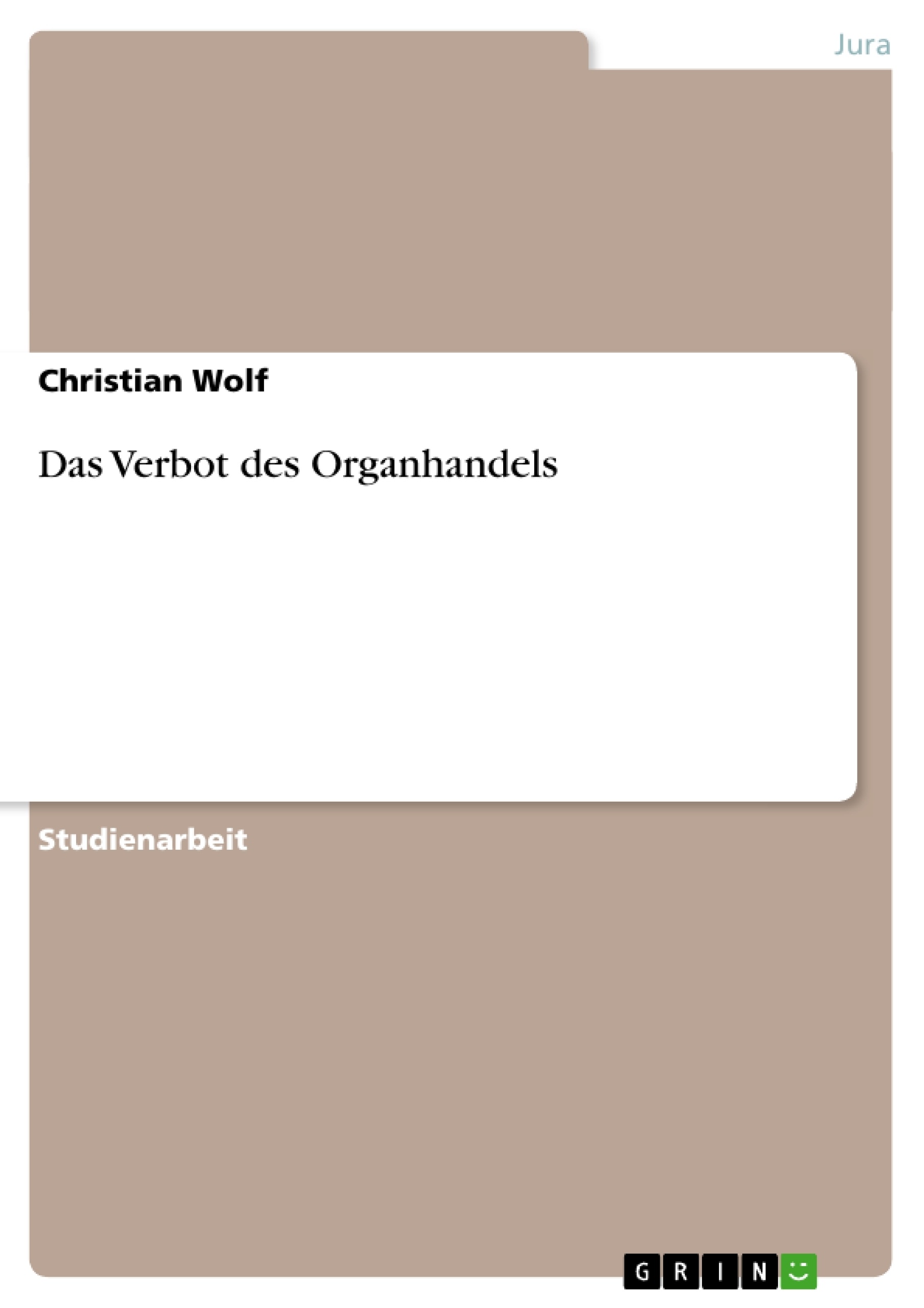Gliederung
A. Einleitung
1. Zur Aktualität des Themas: Beispiele
2. Allgemeine Bemerkungen zu Entwicklung und Stand in der Transplantationsmedizin
B. Das Verbot des Organhandels
1. Das Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen - Transplantationsgesetz (TPG) vom 5.11. 1997
a) Regelungsbereiche des TPG
b) Internationale und supranationale Beschlüsse zur Ächtung des Organhandels
2. Verbotsregelungen und Strafvorschriften des TPG für Organhandel
a) Organe im Sinne des TPG
b) Handeltreiben im Sinne des TPG
c) Heilbehandlung und ihre Abgrenzung
d) Die Entgeltklausel
3. Die geschützten Rechtsgüter
4. Die Tathandlungen
a) Der Spender als Organhändler
b) Probleme der Lebendspende: Eingrenzung des Personenkreises
c) Strafnormen für Ärzte
d) Der Organempfänger und Organhandel
C. Zusammenfassung
A. Einleitung
Der deutsche Gesetzgeber hat 1997 mit dem Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen – Transplantationsgesetz (TPG)1 ein grundlegendes Regelwerk für die Transplantationsmedizin geschaffen.
Dies geschah vor dem Hintergrund eines stetigen Fortschritts in diesem Zweig der Humanmedizin, der mit wachsendem Misstrauen und zunehmender Verunsicherung in der Bevölkerung einherging. Einerseits konnte sich die Transplantation von Organen und Gewebe in den letzten 25 Jahren zum Standard der medizinischen Versorgung 2 entwickeln. Durch Einsatz neuer Immunsuppressiva konnten Abstoßfunktionen des Immunsystems gegen das Implantat verringert und damit die Dauer seiner Funktionsfähigkeit wesentlich erhöht werden. Immer mehr chronisch und akut erkrankten Menschen konnte die Transplantationsmedizin Heilung oder Besserung und Linderung des Leidens verschaffen. Andererseits ging die Spendebereitschaft in der Bevölkerung Anfang der neunziger Jahre in Deutschland stark zurück, was zu einem Anwachsen von Wartelisten infolge eines Mangels an verfügbaren Organen führte.
Die negative Reaktion der Bevölkerung wurde auch in Zusammenhang mit Berichten in den Medien über Organhandel und Transplantationstourismus gesehen. Der Gesetzgeber hat mit dem Transplantationsgesetz einen spezialgesetzlichen Straftatbestand für Organhandel geschaffen. Diesen aufzuzeigen und zur Diskussion zu stellen ist Aufgabe dieser Arbeit.
1. Zur Aktualität des Themas: Beispiele
In den letzten Jahren haben Meldungen in den Medien für Aufmerksamkeit gesorgt, in denen über spektakuläre Fälle von Organhandel, bzw. dessen Anbahnung, berichtet wurde. So hatte ein US-Bürger nach einer Meldung der Nachrichtenagentur AP eine seiner Nieren für einen Mindestpreis von 25.000 US-Dollar (45.700 Mark)
beim Internetauktionshaus eBay offeriert. Als eBay das Angebot aus dem Netz nahm, lag das letzte Gebot bei 5,7 Millionen US-Dollar (10,4 Millionen Mark)3.
In Deutschland unterlag ein Mann aus Niedersachsen im Prozess gegen seine Krankenkasse. Der Mann hatte sich in Bombay von einem Lebendspender eine Niere gegen Zahlung eines Entgeldes übertragen lassen. Die Kosten für die Operation in Höhe von 60.000 Mark wollte er von seiner Krankenkasse zurückerstattet bekommen. Das Bundessozialgericht in Kassel verneinte einen Erstattungsanspruch, da es in dem Vorgang einen Organhandel sah, der gegen die
Menschenwürde aus Art 1 I GG und die Guten Sitten verstoße.4
In Deutschland warten derzeit 13.000 Patienten auf ein Spenderorgan5. Zur Deckung eines Mindestbedarfes für Schwerkranke wird für Deutschland im Jahr 2000 eine Zahl von 7.300 Organen, darunter Niere, Herz, Leber, Lunge und Bauchspeicheldrüse, genannt. Tatsächlich konnten aber nach Angaben des Arbeitskreises Organspende im Jahre 2000 insgesamt nur 3819 Transplantationen vorgenommen werden. Diese Daten zeigen die große Nachfrage nach geeigneten Spenderorganen.
Befürchtungen angesichts eines ansteigenden Mangels geeigneter Spenderorgane könnte sich ein illegaler internationaler Organmarkt und -handel entwickeln, haben zu Entschließungen internationaler und supranationaler Gremien geführt, welche Organhandel ächteten und die Mitgliedsstaaten aufforderten, entsprechende Straftatbestände zu schaffen6. In Deutschland hat der Deutsche Bundestag am
25.06. 1997 das Transplantationsgesetz verabschiedet, das den Handel mit Organen verbietet und unter Strafe stellt.
2. Allgemeine Bemerkungen zu Entwicklung und Stand in der Transplantationsmedizin
Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom 13.5. 1991, sowie das Abkommen des Europarates: Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin: Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin vom 4.April 1997. Im Einzelnen dazu unter B.1.b.
Die Übertragung von Organen und Gewebeteilen gehört in den meisten Ländern mit einem hoch entwickelten Gesundheitssystem mittlerweile zur Standardversorgung. Unter dem Begriff ”Transplantation” wird die Übertrag von Organen und Gewebe auf ein anderes Individuum zu therapeutischen Zwecken verstanden.7 Für eine Transplantation kommen Nieren, Herz, Lunge, Bauchspeicheldrüse (Pankreas) und Leber in Betracht, ferner noch Augenhornhäute.
Die Transplantationsmedizin hat in den letzten Jahren enorme wissenschaftliche Fortschritte gemacht, unter anderem durch die Entwicklung neuer Medikamente, welche die Abstoßreaktionen des Immunsystems gegen das implantierte Organ wirksamer und nebenwirkungsärmer unterdrücken (Immunsuppressiva). Damit konnte auch die Lebensdauer von Transplantaten in den letzten Jahren stetig erhöht werden. In Deutschland wurden seit der ersten Nierentransplantation 1963 mehr als
60.000 Organe übertragen8.
In Deutschla nd stehen jedoch wie oben bereits angeführt nach Berechnungen des Arbeitskreis Organspende einem Mindestbedarf von 7.300 Organen pro Jahr nur fast die Hälfte tatsächlich zur Verfügung. Dies hat zur Bildung von Wartelisten geführt. Die Warteliste für Nieren steigt seit Jahren kontinuierlich an. In den letzten sechs Jahren mussten 1.996 Herzpatienten und 1.017 Leberpatienten wegen ihres schlechten Allgemeinzustandes von der Warteliste genommen werden, einige verstarben zwischenzeitlich.
Die Bundesregierung hat auf der Grundlage des Transplantationsgesetzes über das Bundesgesundheitsministerium, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Zusammenarbeit mit Initiativen und Verbänden eine breite Werbe- und Informationskampagne zum Thema Organspende9 gestartet.
B. Das Verbot des Organhandels
1. Das Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen - Transplantationsgesetz (TPG) vom 5.11. 1997
Das Transplantationsgesetz wurde am 25. Juni 1997 vom Deutschen Bundestag verabschiedet. Die Kompetenz hierzu ergibt sich aus Art 74 I Nr. 26 GG, für die strafrechtliche Sanktionierung des Organhandels auch aus Art 74 I Nr. 1 GG im
Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung. Der Bundesrat stimmte am 26. September 1997 zu. Im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde das Regelwerk am 5.11.1997, in Kraft trat es zum 1.12.1997. Grundlage des Transplantationsgesetzes war ein gemeinsamer Gesetzentwurf der CDU/CSU, SPD und FDP Bundestagsfraktionen.
Das Transplantationsgesetz beendete eine Zeit latenter Rechtsunsicherheit im Bundesgebiet, da bislang spezialgesetzliche Regelungen fehlten.
Bis zum Inkrafttreten des TPG galten die allgemeinen Rechtsgrundsätze, hinzu kam ein Transplantationskodex der deutschen Transplantationszentren in Form einer Zusammenfassung der wichtigsten ethischen, medizinischen und juristischen Grundlagen. In diesem Kodex befand sich auch eine ausdrückliche Ablehnung jeglicher Kommerzialisierung der Organspende10.
Für den Bereich der ehemaligen DDR galten nach den Bestimmungen des
Einigungsvertrages die DDR-Normen als Landesrecht unter Vorbehalt der Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz weiter, wurden jedoch wegen verfassungsrechtlicher Bedenken nicht mehr angewandt.
a) Regelungsbereiche des TPG
Das Transplantationsgesetz regelt im zweiten Abschnitt in den §§ 3-7 die Organentnahme bei Toten (postmortale Explantation), darin auch die Frage der Feststellung des Todes und des Zustimmungsverfahrens durch Angehörige. Im dritten Abschnitt wird in § 8 die Lebendspende und ihre Voraussetzungen geregelt, sowie im einzelnen das Verfahren für Organübertragungen (§§ 9 -12 ), ferner ärztliche Richtlinien über den Stand der Wissenschaft, Meldeverfahren, Fristen und Fragen des Datenschutzes (§§ 13-16) und letztlich im sechsten und siebten Abschnitt Tatbestand (§ 17) und Rechtsfolge eines Organhandels (§ 18), sowie weitere Ordnungswidrigkeiten und Bußgelder.
In seinen Schluss- und Änderungsbestimmungen fügt das Transplantationsgesetz dem Strafgesetzbuch in § 5 (Auslandstaten gegen inländische Rechtsgüter) eine
neue Nummer 15 ein. Somit umfasst das deutsche Strafrecht unabhängig vom Recht des Tatortes auch Organhandel i.S.d. § 18 TPG im Ausland. Damit soll das Interesse der Bundesrepublik Deutschland berührender internationaler Organhandel, insbesondere im Bereich der Vermittlungstätigkeiten, erfasst werden11.
Ziel des Transplantationsgesetzes soll die ”zivil und strafrechtliche Absicherung der Organspende und Organentnahme zum Zweck der Übertragung auf andere Menschen” (BT-Drucksache 13/4355), die gesundheitsrechtliche Absicherung der Organtransplantation ”sowie das strafbewehrte Verbot des Organhandels” (ebd.) sein. Ferner soll ein klarer rechtlicher Handlungsrahmen geschaffen werden, der Rechtsunsicherheiten ausräumt und dem Rückgang der Zahl von Organspenden entgegenwirkt.
b) Internationale und supranationale Beschlüsse zur Ächtung des Organhandels
Angesichts breiter Verelendung der Bevölkerung in Drittweltstaaten soll es einen Organmarkt in Ländern wie Ägypten, Indien und Irak bereits geben. Um wirtschaftliche Not zu lindern böten Menschen ihre Organe Käufern aus Wohlstandstaaten zum Kauf an, große Beträge des Kaufpreises blieben bei Organhändlern12. Aus Sorge vor einem internationalen Organhandel und Organmarkt, einhergehend mit der Ausnutzung von Notlagen wirtschaftlicher Art bei Spendern und lebensbedrohlicher Art bei erkrankten Menschen, haben sich auch internationale Staatenorganisationen mit dem Thema befasst.
[...]
1 BGBl. I 1997, 2631 ff.
2 BT-Drucksache 13/4355 Entwurf eines Gesetzes über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen (Transplantationsgesetz), Gesetzentwurf von CDU/CSU, SPD und FDP, vom 16.04. 1996
3 Meldung der Nachrichtenagentur AP vom 03.09.1999; Laut eBay handelt es sich nicht um einen Einzelfall.
4 BSG, 1 RK 25/95, Meldung aus FAZ vom 16. 04. 1997. Die Entscheidung des BSG erfolgte also vor Inkrafttreten des Transplantationsgesetzes.
5 Daten aus der Pressemitteilung der Bundesministerin für Gesundheit, Nr. 52, 11.07.2000
6 Zu nennen sind hier die Entschließung (78) 29 des Europarates vom 11.5. 1978, die 25 Leitsätze der
7 Pschyrembel,”Transplantation”, Seite 1591
8 Quelle: Deutsche Stiftung Organspende (DSO), Internet. Die DSO ist Koordinierungsstelle im Sinne des TPG
9 vgl. ”Schenken sie Leben” der BZgA, ”Künstler für Organspende” des Arbeitskreis Organspende.
10 Vgl. BT -Drucksache 13/4355
11 Lackner/Kühl § 5 Rn. 3
12 König, Das strafbewehrte Verbot des Organhandels, in Roxin/Schroth, S. 266, dort unter Fn. 8 m.w.N., verwiesen wird auch auf die BSG -Entscheidung, zitiert unter Fn. 4
13 Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument?
Dieses Dokument ist eine umfassende Vorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter umfasst. Es behandelt das Thema des Verbots des Organhandels im Kontext des deutschen Transplantationsgesetzes (TPG) von 1997.
Was ist das Transplantationsgesetz (TPG)?
Das Transplantationsgesetz (TPG) ist ein deutsches Gesetz vom 5. November 1997, das die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen regelt. Es wurde als Reaktion auf Fortschritte in der Transplantationsmedizin und Bedenken in der Bevölkerung über Organhandel und Transplantationstourismus erlassen. Es schafft einen rechtlichen Rahmen für Organtransplantationen und verbietet den Organhandel.
Was sind die Hauptregelungsbereiche des TPG?
Das TPG regelt die Organentnahme bei Toten (postmortale Explantation), die Lebendspende und ihre Voraussetzungen, das Verfahren für Organübertragungen, ärztliche Richtlinien, Meldeverfahren, Fristen, Fragen des Datenschutzes und die Tatbestände und Rechtsfolgen des Organhandels.
Was versteht man unter Organhandel im Sinne des TPG?
Das TPG verbietet den Handel mit Organen. Der genaue Wortlaut und die Auslegung der entsprechenden Paragraphen sind detailliert im Gesetz zu finden. Die Arbeit geht auf die Definitionen von Organen, Handeltreiben, Heilbehandlung und die Entgeltklausel ein.
Welche internationalen Beschlüsse gibt es zur Ächtung des Organhandels?
Verschiedene internationale und supranationale Gremien, wie der Europarat und die Weltgesundheitsorganisation (WHO), haben Entschließungen zur Ächtung des Organhandels verabschiedet und die Mitgliedsstaaten aufgefordert, entsprechende Straftatbestände zu schaffen.
Welche Fortschritte wurden in der Transplantationsmedizin erzielt?
Die Transplantationsmedizin hat in den letzten Jahren enorme wissenschaftliche Fortschritte gemacht, insbesondere durch die Entwicklung neuer Medikamente (Immunsuppressiva), die Abstoßreaktionen des Immunsystems wirksamer unterdrücken und die Lebensdauer von Transplantaten verlängern.
Wie ist die Organspendesituation in Deutschland?
In Deutschland besteht ein Mangel an Spenderorganen, was zu Wartelisten führt. Die Bundesregierung hat Werbe- und Informationskampagnen zur Förderung der Organspende gestartet.
Welche Rolle spielt der Organempfänger beim Organhandel?
Das Dokument beleuchtet die Rolle des Organempfängers im Kontext des Organhandels, wobei spezifische Details aus dem Transplantationsgesetz abgeleitet werden.
Wie werden Ärzte im Zusammenhang mit Organhandel bestraft?
Das Dokument untersucht die Strafnormen für Ärzte, die in Organhandel verwickelt sind, und liefert Einblicke in die rechtlichen Konsequenzen, denen sie im Rahmen des Transplantationsgesetzes gegenüberstehen.
Was sind die geschützten Rechtsgüter im Zusammenhang mit dem Verbot des Organhandels?
Das Dokument erörtert die Rechtsgüter, die durch das Verbot des Organhandels geschützt werden, und bietet ein tieferes Verständnis der ethischen und rechtlichen Überlegungen.
- Arbeit zitieren
- Christian Wolf (Autor:in), 2001, Das Verbot des Organhandels, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106331