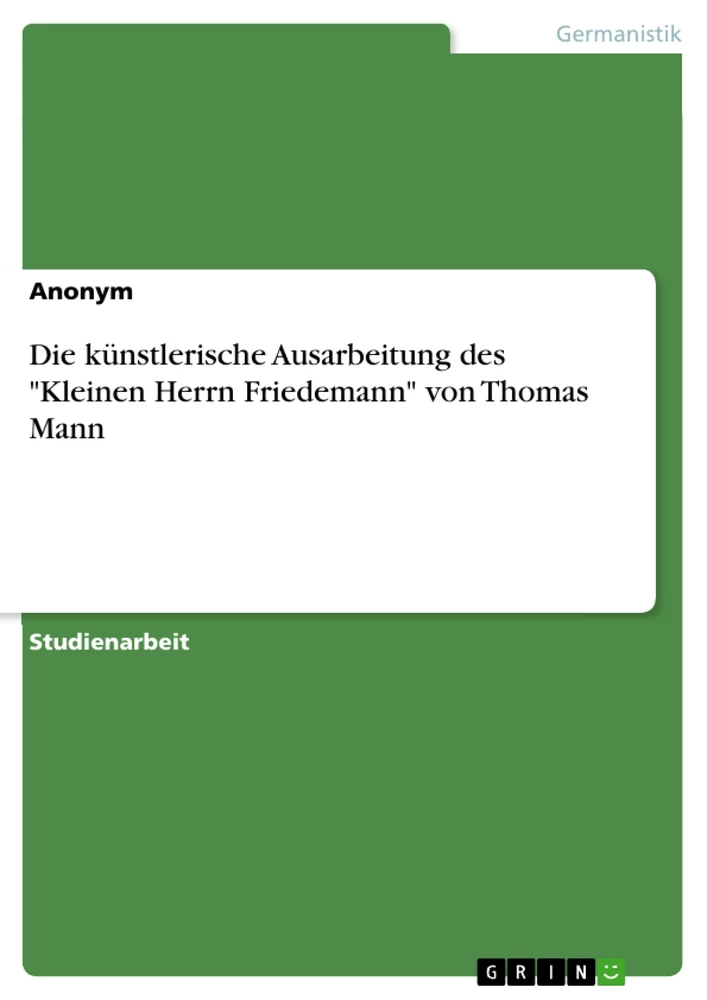Die vorliegende Arbeit widmet sich der Forschungsfrage: "Was hat es für die künstlerische Ausarbeitung vom kleinen Herrn Friedemann zu bedeuten, dass er körperlich gehandicapt ist?" "Der kleine Friedemann" ist eine Novelle von Thomas Mann, welche sich mit dem Leben des Johannes Friedemann auseinandersetzt. Das Leben des Protagonisten ist von seiner körperlichen Konstitution stark beeinträchtigt. Auf Johannes Friedemanns offensichtliche Stigmatisierung wird bereits auf der oberflächlichsten Textebene verwiesen: Nämlich dann, wenn der Erzähler sprachlich immer wieder auf Friedemanns Äußeres abzielt - nicht zuletzt aber durch das seine Beschreibung nahezu jederzeit schmückende euphemistische Beiwerk "kleine/r".
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Motiv des „Handicaps“ innerhalb der Novelle
- Die „Einschränkungen“ des Friedemann
- Gerdas Freundlichkeit
- Leiden durch den deformierten Körper
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die künstlerische Bedeutung der körperlichen Behinderung des Protagonisten Johannes Friedemann in Thomas Manns Novelle „Der kleine Herr Friedemann“. Die Analyse fokussiert auf die Art und Weise, wie Friedemanns Stigma durch den Erzähler und seine Umwelt dargestellt wird und welche Auswirkungen dies auf sein Leben und seine Beziehungen hat.
- Die Auswirkungen von Stigmatisierung auf das Selbstbild und die soziale Interaktion
- Die Rolle von Mitleid und Freundlichkeit im Umgang mit Behinderten
- Die Ambivalenz der Beziehung zwischen Friedemann und Gerda von Rinnlingen
- Die Verbindung von körperlicher Missbildung und innerem Leid
- Die Bedeutung von gesellschaftlichen Normen und Erwartungen für die Wahrnehmung von Behinderung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor: Welche Rolle spielt die körperliche Behinderung des kleinen Herrn Friedemann in der künstlerischen Ausarbeitung der Novelle? Es werden die zentrale Bedeutung des Stigmas und die sprachliche Darstellung des Protagonisten als „kleiner“ Herr Friedemann beleuchtet.
Das Motiv des „Handicaps“ innerhalb der Novelle
Die „Einschränkungen“ des Friedemann
Dieser Abschnitt analysiert, wie die Behinderung des Protagonisten im Kontext der gesellschaftlichen Normen zum „Problem“ wird. Die Arbeit stellt heraus, dass Friedemanns Stigma durch die Reaktionen seiner Umgebung, die von „wehmütiger Freundlichkeit“ bis zu „befangener Zurückhaltung“ reichen, geprägt wird.
Gerdas Freundlichkeit
Dieser Abschnitt untersucht Gerda von Rinnlingens Verhältnis zu Friedemann. Die Analyse befasst sich mit der Frage, ob Gerdas Verhalten gegenüber Friedemann Ausdruck von Grausamkeit oder vielmehr ein Spiegelbild seiner eigenen Unsicherheit und Schwäche ist. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass Gerda im Gegensatz zu anderen Menschen in Friedemann ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft sieht und ihn nicht mitleidig behandelt.
Leiden durch den deformierten Körper
In diesem Abschnitt wird die Triade aus Verlangen, Verzicht und Heimsuchung, die im Werk von Thomas Mann eine zentrale Rolle spielt, auf Friedemanns Leben angewendet. Es wird gezeigt, wie seine Behinderung seine Lebensfreude zerstört und ihn letztendlich zum Tod führt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen wie Stigma, Behinderung, Missbildung, Mitleid, Freundlichkeit, Außenseitertum und gesellschaftliche Normen. Darüber hinaus werden zentrale Figuren und ihre Beziehungen zueinander, wie Johannes Friedemann und Gerda von Rinnlingen, analysiert.
Häufig gestellte Fragen
Welche zentrale Forschungsfrage untersucht die Arbeit?
Die Arbeit untersucht, welche Bedeutung die körperliche Behinderung des Johannes Friedemann für die künstlerische Ausarbeitung der Novelle von Thomas Mann hat.
Wie wird Friedemanns Stigmatisierung im Text deutlich?
Die Stigmatisierung zeigt sich sprachlich durch die ständige Verwendung des Euphemismus „kleine/r“ sowie durch die Reaktionen seiner Umwelt, die zwischen Mitleid und Befangenheit schwanken.
Welche Rolle spielt Gerda von Rinnlingen für den Protagonisten?
Gerda wird als ambivalente Figur analysiert. Im Gegensatz zu anderen behandelt sie Friedemann nicht mitleidig, was bei ihm sowohl Verlangen als auch tiefes Leid auslöst.
Was thematisiert der Abschnitt „Leiden durch den deformierten Körper“?
Er behandelt die Triade aus Verlangen, Verzicht und Heimsuchung, die letztlich dazu führt, dass Friedemanns Behinderung seine Lebensfreude zerstört.
Welche gesellschaftlichen Aspekte werden in der Novelle kritisiert?
Die Arbeit beleuchtet, wie gesellschaftliche Normen und Erwartungen die Wahrnehmung von Behinderung prägen und den Protagonisten zum Außenseiter machen.
Was ist das Fazit der Analyse zur künstlerischen Ausarbeitung?
Die körperliche Missbildung ist untrennbar mit dem inneren Leid verknüpft und dient als zentrales Motiv für die Darstellung von Isolation und dem Scheitern an der Realität.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Die künstlerische Ausarbeitung des "Kleinen Herrn Friedemann" von Thomas Mann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1064376