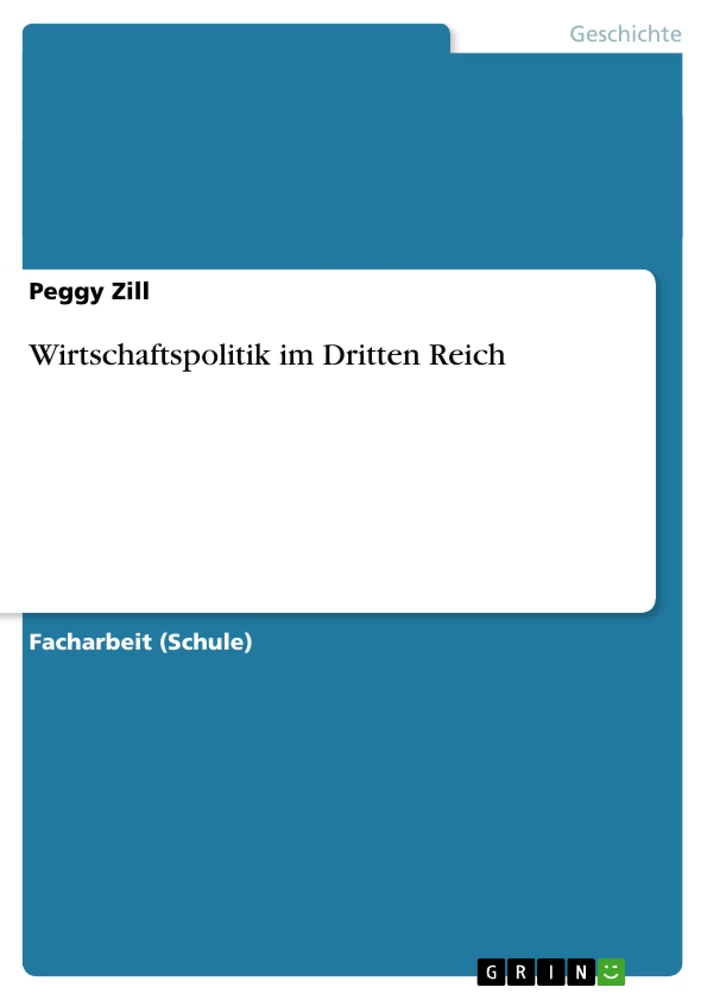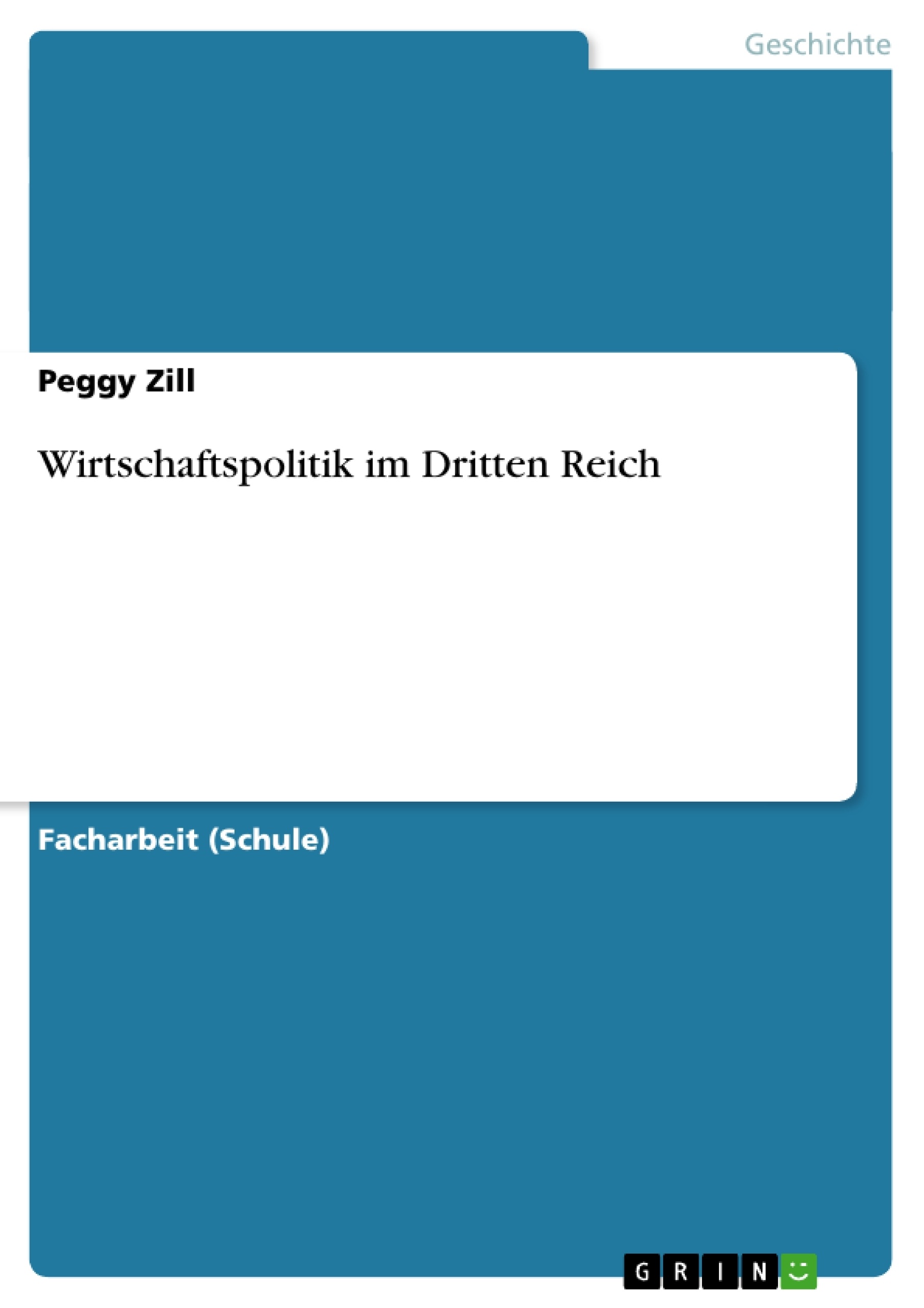Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Grundzüge der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik
2.1 Arbeit und Arbeitsbeschaffung
2.2 Finanzielle Lage
2.3 Der Vierjahresplan
2.4 So zog Deutschland in den Krieg
3 Carl Wolf: Roßweiner Achsen-, Federn- und Gesenkschmiede
3.1 Geschichte des Betriebes
3.2 Betriebssituation von 1933 bis 1945
4 Schlusswort
5 Literaturverzeichnis
6 Anhang
7 Eidesstattliche Erklärung
1 Einleitung
Die Aufgabenstellung für die hier vorliegende Facharbeit erhielt ich von meinem Geschichtslehrer Herrn Freyer und lautete: Beschreiben Sie die Grundzüge der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik und stellen Sie deren Umsetzung an einem von Ihnen ausgewählten Betrieb dieser Zeit aus Ihrer Heimatregion dar! Die größte Schwierigkeit Material zu finden, lag darin, einen Betrieb zu finden, der zu dieser Zeit existierte und über den es noch Dokumente gab. Viele Schriften aus dieser Zeit wurden nämlich zerstört. Somit mußte ich mich an das Staatsarchiv Leipzig wenden. Dort in alten Originalakten zu lesen und zu recherchieren, machte das Thema informativ. Und auch wenn über einen Betrieb aus Nossen nichts zu finden war, hoffe ich, dass die Ausarbeitung die Fragestellung befriedigend beantwortet. Anfangs werde ich allgemein auf die Wirtschaftspolitik des Dritten Reichs eingehen, bevor ich die praktische Umsetzung am Beispiel des Betriebes „Carl Wolf“ beschreiben werde.
2 Grundzüge der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik
2.1 Arbeit und Arbeitsbeschaffung
„ [...] Hitlers Hauptziele in seiner Wirtschaftspolitik waren die propagandische Wirkung einer Beseitigung der Arbeitslosigkeit und die Vorbereitung eines Krieges [...] “(Quelle 1, S. 90). Bei der Arbeitsbeschaffung stand aber immer im Vordergrund, ob diese Maßnahmen der „Wehrhaftmachung“ dienen. Denn -13- das meiste Geld wurde für das Militär investiert (siehe Anhang, Seite I). Adolf Hitlers größter Erfolg war die Überwindung der Arbeitslosigkeit innerhalb von vier Jahren. Dies war jedoch nicht allein sein Verdienst. Nach der Weltwirtschaftskrise blühten Handel und Produktion in vielen Ländern wieder auf. Allerdings setzte er sich mehr für die Arbeitsbeschaffung ein als seine Vorgänger.
Für Frauen gab es ein sogenanntes „Ehestandsdarlehen“, das heißt dass sie entschädigt wurden, wenn sie heirateten und somit Arbeitsplätze frei wurden. Die Frau gehörte nämlich laut nationalsozialistischen Weltbild an den Herd in die Küche. Diese Einstellung änderte sich schnell, als der Krieg begann und durch die Einberufung der Männer es zu einer regelrechten Armut kam. Die entstandenen Lücken wurden von den Frauen gefüllt. Sie wurde somit Mutter, Familienversorgerin, Fabrikarbeiterin und Luftschutzhelferin. Anfangs versuchte man noch mit Werbeaktionen die Frauen dazu zubringen, dass sie freiwillig eine Arbeitsstelle annehmen, als man jedoch feststellte, dass dies wenig Erfolge verzeichnete, folgte der Arbeitszwang. Jeder arbeitsfähige mußte somit Arbeitsdienst leisten und der Staat bestimmte ebenfalls wo. „Der Arbeiter in der deutschen Rüstungsindustrie hat die ihm gestellten Aufgaben im Betrieb mit dem gleichen Pflichtbewußtsein zu erfüllen, wie der Soldat an der Front“ (Quelle 1, S. 284).
Der zusätzliche Einsatz von Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen und Jugendlichen war nötig, um die Produktion einigermaßen halten zu können. Ausländischen Zwangsarbeitern wurde immer weniger gezahlt als Deutschen und sie litten oft an Unterernährung. Sie mußten täglich von Montag bis Samstag elf Stunden arbeiten und erhielten dabei nur ca. 1000 RM im Jahr. Die Kriegsgefangenen wohnten vorwiegend in Konzentrationslagern, die für die Rüstungsindustrie arbeiteten.
Die Zahl der Beschäftigten in der Rüstungsindustrie stieg von 2,4 Mio. im Mai 1939 auf 5,3 Mio. im Mai 1941.
Hitler hatte es in einem Jahr geschafft die Arbeitslosenzahlen von sechs auf vier Millionen zu senken. Im Sommer 1935 mußten die Männer und Jugendlichen zur Reichswehr und zum Arbeitsdienst, so kam es, dass die Arbeitslosigkeit von 1,7 Millionen bis 1937 auf weniger als eine Million sank.
2.2 Finanzielle Lage
Die Ausgaben konnten nicht durch die Steuereinnahmen gedeckt werden. Deshalb hoffte man durch eine Wirtschaftsbelebung, dass die Steuereinnahmen steigen würden und man seine Schulden tilgen kann. Die Ausgaben stiegen aber immer weiter, wodurch Hitler befiehl, dass die Sparkassen und Banken so viel Einlagen, wie möglich an das Reich abgaben. Das Vermögen der Bevölkerung wurde somit für die Kriegswirtschaft ausgegeben. Die Verschuldung Deutschlands konnte damit aber auch nicht gelöst werden. Der Schuldenberg wuchs sogar noch mehr. Bei Kriegsausbruch lag die Summe bei 15 Milliarden Reichsmark und zum Ende des Krieges war Deutschland mit mehr als 400 Milliarden RM verschuldet. Zu Beginn dachte man noch, dass durch einen erfolgreichen Krieg die Schulden wieder abgezahlt werden könnten. Aber Hitler war dies egal. Er war der Meinung, dass wenn sie diesen Krieg verlieren, alles verloren sei.
2.3 Der Vierjahresplan
In der Rohstoffversorgung und der Ernährung der Bevölkerung herrschten große Mängel. Und durch die steigende Rüstungsproduktion entstanden noch größere Lücken. Hitler sah deshalb ein, dass man die Versorgungskrise irgendwie beenden müsse. Deshalb „ [...] gab [er] an Göring folgenden Auftrag: ‚Ich halte es für notwendig, daß nunmehr mit eiserner Entschlossenheit auf allen Gebieten eine hundertprozentige Selbstversorgung eintritt, auf denen diese möglich ist. Ich stelle somit folgende Aufgabe: I. Die deutsche Armee muß in 4 Jahren einsatzbereit sein. II. Die deutsche Wirtschaft muß in 4 Jahren kriegsfähig sein‘“(Quelle 1, S. 93) .Daraus wurde 1936 dann der sogenannte „Vierjahresplan“, welcher von Adolf Hitler am 9.September 1936 auf dem Reichsparteitag in Nürnberg verkündete und der am 18. Oktober 1936 erlassen wurde. Die zentrale wirtschaftliche Planung übernahm Hermann Göring. Daneben gab es noch das Wiederaufrüstungsprogramm von 1936.
Darum kümmerte sich das Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt unter General Georg Thomas. Durch verschiedene Instanzen wurde die Rüstung vorangetrieben. Man wollte vom Ausland unabhängig werden. Heimische Rohstoffe sollten abgebaut werden und Ersatzrohstoffe erzeugt werden. Hitler stellte sich beispielsweise vor aus Kohle Benzin herzustellen. Um die dazu notwendigen Produktionsmethoden sollten sich allerdings die Industriellen selbst kümmern.
Die Privatwirtschaft mußte sich fortan um staatliche Produktionsprogramme kümmern. Und durch erwartete Kriegsgewinne wollte man die Menschen entschädigen.
Und obwohl einzelne Grundstoffe vermehrt produziert wurden, gab es bei der Versorgung immer noch große Lücken. Hitler hatte sich selbst und die deutsche Wehrmacht vor nicht zu bewältigende Aufgaben gestellt. Der drohende Zusammenbruch veranlasste ihn einen Krieg zu beginnen.
2.4 So zog Deutschland in den Krieg
Zu den bereits oben genannten Bedingungen (hohe Verschuldung, schlechte Vorbereitung, etc.) kam hinzu, dass nur 26 U-Boote einsatzbereit waren. Die Produktion von Treibstoff in den Hydrierwerken lag um 45% unter der Planung. Dazu kam die spätere Zerstörung der Werke. Und Rohstoffe waren Mangelwaren, besonders die Kupfervorräte waren verbraucht. So zog Deutschland in den Krieg! Die vierjährige Vorbereitungszeit wurde nicht mal annähernd eingehalten. Hitler setzte sich über alle Risiken hinweg. Und durch die Blitzkriegerfolge schien er lange Zeit Recht zu behalten. Jedoch fehlte auch alles, was für einen längeren Krieg erforderlich war. In erster Linie an Rohstoffen, wie Eisenerz, Nichteisenmetallen und Öl. Indem so alles auf die Karte „Blitzkrieg“ gesetzt wurde, nahm Deutschland bewußt den Mangel der fehlenden „Tiefenrüstung“ auf sich. Damit ist gemeint, dass die Gesamtumstellung der Wirtschaft auf Krieg fehlte und somit die zentrale Planung, strengste Einsparungen, Umbau von zivilen Fabriken in Rüstungsbetriebe, Schichtsystem, um maschinelle Kapazitäten auszunutzen zahlreiche Frauenarbeit usw.. England hingegen hatte sich auf einen langen Krieg eingestellt und somit früh die Weichen umgestellt. Das deutsche Rüstungspotenzial, das heißt der gleichmäßig starke Nachschub an Flugzeugen, Panzern, U-Booten, Geschützen, Handfeuerwaffen und Munition entsprach allerdings auf keinem Fall den Anforderungen. Die Rüstung konnte zwar rasch umorganisiert werden, um beispielsweise den Bedarf der Flotte zu erhöhen, aber mußte dabei in anderen Bereichen reduziert werden, etwa bei Panzern und Munition. Die Kapazität blieb immer gleich, lediglich der Schwerpunkt wurde verschoben.
Im übrigen wurde geradezu friedensmäßig weiter produziert. Durch den Import von ausländischen Arbeitskräften, Rohstoffen und Nahrungsmitteln, konnten manche Engpässe sogar beseitigt werden.
Sogar vor dem Einmarsch in Rußland wurde beschlossen, die Rüstung zu vermindern. Dabei war nicht einmal Winterkleidung für die Soldaten vorgesehen. Nicht unbegründet sagte General Thomas deshalb 1939 in einer Rede, dass Deutschland lediglich eine Übergangswirtschaft betreibe, keine Kriegswirtschaft. Fritz Todt war derjenige, der später die Autobahnen und den Westwall errichten ließ. Vom ihm stammt auch das System der Ausschüsse, das die befähigten Leute eines Produktionszweiges zusammenfassen sollte. Die Ausschüsse begannen ihre Arbeit mit einem Vergleich der Herstellung - methoden, Lieferfristen, Preise, der Qualität und des Rohstoff -verbrauchs in Betrieben und leiteten die Rationalisierung ein. Todt wußte, dass sie das Militär nicht wirtschaftlich planbar ist und die Rüstung nur in den Händen von erfahrenen Zivilisten und Industriemanagern voranzutreiben geht. Am 10. Januar 1942 kam der Wendepunkt. Hitler schwenkte von Blitzkrieg in die Tiefenrüstung. Die Produktionserhöhung auf allen wichtigen militärischen Gebieten wurde befohlen. Der neue „Reichsminister für Bewaffnung und Munition“ war Albert Speer. Er trimmte die Wirtschaft sofort auf Höchstleistung. Und obwohl sich die Wirtschaft damals wieder etwas erholte, konnte die 1940/41 verlorene zeit nicht wieder aufgeholt werden, sodass der Krieg schließlich verloren wurde. Nicht zuletzt aufgrund der Zerstörung vieler wichtiger Betriebe, wie beispielsweise der Hydrierwerke in Ruhrgebiet, die 90 Prozent des Treibstoffes für Flugzeuge lieferten und der Zerstörung der Verkehrswege, was bedeutete, dass kein Rohstofftransport mehr stattfinden konnte.
3 Carl Wolf: Roßweiner Achsen-, Federn- und Gesenkschmiede
3.1 Geschichte des Betriebes
Der Betrieb wurde 1855 von Karl Friedrich Wolf gegründet und konzentrierte sich hauptsächlich auf Achsenherstellung. Nach der Übergabe an seinen Sohn Carl Moritz Wolf 1877 produzierte man Fahrzeugfedern. Aufgrund der hohen Nachfrage und des somit ständigen Wachstums der Schmiede errichtete man 1890 ein neues Schmiedegebäude. 1910 folgte schließlich die eigene Metallgießerei. Und ein Jahr später trat Dr. Carl Wolf als Teilhaber bei.
Während des ersten Weltkriegs bestanden die Aufträge zum größten Teil aus Heeresaufträgen. Durch den Krieg fehlten aber Arbeiter, da die meisten Männer eingezogen wurden. Die Fabrikation mußte aber gesichert sein, sodass man zahlreiche Frauen einstellte. In der Zeit von 1914-1917 steigerte sich der jährliche Umsatz von 0,8 Millionen Reichsmark (RM) auf 2,2 Mio. RM. Nach dem Krieg entwickelte man ein neues Fertigungsverfahren: die Gesenk- maschine. Außerdem kaufte man größere Schmiedeaggregate, elektrische Stumpfschweiß- und Lichtbogenschweißmaschinen, Schleifmaschinenhalbautomaten, Vierspindel- und Vollmutterautomaten sowie Revolverdrehbänke. Der Betrieb entwickelte sich immer mehr und die offizielle Bezeichnung lautete: „Carl Wolf - Inh.: Dipl.-Ing. Dr. Carl Wolf Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen, Wagenachsen und -federn, Gesenkschmiede und Herdfabrik“. Die Fabrik war schon lange nicht mehr nur in Deutschland bekannt. Sie hatte auch Abnehmer in ganz Europa und Übersee. Mit der Inflation 1923 folgte eine große finanzielle Erschütterung, die sich kurz besserte. Durch die Weltwirtschaftskrise von 1929-32 geriet die Schmiede -13- jedoch erneut in finanzielle Probleme. Erst durch die Machtübernahme der Nazis 1933 verbesserte sich die Auflage. Ende 1933 beschäftigte der Betrieb 450 Arbeiter. Durch einen Defekt an der Ölheizung brannte 1936 das gesamte Gebäude aus und mußte neu errichtet werden. Nur durch die Kriegsvorbereitung und die damit verbundenen Aufträge konnte man die Produktion wieder soweit steigern, dass der Betrieb erhalten blieb. Bereits Ende 1939 hatte man 650 Beschäftigte. Mit dem Kriegsanfang fielen jedoch viele Arbeitskräfte aus und man mußte erneut Frauen einstellen. Als der Bedarf weiter stieg, kam es zu Zwangsarbeitern- und Kriegsgefangeneneinstellungen, die aus Frankreich, der Tschechoslowakei, Polen, Belgien, Holland und der Sowjetunion kamen. Teilweise wurden auch Jugendliche beschäftigt. Man konzentrierte sich zu dieser Zeit besonders auf die Herstellung von Karabinern und anderen Kriegswerkzeugen. 1944 hatte Carl Wolf 1000 Angestellte! Er steigerte den Jahresumsatz von 3,9 Mio. RM auf 12,8 Mio. RM. Nach dem Krieg erfolgte auf Grund des Befehls Nr. 124 der SMAD die Beschlagnahmung des Schmiedewerks. Bis es 1948 schließlich in Volkseigentum umgewandelt wurde.
Am 1. Januar 1951 kam es zur Vereinigung wegen „sozialistischer Rekonstruktion“ mit der Firma Kadner & Co.. Diese beiden Betriebe zusammen waren bis zur Wende die VEB Roßweiner Achsen-, Federn- und Schmiedewerke „Hermann Matern“.
Auch heute existiert es noch als Press- und Schmiedewerk GmbH.
Allerdings nicht mehr in der früheren Größe und auch mit wesentlich weniger Arbeitern (ca. 40). Der größte Teil wurde abgerissen und neu bebaut.
3.2 Betriebssituation von 1933-1945
Im Allgemeinen ging es dem Betrieb besonders während des 2. Weltkriegs finanziell sehr gut. Allerdings fehlten, durch Wehrdienst und Todesfälle (siehe Diagramm im Anhang), genügend Arbeiter, um weiterhin die Heeresaufträge erfüllen zu können und die Produktion zu sichern. Darum schickte man immer mehr Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene. Aus einem Brief von Carl Wolf an
-13-
das Arbeitsamt in Döbeln vom 8. Dezember 1942 geht jedoch hervor, das er wegen mangelnden deutschen Facharbeitern nicht mehr in der Lage wäre immer mehr ungelernte Ausländer aufzunehmen. Er forderte deshalb möglichst gelernte Ausländer. Nach einer Absprache mit Inspektor Bechel hätte er sich allerdings entschlossen vorerst die vierzehn Kriegsgefangenen Franzosen zu nehmen, wenn aber später Fachkräfte eintreffen, solle der Austausch erfolgen. Dennoch beschäftigte er im Mai 1943 601 Inländer, 43 Ostarbeiter, 106 zivile Ausländer, 83 Russen und 93 sonstige Kriegsgefangene und im Oktober nur noch 533 Inländer , 158 Ausländer und 170 Kriegsgefangene. Innerhalb von fünf Monaten erhöhte sich somit die Zahl der Arbeiter von 926 auf 990! Um einmal die Abgänge zu verdeutlichen, habe ich den Monatsbericht vom Oktober 1944 ausgewählt. Hieraus geht hervor, dass 11 Inländer zum Wehrdienst mußten, 9 in einen anderen Betrieb versetzt wurden, 5 geflüchtet sind, genauso viele aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeitsfähig waren, 4 gestorben sind und eine Frau Mutter geworden ist. Aus den Gefolgschaftsmitgliederlisten und den monatlichen Berichten geht allerdings hervor, dass keine Juden beschäftigt waren, wie es beispielsweise im damaligen Roßweiner EBRO-Werk war oder in der Nossner NOVA Rüstungsfirma (später VEB Möbelkombinat an der Klostermühle). Die Häftlinge kamen aus dem Konzentrationslager Pitzschbachtal (heute Reifen Bahlau, Altzella) und produzierten für die Rüstungsindustrie. Warum Carl Wolf keine Arbeiter aus diesem KZ beschäftigte, konnte ich leider nicht herausfinden.
Die meisten Arbeiter hatten meist eine 36-Stunden-Woche und verdienten im Durchschnitt 70 RM. Beschäftigt waren unter anderen Schleifer, Dreher, Schlosser, Maurer, Fahrer und Fräser. Die Arbeitszeiten gingen aber auch weit auseinander. Manche arbeiteten am Tag nur 3 Stunden, andere wiederum 11. Somit fielen auch die Lohnzahlungen unterschiedlich aus. Ab und zu erfolgte auch die Verteilung von Prämien, um den Arbeitern Motivation zu geben.
Dabei stellte Major Basjak 400 RM zur Verfügung, die dann unter 15 Personen verteilt wurden. Aus einem Rundschreiben vom 26. Juni 1942 ging hervor, dass die Betriebsbesitzer ihre Arbeiter fördern und gerecht behandeln müssen, damit sie hohe Leistung bringen können.
Am 21. September 1945 erhielt der Betrieb den Auftrag 100 Kranbrücken anzufertigen, welchen er auch gern entgegengenommen hätte. Dazu fehlte jedoch das Material und Carl Wolf bestellte Schweißgeräte. Und 1937 lagerten 30000 Geschosse in der Firma wegen Munitionsstop. Aufgrund dieses Materialmangels folgten Entlassungen, um den Betrieb zu retten. Denn es gab zwar Aufträge und Arbeiter, aber ohne Material konnte nichts hergestellt werden und man verdiente kein Geld und konnte keine Löhne zahlen. In einem späterem Schreiben fordert man sie wiederum auf die Karabinerproduktion um 42 Prozent zu steigern, mit allen (auch unmenschlichen) Mitteln.
Seit September 1945 wurden alle Beschäftigten für die russische Kommission entlassen oder zur Firma Kadner versetzt.
4 Schlusswort
Im allgemeinen war die Wirtschaft schlecht organisiert und es war von vornherein abzusehen, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen ist. Auf kurze Zeit konnte man viele kleine Blitzkriege gewinnen. Um aber in einem Krieg auf längere Zeit bestehen zu können, war die Wirtschaft aber noch zu schwach. Gute Ideen und Pläne, wie der Vierjahresplan waren zwar vorhanden, wurden aber nicht perfekt geplant und durchgeführt. Bei dem von mir gewählten Beispiel des Schmiedewerkes in Roßwein wurde die praktische Umsetzung gut deutlich.
5 Literaturverzeichnis
1 Bleyer, Wolfgang/ Drechsler, Karl/ Förster, Gerhard/ Hass, Gerhart: Lehrbuch der Geschichte: Deutschland 1939-1949. 1. Auflage, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin: 1969, 94-100, 284-288.
2 Buchow, Fedor/Weißer, Mechthild: Encarta Enzyklopädie 99. Microsoft Corporation, USA: 1993- 1998, nachgeforscht unter „Nationalsozialismus“ und „Vierjahresplan“.
3 Carl Wolf: Roßweiner Achsen-, Federn- und Gesenkschmiede. Staatsarchiv Leipzig. MI. IA, 24, 30, 33, 58 ,92.
4 Friedrichs, Hanns Joachim: Illustrierte Deutsche Geschichte: vom Werden einer Nation. Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft, Köln: 1991, 260-261.
5 Immisch, Joachim: Zeitgeschichte: Von der Oktoberrevolution bis zur Gegenwart. Hg. Erich Goerlitz und Joachim Immisch, Band 4, Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn: 1983, 90-93.
6 Michalka, Wolfgang: Das Dritte Reich: Dokumente zur Innen- und Außenpolitik. Band 2, Deutscher Taschenbuch Verlag, München: 1985, 158-231.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Dokuments "Inhaltsverzeichnis"?
Das Dokument ist eine Facharbeit, die sich mit der Wirtschaftspolitik des Nationalsozialismus in Deutschland beschäftigt. Es beschreibt die Grundzüge dieser Politik und untersucht deren Umsetzung am Beispiel des Betriebs "Carl Wolf: Roßweiner Achsen-, Federn- und Gesenkschmiede" in Roßwein.
Welche Themen werden in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung erklärt die Aufgabenstellung der Facharbeit und die Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung. Sie gibt einen Überblick über die Gliederung der Arbeit, beginnend mit der allgemeinen Wirtschaftspolitik des Dritten Reichs, gefolgt von der praktischen Umsetzung am Beispiel des Betriebs "Carl Wolf".
Was sind die Grundzüge der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik?
Die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik zielte hauptsächlich auf die Beseitigung der Arbeitslosigkeit und die Vorbereitung auf einen Krieg ab. Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung waren eng mit der "Wehrhaftmachung" verbunden. Die Überwindung der Arbeitslosigkeit wurde als großer Erfolg dargestellt, jedoch war die Aufrüstung des Militärs der Hauptfokus.
Wie wurden Frauen in die Arbeitsbeschaffung einbezogen?
Frauen erhielten "Ehestandsdarlehen", wenn sie heirateten und dadurch Arbeitsplätze freimachten. Während des Krieges wurden Frauen jedoch aufgrund des Arbeitskräftemangels in Fabriken und anderen Bereichen eingesetzt, teilweise unter Zwang.
Wie war die finanzielle Lage Deutschlands während des Nationalsozialismus?
Die Ausgaben wurden hauptsächlich durch Kredite und die Ausnutzung des Vermögens der Bevölkerung finanziert, da die Steuereinnahmen nicht ausreichten. Die Verschuldung stieg enorm an, besonders während des Krieges.
Was war der Vierjahresplan?
Der Vierjahresplan wurde 1936 von Adolf Hitler verkündet und von Hermann Göring geleitet. Ziel war die Sicherstellung der Rohstoffversorgung und die Vorbereitung der deutschen Wirtschaft auf den Krieg. Man versuchte, unabhängig von ausländischen Rohstoffen zu werden.
Wie zog Deutschland in den Krieg?
Deutschland zog mit erheblichen Mängeln in den Krieg, darunter eine hohe Verschuldung, mangelnde Vorbereitung und unzureichende Rohstoffversorgung. Die geplante vierjährige Vorbereitungszeit wurde nicht eingehalten, und die Wirtschaft war nicht ausreichend auf einen langen Krieg vorbereitet.
Was ist über den Betrieb "Carl Wolf: Roßweiner Achsen-, Federn- und Gesenkschmiede" bekannt?
Der Betrieb wurde 1855 gegründet und spezialisierte sich auf die Herstellung von Achsen und Federn. Im Laufe der Zeit erweiterte er seine Produktion und beschäftigte bis zu 1000 Angestellte während des Zweiten Weltkriegs. Nach dem Krieg wurde der Betrieb beschlagnahmt und in Volkseigentum umgewandelt.
Wie war die Betriebssituation bei Carl Wolf während des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs?
Der Betrieb profitierte finanziell vom Zweiten Weltkrieg. Arbeitskräftemangel wurde durch den Einsatz von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen kompensiert. Es gab jedoch auch Materialmangel, der zu Entlassungen führte.
Was passierte mit dem Betrieb "Carl Wolf" nach dem Krieg?
Nach dem Krieg wurde der Betrieb beschlagnahmt und in Volkseigentum umgewandelt. Später wurde er mit der Firma Kadner & Co. zur VEB Roßweiner Achsen-, Federn- und Schmiedewerke "Hermann Matern" zusammengelegt. Heute existiert er als Press- und Schmiedewerk GmbH, jedoch in kleinerem Umfang.
Welche Literatur wurde für die Facharbeit verwendet?
Die Facharbeit stützt sich auf verschiedene Quellen, darunter Lehrbücher zur deutschen Geschichte, Enzyklopädien, Archivmaterialien des Staatsarchivs Leipzig und Dokumente zur Innen- und Außenpolitik des Dritten Reichs.
- Quote paper
- Peggy Zill (Author), 2001, Wirtschaftspolitik im Dritten Reich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106453