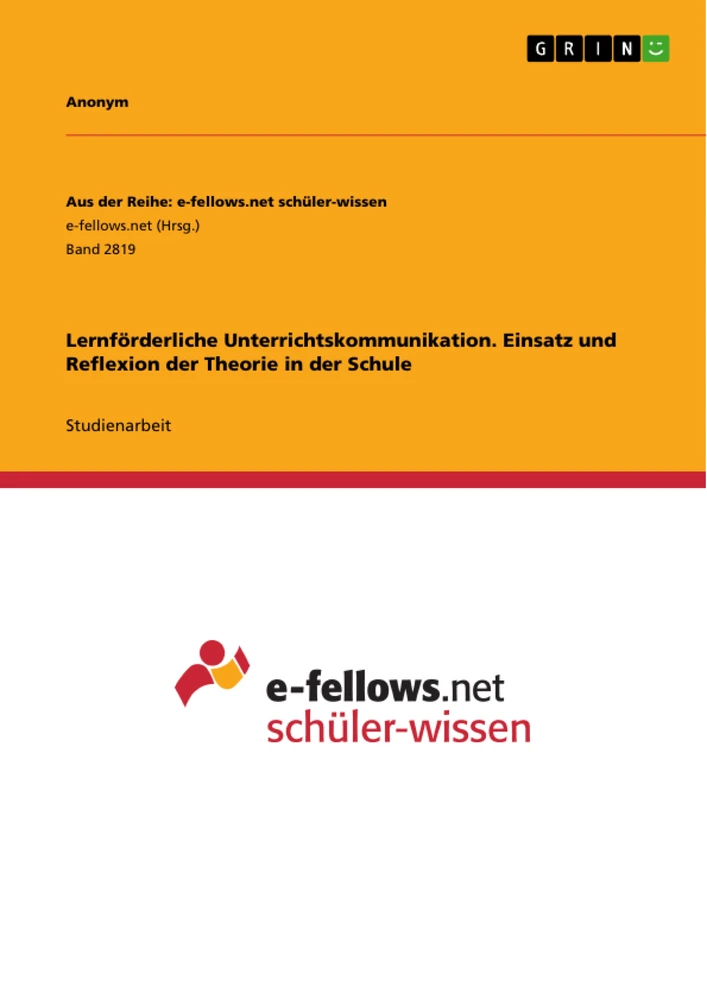Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich somit mit der Interaktion zwischen Lehrern und Schülern und wie diese so gestaltet werden kann, dass sie das Lernen besonders fördert. Dafür wird zunächst in einem theoretischen Teil ein Überblick über die verschiedenen Definitionen der lernförderlichen Unterrichtskommunikation gegeben. Des Weiteren werden Möglichkeiten der Aus-, Fort- und Weiterbildung in diesem Bereich beschrieben und bewertet. Daran schließen sich meine eigenen Beobachtungen an meiner Praxisschule bezüglich der Kommunikation, die Planung, Begründung und Durchführung einer von der Autorin selbst gehaltenen Unterrichtsstunde sowie eine Reflexion an. Abschließend werden ein Fazit gezogen und mögliche Konsequenzen diskutiert.
Die Interaktion zwischen Lehrkräften und Schülern ist von enormer Wichtigkeit, damit die Thematik von den Schülern vollständig durchdrungen werden kann, diese zum Nachdenken angeregt werden und das Lernen auf diese Weise auch leichter fallen kann. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass nicht nur die Menge der Interaktion, sondern vor allem die Art und Weise entscheidend ist, inwiefern das Erreichen der Kompetenzen verbessert werden kann. Oft neigt man im Unterrichtsgespräch dazu, Monologe oder Dialoge zu führen, was bei den übrigen, nicht am Gespräch beteiligten Schülern in den meisten Fällen zu einer nachlassenden Konzentration führt. Viele Autoren, wie beispielsweise Alexander oder Michaels und O`Connor, beschäftigen sich mit der lernförderlichen Unterrichtskommunikation und betonen ebenso die Relevanz dieses Themas.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Auseinandersetzung
- Praktische Umsetzung und Reflexion
- Fazit
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die lernförderliche Unterrichtskommunikation und ihre Auswirkungen auf den Lernerfolg von Schülern. Ziel ist es, verschiedene Definitionen und Ansätze der lernförderlichen Unterrichtskommunikation zu beleuchten sowie ihre praktische Umsetzung und Reflexion im Kontext des Praxissemesters zu analysieren.
- Definitionen und Ansätze der lernförderlichen Unterrichtskommunikation
- Möglichkeiten der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich der lernförderlichen Unterrichtskommunikation
- Praktische Umsetzung und Reflexion der lernförderlichen Unterrichtskommunikation im Praxissemester
- Bewertung des Einflusses der lernförderlichen Unterrichtskommunikation auf den Lernerfolg
- Diskussion möglicher Konsequenzen für die Unterrichtspraxis
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der lernförderlichen Unterrichtskommunikation ein und beschreibt den Kontext des Praxissemesters. Sie beleuchtet die Bedeutung von Interaktion zwischen Lehrern und Schülern für den Lernerfolg.
Theoretische Auseinandersetzung
Dieser Abschnitt behandelt verschiedene Definitionen der lernförderlichen Unterrichtskommunikation und stellt unterschiedliche Ansätze und Forschungsrichtungen vor. Zudem werden Möglichkeiten der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich der lernförderlichen Unterrichtskommunikation beschrieben und bewertet.
Praktische Umsetzung und Reflexion
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen während des Praxissemesters. Die Planung, Begründung und Durchführung einer selbstgehaltenen Unterrichtsstunde werden reflektiert. Schwierigkeiten und Herausforderungen im Kontext der lernförderlichen Unterrichtskommunikation werden aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen dieser Arbeit sind: lernförderliche Unterrichtskommunikation, Dialogisches Lehren, Interaktion, Schüleraktivierung, Unterrichtsgespräch, Lehr-Lern-Zyklen, Fort- und Weiterbildung, Praxissemester, Reflexion.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Lernförderliche Unterrichtskommunikation. Einsatz und Reflexion der Theorie in der Schule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1064557