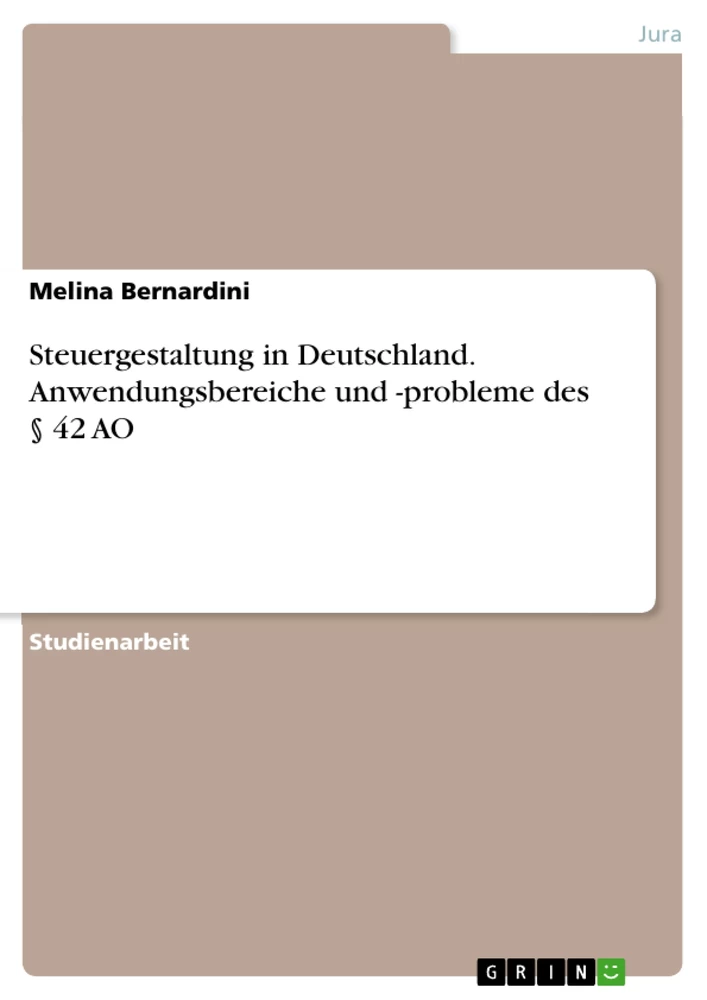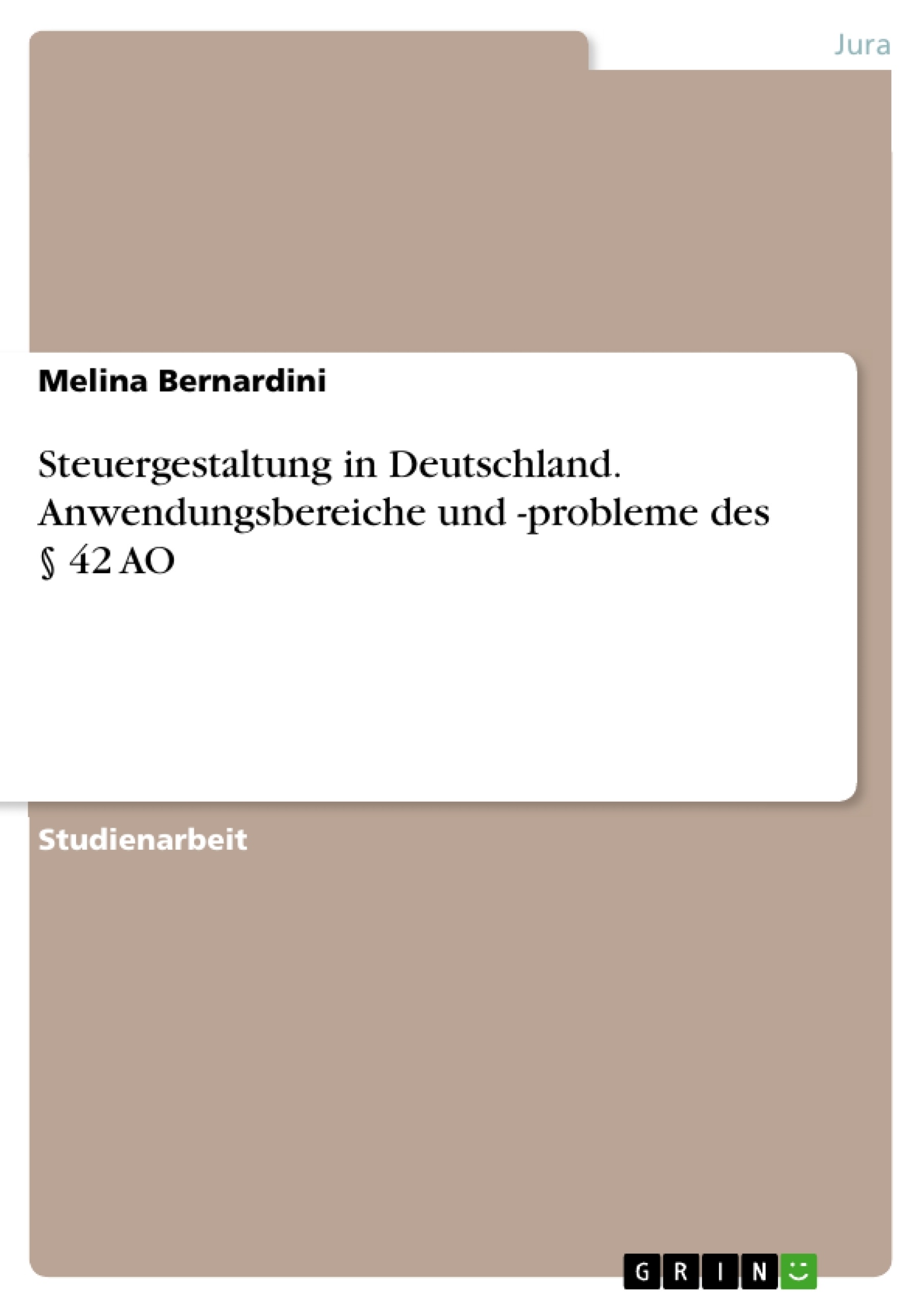Eine allgemeine Vorschrift für Gesetze ohne Einzelregelungen hält die Abgabenordnung fest. Die Funktion der Abgabenordnung ist es, Einzelsteuergesetze zu entlasten, um Wiederholungen zu vermeiden. Die Abgabenordnung ist in verschiedene Teile gegliedert. Bei dieser Arbeit handelt es sich um den § 42 AO, der sich im 2. Abschnitt vom 2. Teil der Abgabenordnung befindet und auf der Regelung des Steuerschuldrechtverhältnisses basiert. Zunächst stellt die Arbeit zwei Grundlegende Begriffe dar, die zum besseren Verständnis dienen. Daraufhin geht die Autorin auf die Entstehung und Entwicklung der Norm ein, um anschließend die Anwendungsbereiche darzustellen. Im 4. und 5. Abschnitt werden die Anwendungsprobleme des § 42 AO herausgearbeitet.
Das Ziel eines jeden Steuerpflichtigen ist die Niedrighaltung der Steuerbelastung. Das Interesse des Staates hingegen besteht in der Erzielung seiner Steuereinnahmen. Die Bestrebung einer gleichmäßigen Besteuerung verfolgen beide Interessensgruppen. Der Gesetzgeber eröffnet dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit seine Steuern gering zu halten, indem er seine Geschäftstätigkeit entsprechend anpasst. Um diese Vorgehensweise zu realisieren, werden diese beispielsweise individuell von einem Steuerberater erarbeitet, die von verschiedenen Faktoren abhängig sind. Dabei sind kreative und unkonventionelle Maßnahmen zur Steuerminderung aller Steuerarten einzuleiten. Der Oberbegriff im Steuerrecht für solche Handlungen wird als Steuergestaltung oder Steueroptimierung bezeichnet. Der Gesetzgeber setzt jedoch Grenzen beim Steuerersparnisstreben, insofern ein Gestaltungsmissbrauch im Rahmen einer Steuerumgehung vorliegt. Im Steuerrecht werden in den Einzelsteuergesetzen bestimmte Regelungen zur Vermeidung von missbräuchlicher Steuergestaltung erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Grundlegende Begriffe
- 1.1 Steuerumgehung
- 1.2 Steuerhinterziehung
- 2 Rechtsentstehung und -entwicklung des § 42 AO
- 2.1 Entwicklung bis zum Jahressteuergesetz 2008
- 2.2 Neufassung durch das Jahressteuergesetz 2008
- 3 Sinn und Zweck des § 42 AO
- 3.1 Inhalt und Prüfung des § 42 AO
- 3.2 Anwendungsbereiche
- 3.3 Anwendung anhand von Einzelfällen
- 4 Definitionsprobleme
- 4.1 Gesetzlich nicht vorgesehener Steuervorteil
- 4.2 Unangemessene Gestaltung
- 4.3 Außersteuerliche Gründe
- 5 Weitere Anwendungsprobleme des § 42 AO
- 5.1 Methodenproblem
- 5.2 Abgrenzungsprobleme zur Steuerhinterziehung
- 5.3 Steuerumgehungen durch Basisgesellschaften
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem § 42 der Abgabenordnung (AO), welcher die missbräuchliche Steuergestaltung unterbindet. Die Arbeit analysiert die Entstehung und Entwicklung des § 42 AO, beleuchtet dessen Anwendungsbereiche und untersucht die damit verbundenen Definitionsprobleme und Anwendungsprobleme.
- Die Bedeutung des § 42 AO für die Vermeidung von Steuerumgehungen
- Die Unterscheidung zwischen Steuerumgehung und Steuerhinterziehung
- Die Definition von "gesetzlich nicht vorgesehenem Steuervorteil" und "unangemessener Gestaltung"
- Die Anwendungsprobleme des § 42 AO, insbesondere die Abgrenzungsprobleme zur Steuerhinterziehung
- Die Rolle von Basisgesellschaften bei der Steuerumgehung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit stellt den § 42 AO in den Kontext der Steuergestaltung und Steueroptimierung und führt die wichtigsten Themen der Arbeit ein. Kapitel 1 definiert die grundlegenden Begriffe der Steuerumgehung und Steuerhinterziehung. Kapitel 2 beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des § 42 AO. Kapitel 3 diskutiert den Sinn und Zweck des § 42 AO und untersucht dessen Anwendungsbereiche.
Kapitel 4 analysiert die Definitionsprobleme im Zusammenhang mit dem § 42 AO, insbesondere die Definition von "gesetzlich nicht vorgesehenem Steuervorteil" und "unangemessener Gestaltung". Kapitel 5 behandelt weitere Anwendungsprobleme des § 42 AO, einschließlich der Methodenproblematik, der Abgrenzungsprobleme zur Steuerhinterziehung und der Steuerumgehungen durch Basisgesellschaften.
Schlüsselwörter
§ 42 AO, Steuerumgehung, Steuerhinterziehung, Steuergestaltung, missbräuchliche Steuergestaltung, Steuervorteil, Anwendungsbereiche, Definitionsprobleme, Anwendungsprobleme, Basisgesellschaften, Abgabenordnung
Häufig gestellte Fragen
Was regelt der § 42 der Abgabenordnung (AO)?
Der § 42 AO ist eine Missbrauchsklausel, die verhindern soll, dass Steuerpflichtige durch unangemessene rechtliche Gestaltungen Steuervorteile erlangen, die gesetzlich nicht vorgesehen sind.
Was ist der Unterschied zwischen Steuerumgehung und Steuerhinterziehung?
Steuerumgehung nutzt legale Gestaltungsmöglichkeiten missbräuchlich aus (§ 42 AO), während Steuerhinterziehung eine Straftat durch falsche oder unvollständige Angaben ist.
Wann gilt eine steuerliche Gestaltung als „unangemessen“?
Eine Gestaltung ist unangemessen, wenn sie nicht durch wirtschaftliche oder sonstige außersteuerliche Gründe gerechtfertigt werden kann und nur der Steuerersparnis dient.
Welche Rolle spielen Basisgesellschaften bei der Steuerumgehung?
Basisgesellschaften werden oft in Niedrigsteuerländern zwischengeschaltet, um Einkünfte dorthin zu verlagern. Der § 42 AO kann solche Konstrukte als Missbrauch einstufen.
Was änderte sich durch das Jahressteuergesetz 2008 am § 42 AO?
Die Neufassung konkretisierte die Kriterien für einen Gestaltungsmissbrauch und passte die Norm an die aktuelle Rechtsprechung an.
- Quote paper
- Melina Bernardini (Author), 2021, Steuergestaltung in Deutschland. Anwendungsbereiche und -probleme des § 42 AO, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1064634