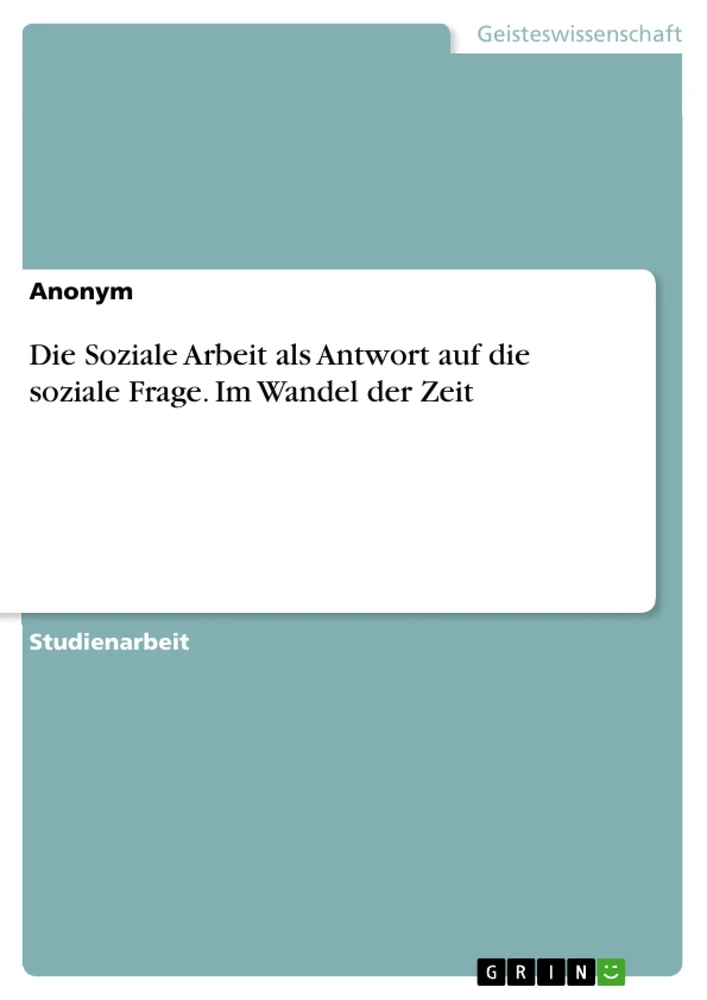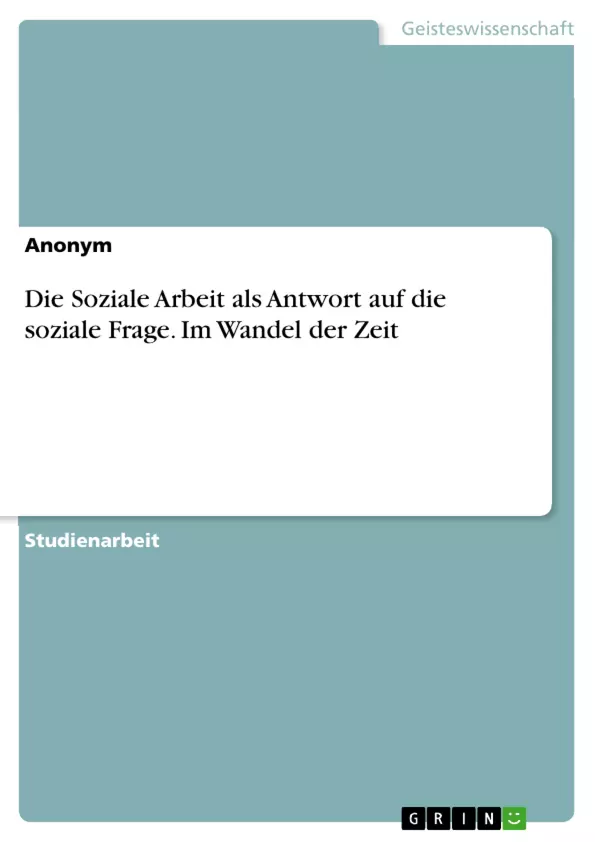In der vorliegenden Hausarbeit beschäftige ich mich mit dem Themenbereich der Sozialen Arbeit in Bezug auf die soziale Frage. Die folgende Hausarbeit bezieht sich auf die Frage, ob die Soziale Arbeit eine Antwort auf die soziale Frage darstellt. Im ersten Teil werden die Begriffe Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit, der Gegenstand der Sozialen Arbeit und die soziale Frage definiert. Im zweiten Teil wird die Entwicklung und Veränderung der Sozialen Arbeit, wie auch der sozialen Frage im Wandel der Zeit betrachtet. Die Darstellung der Sozialen Arbeit und der sozialen Frage beschreibe ich im zweiten Teil, um im Anschluss des diesen teils genauer auf die Zusammenhänge der Sozialen Arbeit und der sozialen Frage eingehen zu können. Die dann aufgeführten Zusammenhänge sollen Aufschluss darüber geben, ob die Soziale Arbeit die Antwort auf die Soziale Frage ist. Im weiteren Verlauf der Hausarbeit wird sich nun mit den gerade vorgestellten Themenbereichen anhand von Fachliteratur auseinandergesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung
- Gegenstand der Sozialen Arbeit
- Die soziale Frage
- Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit
- Die Soziale Arbeit im Wandel der Zeit
- Die Entwicklung der Sozialen Arbeit
- Heutiges Verständnis der Sozialen Arbeit
- Die Veränderung der sozialen Frage
- Zusammenhang zwischen dem gesellschaftlichen Wandel und der sozialen Frage
- Der Wandel der sozialen Frage von Beginn an bis Heute
- Ist die Soziale Arbeit die Antwort auf die soziale Frage?
- Der Zusammenhang zwischen der Sozialen Arbeit und der sozialen Frage
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Rolle der Sozialen Arbeit im Kontext der sozialen Frage. Sie untersucht, ob die Soziale Arbeit eine Antwort auf die sozialen Herausforderungen unserer Zeit darstellt. Dazu werden zunächst die grundlegenden Begriffe der Sozialen Arbeit, der sozialen Frage und des Verhältnisses von Wissenschaft und Praxis in der Sozialen Arbeit definiert. Anschließend wird die Entwicklung der Sozialen Arbeit und der sozialen Frage im Wandel der Zeit beleuchtet, um anschließend den Zusammenhang zwischen beiden Themenbereichen zu analysieren. Die Arbeit soll Aufschluss darüber geben, inwieweit die Soziale Arbeit in der Lage ist, die soziale Frage zu bewältigen.
- Definition des Gegenstands der Sozialen Arbeit
- Entwicklung der Sozialen Arbeit im historischen Kontext
- Analyse der sozialen Frage im Wandel der Zeit
- Zusammenhang zwischen der Sozialen Arbeit und der sozialen Frage
- Bewertung der Rolle der Sozialen Arbeit im Kontext der sozialen Frage
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Forschungsfrage in den Mittelpunkt: Ist die Soziale Arbeit eine Antwort auf die soziale Frage? Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die wichtigsten Themenbereiche, die im weiteren Verlauf behandelt werden.
Begriffsbestimmung
Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition zentraler Begriffe: dem Gegenstand der Sozialen Arbeit, der sozialen Frage und dem Verhältnis von Wissenschaft und Praxis in der Sozialen Arbeit. Es wird auf die Schwierigkeit eingegangen, den Gegenstandsbereich der Sozialen Arbeit präzise zu definieren, da unterschiedliche theoretische Perspektiven existieren. Die soziale Frage wird als Ausdruck der sozialen und politischen Folgen der Industrialisierung und der damit einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen beschrieben.
Die Soziale Arbeit im Wandel der Zeit
Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Sozialen Arbeit im historischen Kontext. Es werden wichtige Meilensteine und Veränderungen im Verständnis der Sozialen Arbeit dargestellt, wobei der Fokus auf der Veränderung der sozialen Frage liegt.
Die Veränderung der sozialen Frage
Der Wandel der sozialen Frage wird im Kontext des gesellschaftlichen Wandels untersucht. Es werden die unterschiedlichen Erscheinungsformen der sozialen Frage in verschiedenen Epochen beleuchtet, von der Industrialisierung bis zur heutigen Zeit.
Ist die Soziale Arbeit die Antwort auf die soziale Frage?
Dieses Kapitel geht der Frage nach, inwieweit die Soziale Arbeit eine Antwort auf die soziale Frage ist. Es werden die Zusammenhänge zwischen der Sozialen Arbeit und der sozialen Frage analysiert und die Möglichkeiten und Grenzen der Sozialen Arbeit bei der Bewältigung sozialer Probleme diskutiert.
Schlüsselwörter
Soziale Arbeit, soziale Frage, Wissenschaft, Praxis, Gesellschaftlicher Wandel, Industrialisierung, Sozialpolitik, Soziales Problem, Armut, Arbeitslosigkeit, Diskriminierung, Inklusion, Empowerment, Handlungskompetenz, Professionalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die „soziale Frage“?
Die soziale Frage beschreibt die sozialen und politischen Missstände, die durch die Industrialisierung entstanden sind, wie Armut und Arbeitslosigkeit.
Ist Soziale Arbeit die Antwort auf die soziale Frage?
Die Hausarbeit untersucht genau diesen Zusammenhang und analysiert, inwieweit die Soziale Arbeit zur Bewältigung dieser Probleme beitragen kann.
Wie hat sich die Soziale Arbeit im Laufe der Zeit verändert?
Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung von den Anfängen bis zum heutigen professionellen Verständnis der Sozialen Arbeit.
Welche Rolle spielt die Wissenschaft in der Sozialen Arbeit?
Es wird das Verhältnis zwischen der theoretischen Wissenschaft und der praktischen Anwendung in der Sozialen Arbeit definiert.
Was sind moderne Erscheinungsformen der sozialen Frage?
Neben klassischer Armut werden heute auch Themen wie Diskriminierung, Inklusion und Empowerment im Kontext der sozialen Frage diskutiert.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Die Soziale Arbeit als Antwort auf die soziale Frage. Im Wandel der Zeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1064731