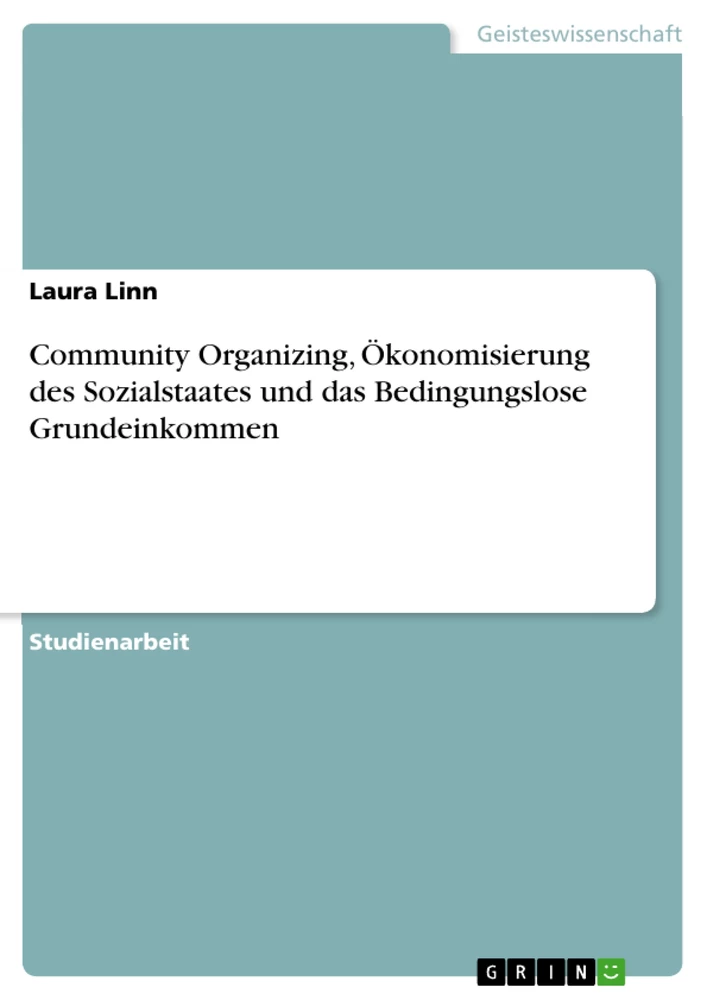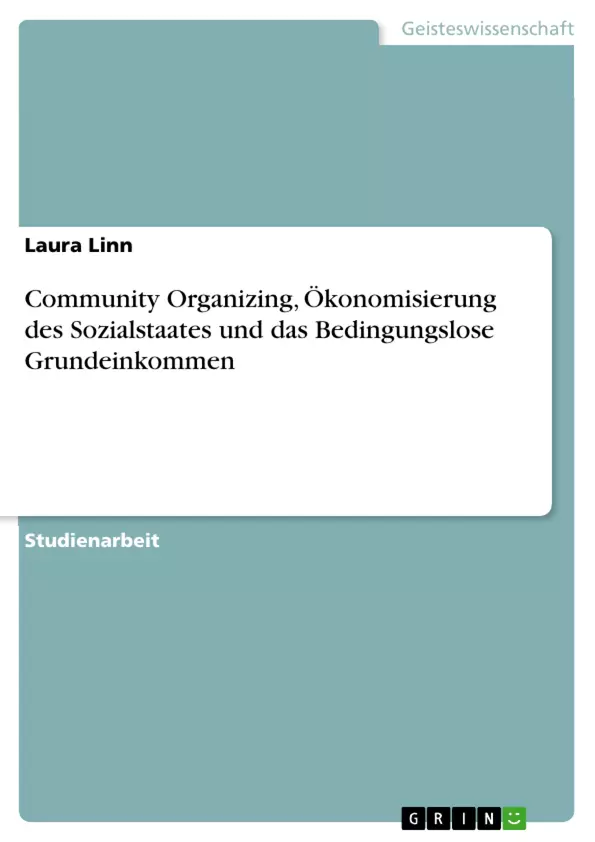Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit dem aus den USA stammenden Konzept des Community Organizings und dessen auf der Ökonomisierung des Sozialstaats basierenden Weiterentwicklung zum Transformative Community Organizing, beziehungsweise Tranformative Organizing. Im Anschluss nimmt sie einen Bezug zu dem Modell des Bedingungslosen Grundeinkommens als Antwort auf die Ökonomisierung des Sozialstaates sowie dem Projekt ‚Expedition Grundeinkommen‘, das aus dem Engagement von Bürger:innen hervorgegangen ist und auf den Konzepten des Transformative Organizings, beziehungsweise Community Organizings, basiert. Hierfür wird zunächst genauer erläutert, was unter Community Organizing zu verstehen ist, um im Anschluss auf die Ökonomisierung des Sozialstaates und deren Auswirkungen einzugehen. Darauf folgend wird dargestellt, inwieweit sich das Konzept des Transformative Organizings, welches als Antwort auf die Ökonomisierung zu verstehen ist, von dem des Community Organizings unterscheidet, beziehungsweise wo dessen Schwerpunkte liegen. Anschließend wird erläutert, inwieweit das Konzept des Bedingungslosen Grundeinkommens als Antwort auf die Ökonomisierung zu verstehen ist und wie das Projekt ‚Expedition Grundeinkommen‘ versucht, die Einführung des Bedingungslosen Grundeinkommens mithilfe des Organizings zu realisieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Community Organizing
- Ökonomisierung der Sozialpolitik und Lebenswelt
- Transformatives Community Organizing
- Bedingungsloses Grundeinkommen als Antwort
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Konzept des Community Organizings und seiner Weiterentwicklung zum Transformativen Community Organizing als Antwort auf die Ökonomisierung des Sozialstaates. Darüber hinaus wird das Bedingungslose Grundeinkommen als Alternative zur Ökonomisierung betrachtet und das Projekt „Expedition Grundeinkommen" vorgestellt, welches die Einführung des Bedingungslosen Grundeinkommens durch Organizing zu realisieren versucht.
- Definition und Funktionsweise des Community Organizings
- Die Auswirkungen der Ökonomisierung auf den Sozialstaat
- Die Entwicklung des Transformativen Community Organizings
- Das Bedingungslose Grundeinkommen als Antwort auf die Ökonomisierung
- Das Projekt „Expedition Grundeinkommen" und seine Umsetzung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung
Die Einleitung erläutert den Fokus der Hausarbeit, der auf dem Community Organizing und seiner Weiterentwicklung zum Transformativen Community Organizing liegt. Der Bezug zum Bedingungslosen Grundeinkommen und dem Projekt „Expedition Grundeinkommen“ wird hergestellt, um die Zusammenhänge zwischen Ökonomisierung, Organisation und sozialer Veränderung aufzuzeigen.
2 Community Organizing
Dieses Kapitel definiert Community Organizing als einen aktivierenden Ansatz, der Menschen befähigt, sich für die positive Veränderung ihrer Lebenswelt einzusetzen. Die zentrale Rolle der Bürger:innenorganisationen und die Bedeutung von Selbstverantwortung, -bestimmung und Solidarität werden hervorgehoben.
3 Ökonomisierung der Sozialpolitik und Lebenswelt
Dieses Kapitel beleuchtet die Auswirkungen der Ökonomisierung auf den Sozialstaat und die Lebenswelt der Bürger:innen. Es geht auf die Herausforderungen ein, die durch die zunehmende Kommerzialisierung und die Verlagerung von Verantwortung auf Einzelpersonen entstehen.
4 Transformatives Community Organizing
Dieses Kapitel präsentiert das Transformative Community Organizing als Antwort auf die Ökonomisierung. Die Schwerpunkte, die sich von den klassischen Ansätzen des Community Organizings unterscheiden, werden beschrieben und die Bedeutung von sozialer Transformation im Kontext der Ökonomisierung hervorgehoben.
5 Bedingungsloses Grundeinkommen als Antwort
In diesem Kapitel wird das Konzept des Bedingungslosen Grundeinkommens als Antwort auf die Ökonomisierung des Sozialstaates beleuchtet. Die Argumente für die Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens werden vorgestellt und die Möglichkeiten, die sich für die Gestaltung der Gesellschaft ergeben, werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Community Organizing, Transformatives Community Organizing, Ökonomisierung des Sozialstaates, Bedingungsloses Grundeinkommen, Projekt „Expedition Grundeinkommen“, Empowerment, soziale Gerechtigkeit, Partizipation, Bürger:innenengagement.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Community Organizing?
Community Organizing ist ein aus den USA stammender Ansatz, der Bürger dazu befähigt, sich gemeinsam für ihre Interessen und die Verbesserung ihrer Lebenswelt einzusetzen.
Was ist „Transformative Community Organizing“?
Es ist eine Weiterentwicklung des Konzepts, die gezielt auf die zunehmende Ökonomisierung des Sozialstaats reagiert und eine tiefgreifende soziale Transformation anstrebt.
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Grundeinkommen und Organizing?
Projekte wie die „Expedition Grundeinkommen“ nutzen Organizing-Methoden, um Bürger zu mobilisieren und die Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens von der Basis her zu realisieren.
Wie wirkt sich die Ökonomisierung auf den Sozialstaat aus?
Die Ökonomisierung führt oft zu einer Kommerzialisierung sozialer Dienste und einer stärkeren Verlagerung von Verantwortung auf das Individuum, was kollektive Ansätze wie Organizing wichtiger macht.
Was ist das Ziel der „Expedition Grundeinkommen“?
Das Ziel ist es, durch bürgerschaftliches Engagement und demokratische Prozesse die politische Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens voranzutreiben.
- Citar trabajo
- Laura Linn (Autor), 2021, Community Organizing, Ökonomisierung des Sozialstaates und das Bedingungslose Grundeinkommen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1064808