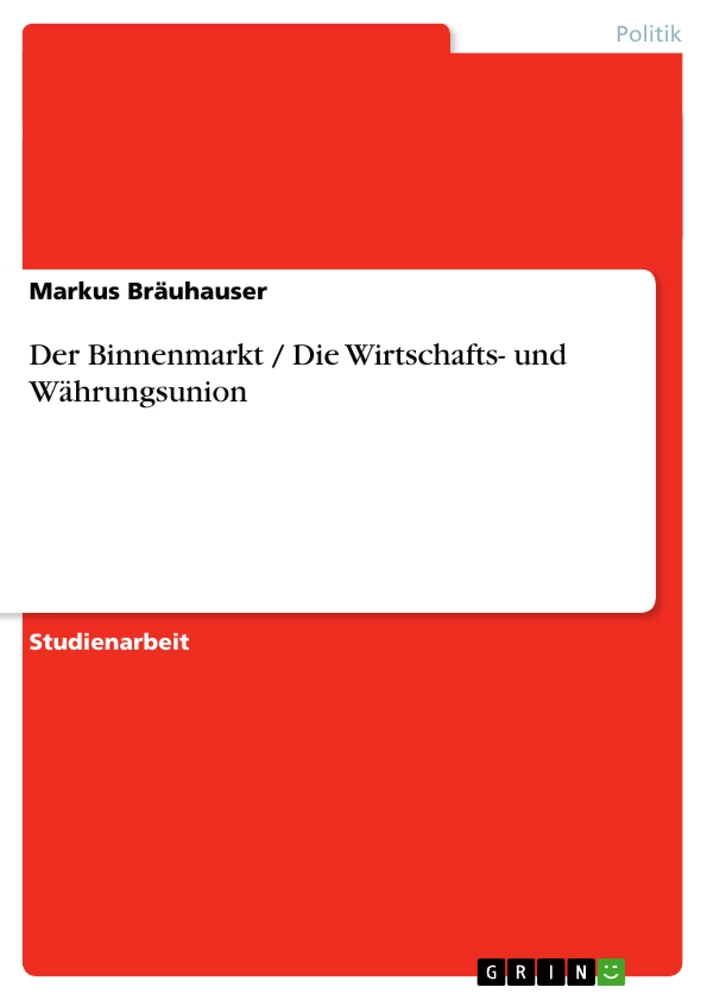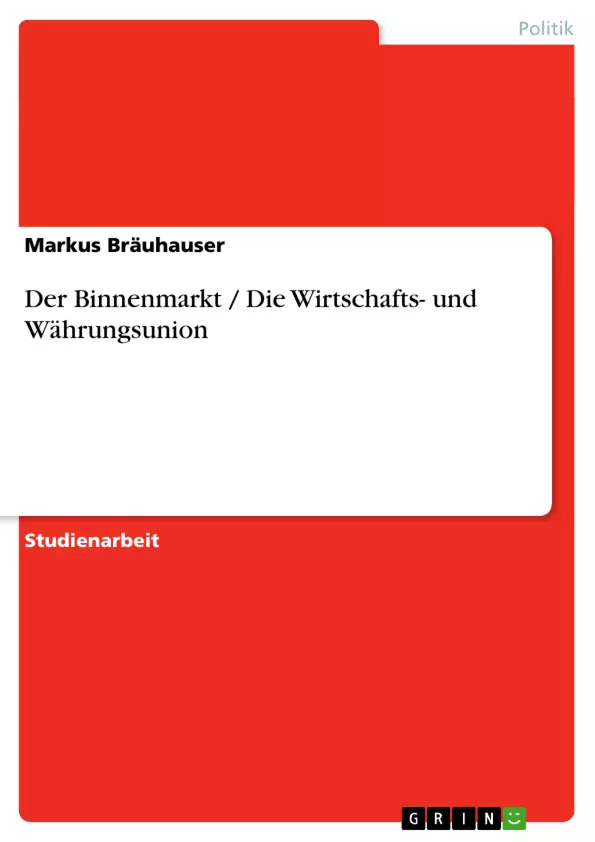Inhalt
1. Einleitung
2. Der Binnenmarkt
3. Die Wirtschafts- und Währungsunion
3.1. Geschichtliche Stationen der WWU
3.2. Die Verwirklichung der WWU
3.3. Chancen und Risiken der WWU
1. Einleitung
Der am 7. Februar 1992 in Maastricht unterzeichnete Vertrag über die Gründung der Europäischen Union (EUV) stellt den bisher wohl wichtigsten Schritt im europäischen Einigungsprozeß dar. Die so gegründete Union ersetzt die Europäischen Gemeinschaften nicht, sondern setzt diese bildlich gesprochen unter ein neues Dach, das auf drei Säulen ruht. Eine Säule stellt eine gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik dar, eine weitere eine verstärkte Zusammenarbeit in der Innen- und Justizpolitik. Die dritte Säule, um die es im Folgenden in dieser Arbeit gehen soll, bilden die drei Europäischen Gemeinschaften, namentlich die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), die Europäische Atomgemeinschaft (EAG) und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), erweitert um eine Wirtschafts- und Währungsunion und in „Europäische Gemeinschaft“ umbenannt. Aus dem im März 1957 unterzeichneten EWG-Vertrag wurde der EG-Vertrag (EGV).1Im Grundsatzteil dieses Vertrages ist die Wirtschafts- und Währungspolitik fest verankert, die Artikel 2, 3a und 4a sehen die Errichtung eines Binnenmarktes und einer Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) vor.
2. Der Binnenmarkt
Schon bei der Unterzeichnung des EWG-Vertrages war den Vertragspartnern bewußt. daß die Ziele Wirtschaftswachstum und wirtschaftliche Stabilität nur durch eine Integration der Volkswirtschaften der Mitgliedsstaaten erreicht werden könne. Diese Integration setzt einen schrittweisen Abbau der Wirtschaftsgrenzen und der staatlichen Maßnahmen zur Regelung des Wirtschaftsaustausches voraus, am Ende dieses Prozesses steht ein gemeinsamer Markt. Artikel 2 EGV gibt die Zielbestimmungen an, orientiert am marktwirtschaftlichen Modell mit den Komponenten Preisstabilität, hoher Beschäftigungsgrad, außenwirtschaftliches Gleichgewicht und stetiges Wirtschaftswachstum.
Nachdem mit dem EGKS-Vertrag schon ein gemeinsamer Markt für Kohle und Stahl und mit dem EAG-Vertrag ein gemeinsamer Markt für Uranerz und andere spaltbare Stoffe geschaffen worden war, sollte mit der Gründung der EWG ein gemeinsamer Markt für alle Sektoren und Produktionsfaktoren errichtet werden. Der Begriff „Gemeinsamer Markt“ wurde vom Europäischen Gerichtshof folgendermaßen definiert:
„ Der Begriff Gemeinsamer Markt...stellt ab auf die Beseitigung aller Hemmnisse im innergemeinschaftlichen Handel mit dem Ziel der Verschmelzung der nationalen Märkte zu einem einheitlichen Markt, dessen Bedingungen denjenigen eines wirklichen Binnenmarktes möglichst nahekommen“.2
Nach Artikel 3 EGV setzt die Herstellung dieses Marktes die Verwirklichung der Grundfreiheiten des gemeinsamen Marktes voraus. Diese Grundfreiheiten sind:
- die Freiheit des Warenverkehr
- die Freiheit des Personenverkehr
- die Freiheit des Dienstleistungsverkehr
- die Freiheit des Kapitalverkehr
- die Freiheit des Zahlungsverkehr
Diese Grunderfordernisse müssten durch gemeinsame Politiken auf den unterschiedlichsten Feldern ergänzt werden, um die Wirtschaftsbedingungen zu vereinheitlichen. Zu diesen Feldern zählen unter anderem die Landwirtschaft, der Verkehr, die Umweltpolitik, der Verbraucherschutz, Forschung und Technologie aber auch die Angleichung von innerstaatlichen Rechtsvorschriften.
Gerade diese Angleichung, bzw. der Abbau nationaler Rechtsvorschriften, die den fünf Freiheiten entgegenstanden, erwies sich nach der rechtswirksamen Vollendung de Gemeinsamen Marktes 1972 als äußerst langwierig. Erst Anfang der 80er Jahre besann man sich wieder auf die Vorteile eines Gemeinsamen Marktes. Auslöser hierfür war die geringe Wirtschaftsdynamik der Gemeinschaft, für die man die noch verbliebenen Hemmnisse mit verantwortlich machte. Zur Verbesserung der wirtschaftlichen und politischen Position der EG-Staaten wurde ein umfassendes Konzept beschlossen, das durch die Einheitliche Europäische Akte in den EG-Vertrag eingefügt wurde. In Art.7a wurde das Ziel festgelegt, den Binnenmarkt bis zum 31. Dezember 1992 zu verwirklichen; der Binnenmarkt wird in Absatz 2 dieses Artikels wie folgt definiert:
„ Der Binnenmarkt umfaßt einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen dieses Vertrags gewährleistet ist“.3
Um dieses Ziel zu erreichen, schlug die Kommission 1995 im „Weißbuch zur Vollendung des Binnenmarktes“ 282 konkrete Maßnahmen vor, die sich hauptsächlich auf die Beseitigung von „materiellen“ und technischen Schranken, sowie auf die Verbesserung von Rahmenbedingungen für grenzüberschreitende Wirtschaftshandlungen beziehen. Unter „materiellen Schranken“ versteht die Kommission die Kontrollen von Waren und Personen an den Binnengrenzen, sowie Steuerschranken, unterschiedliche Steuersätze der Länder, die wiederum Kontrollen an den Binnengrenzen der Gemeinschaft zur Folge haben. Technische Schranken beziehen sich auf unterschiedliche Vorschriften in den Bereichen des Gesundheitsund Verbraucherschutzes, der Sicherheit und der Umwelt.
Einen weiteren Versuch, den Binnenmarkt zu verbessern, stellt der Aktionsplan der Kommission dar, der am 12. Juni 1997 auf der Ratstagung in Amsterdam angenommen wurde. Folgende Ziele werden genannt:4
- die für den Binnenmarkt geltenden gemeinsamen Regeln sollen wirksamer durchgesetzt werden
- Marktverzerrungen, die durch Steuerschranken und im Widerspruch zu gemeinsamen Wettbewerbsrecht stehenden nationalen Regelungen verursacht werden, sollen beseitigt werden
- sektorspezifische Schranken gegen die Marktintegration sollen abgebaut werden
- die Binnenmarktrechte der Unionsbürger sollen gestärkt werden W. Woyke5gibt eine Übersicht über Chancen und Risiken des Binnenmarktes, die ich im Folgenden kurz darstellen möchte.
Eine Chance liege in der zu erwartenden Mehrbeschäftigung, die sich alleine für die Bundesrepublik auf 200 000 bis 600 000 Personen beliefe; die Produktivität steigere sich und erzeuge Wachstumseffekte; durch günstigere Beschaffung könne in den öffentlichen Haushalten eingespart werden. Weitere Chancen werden in der wachsenden Gütervielfalt und in der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Anbieter gegenüber solchen aus Drittländern gesehen.
Der Übergang zum Binnenmarkt berge aber auch Risiken. Eines sei das Unterlaufen der Wettbewerbsverschärfungen durch Konzentrationsprozesse, ein weiteres Risiko läge in zunehmenden Forderungen nach Schutz gegenüber Drittländern. Weiter wird aufgeführt, daß verstärkte Zahlungsbilanzungleichgewichte den Übergang zum Binnenmarkt behindern könnten, ferner daß der Liberalisierungseffekt der Märkte durch einen Bürokratisierungseffekt auf höherer Ebene teilweise kompensiert werden könnte. Weiterhin könnten durch die Verschärfung der regionalen Gegensätze politische Widerstände und durch steigende Nachfrage nach Arbeitskräften Qualifikationsengpässe entstehen. Diesen Risiken könne man durch eine aktive Politik mindern. Um Zahlungsbilanz- ungleichgewichte zu vermeiden, müsse die Geld- und Fiskalpolitik koordiniert werden; eine Verstärkung der Nachfrage sei notwendig; zur Minderung der regionalen Ungleichgewichte benötige man eine flankierende, regionale Strukturpolitik, den zu erwartenden Qualifizierungsengpässen könne man mit allgemeinen Qualifizierungsstrategien entgegen- wirken.
Der Stand des Binnenmarktes wird recht positiv eingeschätzt. Der Europäische Rat erklärte im Dezember 1998 auf seiner Tagung in Wien:
„Bei den Bemühungen um Modernisierung, Erweiterung und Rationalisierung de Binnenmarktes entsprechend dem Aktionplan wurden kontinuierlich Fortschritte erzielt, die erforderlichen neuen Rechtsvorschriften, insbesondere die Verordnung über den freien Warenverkehr, sind verabschiedet worden. Die Rechtsvorschriften müssen sowohl auf Gemeinschafts-, als auch auf einzelstaatlicher Ebene weiter vereinfacht und verbessert werden, damit die Binnenmarktvorschriften leichter anwendbar und somit wirksamer werden.“6
Ungefähr 97 % aller den Binnenmarkt betreffenden Richtlinien sind bereits in nationale Recht umgewandelt worden,7wobei einzelne Länder aber stark voneinander abweichen, wie nachfolgende Tabelle8zeigen soll.
3. Die Wirtschafts- und Währungsunion
3.1 Geschichtliche Stationen der WWU
Bei der Gründung der EG war man sich einig, daß eine Vollendung des Gemeinsamen Marktes auch ein Minimum an Gemeinsamkeit in der Wirtschafts- und Währungspolitik voraussetzt. Durch die wirtschaftliche Verflechtung der Mitgliedstaaten, würde es für den einzelnen Staat schwieriger werden, eigene konjunkturpolitische Ziele durchzusetzen, auch würden sich die Auswirkungen wirtschafts- und währungspolitischer Maßnahmen einzelner Staaten auf andere erheblich verstärken. Die Mitgliedsstaaten waren aber nicht bereit, ihre Souveränität in diesen Politikbereichen abzugeben, statt dessen einigte man sich nur auf verbindliche, gemeinsame Zielsetzungen, namentlich die Sicherung der Vollbeschäftigung, ein stabiles Preisniveau, eine stabile Währung und eine ausgeglichene Zahlungsbilanz. Bald stellte man aber fest, daß diese Koordination die auf sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen konnte. Als Ende der sechziger Jahre das System von Bretton Woods, bei dem der US-Dollar die Funktion der Leitwährung in der Weltwirtschaft innehatte, in eine Vertrauenskrise geriet, die zu fluchtartigen Kapitalbewegungen und zu hohen Inflationsraten führte, wurde eine engere währungspolitische Integration zum Sachzwang. 1969 beschlossen die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten in Den Haag den schrittweisen Aufbau einer WWU. In der Diskussion um die Vorgehensweise zeichneten sich zwei grundlegend verschiedene Positionen ab, die auch zukünftig immer wieder eine Rolle spielen sollten. In der „Lokomotivtheorie“ gingen die sogenannten Monetaristen, eine Gruppe von Ländern um Frankreich, davon aus, daß eine schnelle Einführung einer gemeinsamen Währung eine Sogwirkung hinsichtlich einer gemeinsamen Wirtschafts- und Konjunktur- politik auslösen würde. Diese Vorgehensweise hätte Staaten mit stabilen Währungen verpflichtet, Defizite von Ländern mit schwächeren Währungen auszugleichen, was das Risiko eines Inflationsimportes mit sich gebracht hätte. Die entgegengesetzte Position, hauptsächlich von Deutschland vertreten, orientierte sich am Ziel möglichst hoher Geldwertstabilität. Erst sollten Konjunktur-, Haushalts- und Wirtschaftspolitik angeglichen werden und eine möglichst niedrige Inflationsrate erzielt werden, bevor dann, sozusagen als „Krönung“ eine gemeinschaftliche Währung eingeführt werden sollte9. Ein Ausschuß unter dem Vorsitz des luxemburgischen Ministerpräsidenten Werner sollte einen Kompromiß zwischen den Positionen der Monetaristen und der sogenannten Ökonomisten finden. Ende 1970 legte dieser Ausschuß seinen Abschlußbericht vor, den sogenannten „Werner-Plan“, der die Errichtung einer WWU in drei Stufen bis zum Jahr 1980 vorsah. Zwar wurde die erste Stufe noch eingesetzt, aber infolge der hohen Inflation, der Weltwirtschaftskrise mit dem Zusammenbruch des Systems von Bretton Woods 1971 und dadurch erzwungenen nationalen Alleingängen scheiterte der Plan.
1979 wurde mit der Errichtung des Europäischen Währungssystems (EWS) ein neuer Anlauf auf dem Weg zu währungspolitischer Integration begonnen. Ziel war es, starke Währungsschwankungen mit Hilfe eines Systems fester, jedoch anpassungsfähiger Leitkurse, gestützt auf Interventions- und Kreditmechanismen, weitgehend auszuschalten. Das EWS wurde durch folgende Elemente charakterisiert:10
- die Währungseinheit ECU (European Currency Unit), in der die Währungen in einem festem Verhältnis zueinander standen
- ein europäischer Währungsverbund, mit einem Netz bilateraler Leitkurse, das eine Bandbreite für Währungsschwankungen von +/- 2,25 % zuließ (mit zeitweiligen Ausnahmen)
- ein Kreditmechanismus für Kreditbeistand
- ein System gegenseitiger Abrechnung
Der Erfolg des Systems wird im allgemeinen als positiv bewertet, da es zu einer verstärkten Konvergenz der Wirtschafts- und Währungspolitik führte.
Im Zuge der Errichtung des Binnenmarktes kam Ende der achtziger Jahre wieder der Wille auf, die Integration der Wirtschafts- und Währungspolitik weiter voranzutreiben. 1988 wurde ein Expertenausschuß unter dem Vorsitz des Kommissionspräsidenten Jacques Delors eingesetzt, der den Fahrplan für die Errichtung einer WWU aufstellen sollte. Der von diesem Ausschuß erarbeitete sogenannte „Delors-Bericht“ sieht einen Drei-Stufen-Plan, ähnlich dem Werner-Plan, vor und wurde im Juni 1989 von den Staats- und Regierungschefs angenommen. Er stellt die Grundlage für das weiter Vorgehen auf dem Weg zur WWU dar. Einen Überblick über die Entwicklung der WWU gibt folgende Grafik:11
3.2.Die Verwirklichung der WWU
Als Beginn der ersten Stufe der WWU wurde der 1. Juli 1990 festgesetzt. Beinahe alle Beschränkungen im Geld- und Kapitalverkehr unter den Staaten wurden beseitigt, man verbesserte die Koordination und die gemeinsame Überwachung der Wirtschaftspolitik der einzelnen Mitgliedsstaaten und sorgte für eine bessere Zusammenarbeit der Notenbanken. Der Termin für den Eintritt in die zweite Stufe wurde auf den 1. Januar 1994 gelegt, der auch eingehalten wurde. Als Vorläufer der Europäischen Zentralbank (EZB) wurde in Frankfurt das Europäische Währungsinstitut errichtet. Die EZB stellt das wichtigste institutionelle Element der WWU dar. Um dem Ziel der Preisstabilität genüge zu tragen, ist sie, nach deutschem Vorbild, weisungsunabhängig. Das Finanzieren von öffentlichen Defiziten ist ihr untersagt, sie wird die Geldmenge der Gemeinschaftswährung „Euro“ steuern und für deren Stabilität verantwortlich sein. Die EZB bildet zusammen mit den nationalen Zentralbanken das Europäische System der Zentralbanken (ESZB). Einen genauen Überblick über den Aufbau des ESZB liefert folgendes Schaubild:12
Der Eintritt in die dritte Stufe wurde an die Erfüllung sogenannter „Konvergenzkriterien“ gebunden, um die Stabilität der Gemeinschaftswährung zu sichern. Diese Kriterien sind:13
- der Anstieg der Verbraucherpreise darf das Mittel der drei preisstabilsten Länder um nicht mehr als 1,5 %-Punkte übersteigen;
- die Währung des betreffenden Landes muß dem EWS angehören und darf in den letzten beiden Jahren nicht abgewertet worden sein;
- das Niveau der langfristigen Zinsen muß zeigen, daß die Kapitalmärkte der Stabilitätspolitik des jeweiligen Landes vertrauen. Das Zinsniveau darf das Mittel der drei bestplatzierten Mitgliedsstaaten nicht um mehr als 2 %-Punkte überschreiten;
- die jährliche Neuverschuldung darf 3 % des Bruttoinlandprodukts nicht übersteigen;
- Die gesamte Staatsverschuldung darf nicht über 60 % des Bruttoinlandprodukts liegen.
Hätten Ende 1996 mindestens sieben Mitgliedsstaaten diese Kriterien erfüllen können, hätte es eine Option auf einen früheren Beginn der WWU gegeben, da dies aber nicht der Fall war, beschloß man folgendes Übergangsszenario: Anfang 1998 bestimmt der Europäische Rat diejenigen Länder, die an der WWU teilnehmen, auf Grundlage der Wirtschaftsdaten von 1996 und 1997. Am 1. Januar 1999 beginnt dann die WWU, die Umrechnungskurse der teilnehmenden Länder und Euro werden unwiderruflich festgelegt. Am 1. Januar 2002 werden die neuen Banknoten und Münzen eingeführt, der Euro ist dann Einheitswährung der WWU- Teilnehmerstaaten. Dieser Zeitplan wurde bisher immer beibehalten, an der WWU nehmen vorerst alle EU-Länder mit Ausnahme von Großbritannien, Dänemark und Schweden teil. Eine weitere wichtige Entscheidung hinsichtlich der Ausgestaltung der WWU war die Verabschiedung eines Wachstums- und Stabilitätspakts 1997. Mangelnde Haushaltsdisziplin einzelner Mitgliedsstaaten können nun auch mit verschiedenen Sanktionen bestraft werden; anfangs basierte die Disziplin noch auf Freiwilligkeit.
3.3. Chancen und Risiken der WWU
Zum Ende dieser Arbeit möchte ich noch auf die Vorteile der WWU eingehen, aber auch eventuelle Risiken verdeutlichen.
Ein positiver Aspekt ist sicher die Senkung der Transaktionskosten. Für Privatpersonen entfallen bei Auslandsreisen die Umtauschkosten, Unternehmen sparen diese beim grenzüberschreitenden Handel von Waren und Dienstleistungen. Ebenfalls von Vorteil für die Verbraucher ist die steigende Preistransparenz. Durch die Einheitswährung ist es für Privatpersonen, aber auch Unternehmen, leichter, die im Ausland hergestellten Güter und Dienstleistungen mit heimischen Konkurrenzprodukten zu vergleichen. Dadurch verschärft sich die Konkurrenz zwischen in- und ausländischen Anbietern, mit der Folge der Intensivierung des Wettbewerbs. Dieser wiederum führt zu höherem Wirtschaftswachstum und in der Konsequenz zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, aber auch, zumindest in der Theorie, zu niedrigeren Preisen für die Verbraucher. Ein weiterer Aspekt ist, daß eine stabile europäische Währung Anlagekapital anzieht und dadurch für Zusatzeinnahmen sorgt. Im weltweiten Vergleich erhöht sich das Gewicht der europäischen Währung. Dies führt zu einer größeren Unabhängigkeit gegenüber der amerikanischen Haushaltspolitik, zu einer höheren Wettbewerbsfähigkeit und eventuell auch zu einem höheren politischen Potential der EU. Aber nicht nur auf ökonomischer Ebene bringt die WWU Vorteile: Der erreichte Integrationsstand wird gesichert und weitere Integrationsschritte im politischen Bereich werden folgen, da die EU-Länder sich zu einer dauerhaften Schicksalsgemeinschaft geschmiedet haben. Auf psychologischer Ebene stärkt gerade der Euro sicher die Identifikation der Bürger mit Europa.
Ein negativer Aspekt der WWU liegt in der Inflationsgefahr. Bei der Umstellung der nationalen Währungen auf den Euro, besteht die Gefahr, daß ungerade Beträge aufgerundet werden. Dies würde zu höheren Preisen und dadurch zu einem Inflationsschub führen. Ein weiterer Nachteil der WWU ist der Wegfall des Instrumentes der Wechselkursanpassung, um nach wie vor bestehende Unterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten auszugleichen. Diese müssten dann durch Lohn- und Preisanpassungen oder durch Transferzahlungen ausgeglichen werden; solche ökonomischen Interessensgegensätze könnten durchaus zu einer politischen Zerreißprobe eskalieren.
Literatur :
1. K.-D. Borchardt : „Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union“, C.F.Müller Verlag, Heidelberg, 1996
2. W. Weidenfeld (Hrsg.) : „Europa - Handbuch“,
Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 1999
3. W. Woyke: „Europäische Union Erfolgreiche Krisengemeinschaft“,
R. Oldenbourg Verlag, München, 1998
4. Internet über Suchmaschine
[...]
1 K.-D. Borchardt: Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union. Heidelberg 1996, S.363f
2 K.-D. Borchardt: Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union. Heidelberg 1996, S.204
3 K.-D. Borchardt: Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union. Heidelberg 1996, S.205
4 H. Di>5 W. Woyke: Europäische Union. München 1998 , S.229
6 http://www.bik-halle.mda.de/Infopoint/Unterricht/BinnenmarktWWU/etappen.htm
7 K.-D. Borchardt: Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union. Heidelberg 1996, S. 206
8 W. Woyke: Europäische Union. München 1998 , S. 231
9 O.Hillenbrand: Europa als Wirtschafts- und Währungsunion. In W.Weidenfeld (Hrsg.): Europa-Handbuch. Bonn 1999 , S.499f
10 K.-D. Borchardt: Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union. Heidelberg 1996, S. 219
11 W. Woyke: Europäische Union . München 1998 , S.240
12 W. Woyke: Europäische Union . München 1998 , S.244
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es behandelt Themen wie den Binnenmarkt und die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) der Europäischen Union.
Was ist der Binnenmarkt?
Der Binnenmarkt ist ein Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen des EG-Vertrags gewährleistet ist. Ziel ist die Verschmelzung der nationalen Märkte zu einem einheitlichen Markt, dessen Bedingungen denjenigen eines wirklichen Binnenmarktes möglichst nahekommen.
Welche Grundfreiheiten umfasst der Binnenmarkt?
Die Grundfreiheiten des Binnenmarktes sind:
- die Freiheit des Warenverkehr
- die Freiheit des Personenverkehr
- die Freiheit des Dienstleistungsverkehr
- die Freiheit des Kapitalverkehr
- die Freiheit des Zahlungsverkehr
Was sind die Chancen des Binnenmarktes?
Zu den Chancen des Binnenmarktes gehören:
- Mehrbeschäftigung
- Steigerung der Produktivität und Wachstumseffekte
- Einsparungen in den öffentlichen Haushalten durch günstigere Beschaffung
- Wachsende Gütervielfalt
- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Anbieter
Welche Risiken birgt der Binnenmarkt?
Zu den Risiken des Binnenmarktes gehören:
- Unterlaufen der Wettbewerbsverschärfungen durch Konzentrationsprozesse
- Zunehmende Forderungen nach Schutz gegenüber Drittländern
- Verstärkte Zahlungsbilanzungleichgewichte
- Bürokratisierungseffekte
- Verschärfung der regionalen Gegensätze
- Qualifikationsengpässe
Was ist die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)?
Die WWU ist ein Prozess der wirtschaftlichen und währungspolitischen Integration der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union mit dem Ziel einer gemeinsamen Währung.
Welche historischen Stationen gab es auf dem Weg zur WWU?
Zu den wichtigen historischen Stationen gehören:
- Der Beschluss zum schrittweisen Aufbau einer WWU in Den Haag (1969)
- Der Werner-Plan (1970)
- Die Errichtung des Europäischen Währungssystems (EWS) (1979)
- Der Delors-Bericht (1989)
- Der Vertrag von Maastricht (1992)
Welche Konvergenzkriterien mussten für den Eintritt in die dritte Stufe der WWU erfüllt werden?
Die Konvergenzkriterien sind:
- Niedrige Inflationsrate
- Wechselkursstabilität
- Niedriges Zinsniveau
- Begrenzte Neuverschuldung
- Begrenzte Staatsverschuldung
Welche Institutionen sind für die WWU von Bedeutung?
Die wichtigsten Institutionen sind:
- Die Europäische Zentralbank (EZB)
- Das Europäische Währungsinstitut (als Vorläufer der EZB)
- Das Europäische System der Zentralbanken (ESZB)
Was sind die Chancen der WWU?
Zu den Chancen der WWU gehören:
- Senkung der Transaktionskosten
- Steigende Preistransparenz
- Intensivierung des Wettbewerbs
- Anziehung von Anlagekapital
- Erhöhung des Gewichts der europäischen Währung im weltweiten Vergleich
- Sicherung des erreichten Integrationsstandes
Welche Risiken birgt die WWU?
Zu den Risiken der WWU gehören:
- Inflationsgefahr bei der Umstellung auf den Euro
- Wegfall des Instruments der Wechselkursanpassung
- Gefahr von ökonomischen Interessensgegensätzen zwischen den Mitgliedsstaaten
- Quote paper
- Markus Bräuhauser (Author), 2002, Der Binnenmarkt / Die Wirtschafts- und Währungsunion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106485