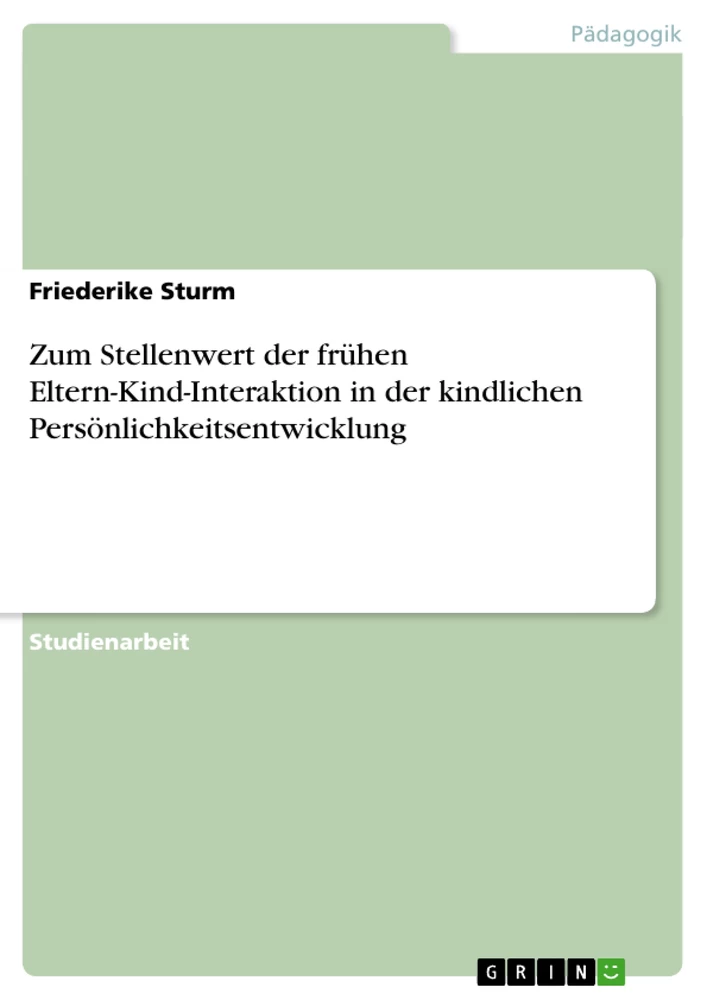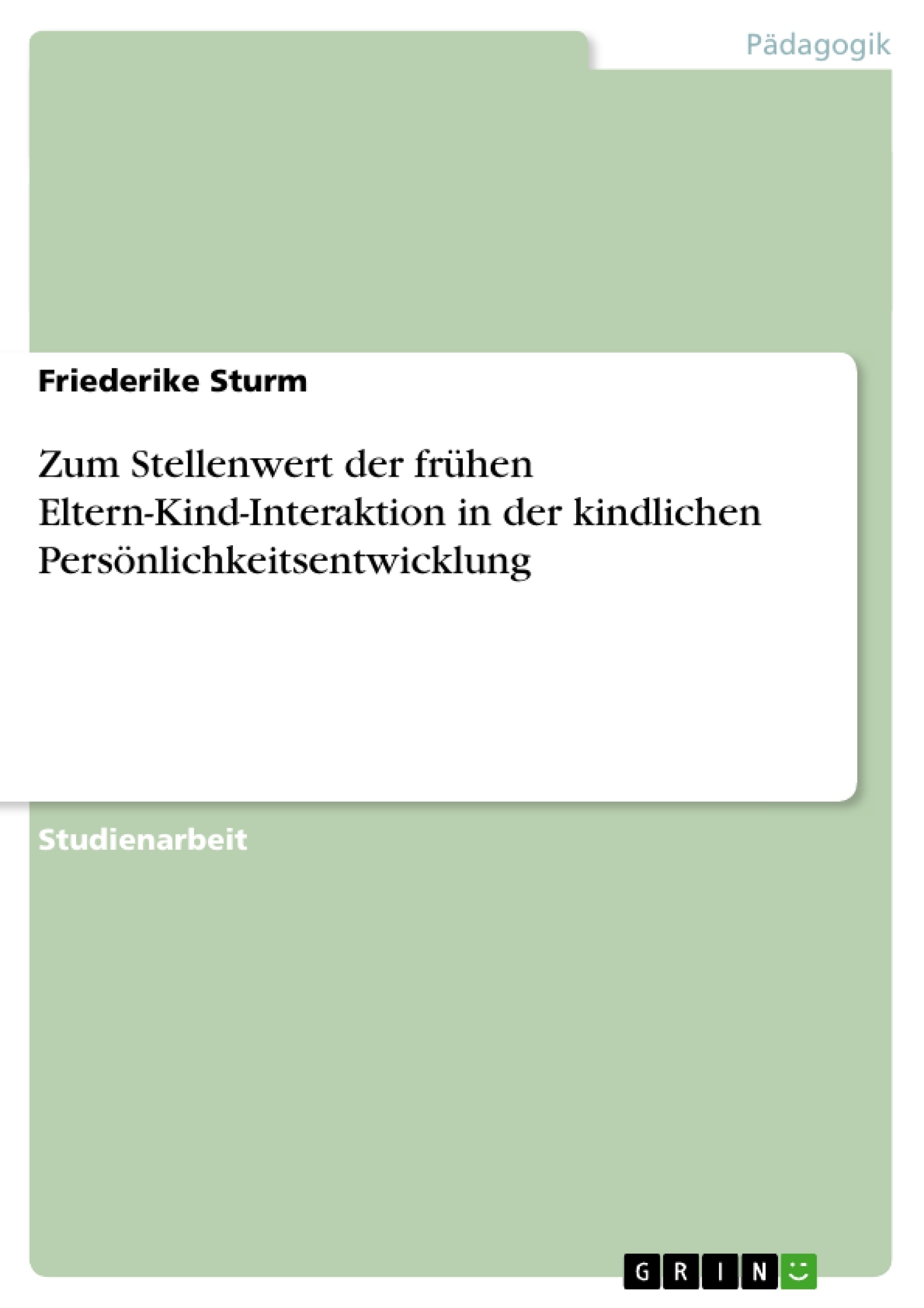Inhalt:
1. Einleitung
2. Der kompetente Säugling
2.1. Die medizinische Sicht
2.2. Selbstempfinden - das organisierende Prinzip
2.3. Aktive Suche nach erlebter Gemeinsamkeit
3. Entwicklung im Kontext
3.1. Die vier Systeme der Entwicklung
3.2. Die Rolle affektiver Beziehung
4. Die kindliche Persönlichkeitsentwicklung
4.1. Erkenntnisse der Neurophysiologie
4.2. Bindungsforschung und Persönlichkeit
4.2.1. Die ethologische Bindungsforschung
4.2.1.1. Grundannahmen der Bindungstheorie
4.2.1.2. Bindungsvarianten
4.3. Neuere Ergebnisse der Bindungsforschung
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Es ist eines der großen Themen in der Kindheitsforschung und -geschichte: Wie und wann entsteht sie? Entwickelt sie sich bei jedem Kind gleich? Wie lange hält sie an? Wie wichtig ist sie in bezug auf Charakter -und Persönlichkeitsentwicklung? Ist das erste Lebensjahr besonders entscheidend? Gemeint ist die frühe Eltern-Kind-Interaktion und -Bindung.
Diese und weitere Fragen beschäftigen Wissenschaftler sei Anfang des 20. Jahrhunderts. John BOWLBY war einer der Pioniere in der Erforschung der Mutter- KindBindung. Mit seinen Publikationen erweckte er seit den 1950er Jahren so viel Aufsehen, dass in vielen Heimen und Kindereinrichtungen eine Umstrukturierung gemäß seinen Erkenntnissen erfolgte.
Neben BOWLBY beschäftigten sich bis heute viele weitere Wissenschaftler mit dem Thema, beispielhaft wären zu nennen Rene A. SPITZ Sigmund FREUD, Mary AINSWORTH oder die Eheleute PAPOUSEK.
Beginnen werde ich meine Hausarbeit mit dem gewandelten Blick auf den Säugling, wie er im letzten Jahrhundert entstand.
Danach erläutere ich Urie BRONFENBRENNERs Theorie der ‚Ökologie der menschlichen Entwicklung‘ in Bezug auf die ersten Lebensmonate. Zuletzt werde ich einige Erkenntnisse der Bindungsforschung darstellen und diese im Hinblick auf die Persönlichkeitsentwicklung diskutieren.
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass der Begriff Mutter in der vorliegenden Arbeit nicht unbedingt die leibliche Mutter meint, sondern die jeweilige Hauptbezugsperson, die beispielsweise auch der Vater, die Großeltern oder die Adoptiveltern sein können.
2. Der kompetente Säugling
Zu Beginn der vorliegenden Arbeit möchte ich das heutige Verständnis des Säuglings darlegen.
In der Vergangenheit galt der Säugling als passives, undifferenziertes und hilfloses Wesen, das nur durch seine Reflexe beherrscht wird und über keinerlei Möglichkeiten verfügt am sozialen Geschehen teilzuhaben bzw. auftretende Anforderungen zu bewältigen.
In den 1970er Jahren wandelte sich das Bild langsam: die Wissenschaftler sahen den menschlichen Säugling unzureichend charakterisiert und forderten eine veränderte Sicht auf die ersten 1,5 Lebensjahre. Dem Säugling werden jetzt Fähigkeiten und Gefühle zugestanden, er erscheint als aktiv, differenziert und beziehungsfähig - es ist die Rede vom ‚kompetenten Säugling‘.
2.1. Die medizinische Sicht
Aus medizinischer Sicht wird heute nicht mehr in Frage gestellt, dass bereits direkt nach der Geburt alle menschlichen Sinnessysteme funktionsfähig sind, die jedoch innerhalb der ersten Lebensmonate durch angemessene sensorische Stimulation weiter ausgebildet werden müssen. Die frühen Kompetenzen der Wahrnehmung und des Verhaltens müssen differenziert betrachtet werden. „Sie basieren in biologisch sinnvollen Kontexten auf verhaltensgenetisch vorbereiteten Schemata, die für Lernerfahrungen offen sind“1 (Hervorhebungen: F.S.)
Wichtig ist, dass diese Schemata nicht nur unmittelbare vitale Bedürfnisse, insbesondere die Nahrungsaufnahme, betreffen, sondern vor allem auch im Bereich der Interaktion bestehen: „Neugeborene ziehen das menschliche Gesicht und die menschliche Stimme anderen Reizen vor. Sie können auf einer reflektorischen Basis ihre Aktivität der eines Interaktionspartners anpassen und ihn mimisch nachahmen, wobei sie bereits lächeln und vokalisieren.“2
2.2. Selbstempfinden - das organisierende Prinzip
Wurde früher davon ausgegangen, dass der Säugling nicht in der Lage ist, die Welt geordnet und sich von der Umwelt getrennt wahrzunehmen, steht heute seine Fähigkeit im Vordergrund die Welt von Anfang an eher als geordnet denn als Chaos zu empfinden. Der zentrale Bezugspunkt, nachdem er sich selbst und die Welt erfährt und organisiert ist das Selbstempfinden. Die Entwicklung dieses organisierenden Prinzips beginnt laut STERN3 bereits zwischen 0 und 2 Monaten und verläuft in Stufen:
Zu Beginn stellen Säuglinge Verbindungen zwischen verschiedenen Ereignissen her, sodass ein erstes Gefühl von Regelmäßigkeit und Geordnetheit erlebt wird (auftauchendes Selbstempfinden). Dies geschieht sowohl auf Grund angeborener als auch erlernter Fähigkeiten. Zwischen dem zweiten und neunten Monat lernt der Säugling wahrzunehmen, dass er und sein Gegenüber getrennte Wesen sind, die miteinander in Beziehung treten können (Kernselbstempfinden). Obwohl Gemeinsamkeit mit anderen erfahren wird, werden die gefühlten Grenzen zwischen Selbst und Objekt normalerweise konstant wahrgenommen.
Zwischen dem siebten und dem 18. Lebensmonat durchlebt das Kind die Phase des subjektiven Selbstempfindens. Hier bekommt es eine Ahnung von der Intersubjektivität, indem es annimmt, dass es und das Gegenüber zwei unabhängige Psychen haben, die sich aber durch gemeinsame Erfahrungen und Kommunikation in einem gewissen Maß austauschen können. Das verbale Selbstempfinden schließlich beginnt zwischen dem 15. und 18. Monat und ist nie abgeschlossen. Kinder entdecken nun, dass sie über ihr persönliches Wissen und ihre Erfahrungen unter Zuhilfenahme bestimmter Symbole in Austausch treten können.
DORNES ergänzt die Ausführungen STERNs, indem er betont, dass die Unterscheidungen von Selbst und Objekt bis zum 18. Monat präreflexiv sind. Er vertritt die Meinung, „daß es im ersten halben Jahr ein existentielles Selbst gibt, das sich vom Objekt unterscheiden und getrennt fühlen kann, aber kein kategoriales Selbst, das den gefühlten Unterschied zu einem klaren Ich- Bewußtsein bringt.“4
DORNES geht also davon aus, dass für den Säugling die getrennt Wahrnehmung von Selbst und anderem sowohl unter normalen Zuständen als auch in Erregung (z.B. Hunger) geleistet wird.
2.3. Aktive Suche nach erlebter Gemeinsamkeit
In Bezug auf das Thema der vorliegenden Arbeit möchte ich in diesem Zusammenhang auf eine weitere Auffassung STERNs5 hinweisen: Trotz des lebenswichtigen Bedürfnisses des menschlichen Säuglings, umsorgt und umhegt zu werden, führt dieses, wie bereits ausgeführt, in der Regel nicht zu einem Verschwimmen der Grenzen von Selbst und Objekt. Darüber hinaus vertritt STERN sogar die Meinung, dass das Kind durch sein Verhalten Gemeinsamkeitserlebnisse -er nennt diese ‚self-with-others‘- aktiv sucht. Die vom Subjekt gewollte soziale Erfahrung kann aufgrund der Differenziertheit von Selbst und Objekt ohne die Beeinträchtigung des Selbstempfindens entstehen.
DORNES postuliert hierzu mit Bezug auf ROSS: „Im sicheren Gefühl der Getrenntheit wird die Gemeinsamkeit erst richtig schön.“6
3. Entwicklung im Kontext
Im Zentrum der frühen menschlichen Interaktionsmuster steht die Entwicklung. BRONFENBRENNER definiert Entwicklung als den „Prozess, durch den die sich entwickelnde Person erweiterte, differenziertere und verlässlichere Vorstellungen über ihre Umwelt erwirbt“7 sowie die „dauerhafte Veränderung der Art und Weise, wie (sie) die Umwelt wahrnimmt und sich mit ihr auseinandersetzt.“8 Es ist für ihn eine „Entwicklung im Kontext“9: „Die Ökologie der menschlichen Entwicklung befaßt sich mit der fortschreitenden gegenseitigen Anpassung zwischen dem aktiven, sich entwickelnden Menschen und den wechselnden Eigenschaften seiner unmittelbaren Lebensbereiche. Dieser Prozess wird fortlaufend von den Beziehungen dieser Lebensbereiche untereinander und von den größeren Kontexten beeinflußt, in die sie eingebettet sind.“10
3.1. Die vier Systeme der Entwicklung
BRONFENBRENNERS systemisches Denken umfasst vier Systeme, die einen Einfluss auf die konkrete Lebenswirklichkeit eines Menschen haben: Das Mikrosystem ist die Gesamtheit aller Wechselbeziehungen, die augenblicklich und direkt auf die sich entwickelnde Person einwirken. Dazu gehören Objekte, auf die die Person reagiert sowie Leute, mit denen sie interagiert.
Das Mesosystem umfasst die Wechselbeziehungen zwischen zwei oder mehreren Lebensbereichen, an denen die sich entwickelnde Person beteiligt ist. Dazu gehören beim Kind beispielsweise das Elternhaus und die Frühförderung oder später die Schule.
Unter Exosystem versteht BRONFENBRENNER einen oder mehrere Lebensbereiche, an denen die sich entwickelnde Person nicht selbst beteiligt ist, in denen aber Ereignisse stattfinden, die ihren Lebensbereich beeinflussen. Hier läßt sich als Beispiel das Arbeitsverhältnis des Vaters nennen: das Gehalt bestimmt den Lebensstandard der Familie mit, die Zufriedenheit des Vaters bei der Arbeit wirkt sich oft auch auf die familiäre Stimmung aus.
Das letzte ist das Makrosystem: dies benennt den Komplex der ineinander geschachtelten, vielfältig zusammenhängenden Systeme einer bestimmten Kultur oder Subkultur. Einzelne soziale Schichten oder religiöse Gruppen sind Beispiele für Makrosysteme.
Obwohl alle Systeme in ständiger Wechselwirkung zueinander stehen, möchte ich mich in Anbetracht der frühen Eltern-Kind-Interaktion auf die Ebene des Mikrosystems beschränken.
3.2. Die Rolle affektiver Beziehung
Für die Ökologie der menschlichen Entwicklung haben affektive Beziehungen eine zentrale Rolle. Durch sie kommt es zu einer fortschreitenden Komplexität im Verhalten der Beziehungspartner. „Je positiver und gegenseitiger die affektiven Beziehungen von Anfang an sind und im Verlauf der Interaktion werden, um so mehr erhöhen sie das Tempo und die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Entwicklungsprozessen.“11
Wichtig bei einer gegenseitigen Beziehung, BRONFENBRENNER nennt dies Dyade, ist außerdem Reziprozität, das heißt, es wirkt auf A, was B tut und umgekehrt.
Drittes Charakteristikum einer entwicklungsfördernden Beziehung sind die sich verschiebenden Kräfteverhältnisse. So kann es sein, dass einer der Partner mehr Einfluss auf eine Situation hat, als der andere. Die Situation für Lernen und Entwicklung sind dann optimal, wenn sich das Kräfteverhältnis allmählich zugunsten der sich entwickelnden Person verschiebt. Gemeint ist damit das Erleben von Selbstwirksamkeit, also davon, dass man die Situation selbst beeinflussen kann.
Die optimalen Bedingungen für Lernen und Entwicklung definiert BRONFENBRENNER zusammenfassend wir folgt:
„Lernen und Entwicklung werden begünstigt, wenn die in Entwicklung begriffene Person sich mit jemandem, zu dem sie eine starke und dauerhafte Beziehung gebildet hat, an fortschreitend komplexeren Mustern wechselseitiger Tätigkeit beteiligt und sich das Kräfteverhältnis allmählich zu ihren Gunsten verschiebt.“12
4. Die kindliche Persönlichkeitsentwicklung
Der Begriff der Persönlichkeit ist schwer zu fassen. Das dtv Brockhaus Lexikon definiert den Begriff wie folgt: „allg. der einzelne Mensch, insofern er seine Anlagen als Person zu besonderer Entfaltung und Ausprägung in Form individueller Eigenart, charakterl. Originalität und sittl. Festigkeit gebracht hat...“13 VÖLKER schließt sich dieser Definition an: „Das Alltagsverständnis verbindet mit dem Persönlichkeitsbegriff charakteristische Verhaltenseigenschaften eines Menschen, die ihn oder sie zuverlässig von anderen unterscheiden.“14 Da die Persönlichkeitspsychologie als adäquate Wissenschaft keine allgemeingültige Definition anbietet, werde ich mich auf diese Alltagskonstruktion stützen.15
4.1. Erkenntnisse der Neurophysiologie
In wieweit wirken sich nun die sozialen Erfahrungen der Kindheit auf die Persönlichkeit aus? In einem ersten Schritt möchte ich diese Frage auf Basis von neurophysiologischen Erkenntnissen zur postnatalen Entwicklung des menschlichen Gehirns behandeln. Wissenschaftlich definiert beginnt die postnatale Phase am siebten Tag nach der Geburt und endet in diesem Zusammenhang etwa mit Ende des 24. Lebensmonats.
Die Neurophysiologie stützt die Annahme, dass die sozialen Erfahrungen der Kindheit die menschliche Persönlichkeit stark beeinflussen. Wie bereits in der Erläuterung der medizinischen Sicht des Säuglings16 erwähnt, vollziehen sich auch auf der Ebene der Verhaltensorganisation genetisch gesteuerte Reifeprozesse (Kombination von Anlage und Umwelt). Hierbei übt die Subjekt- Umwelt-Interaktion eine zentrale Rolle aus. Diese Interaktion besteht in den ersten Lebensmonaten in erster Linie zwischen dem Säugling und seinen nahen Bezugspersonen. In den ersten 24 Monaten findet 5/6 des Hirnwachstums statt, sodass sich in dieser Zeit entsprechend der genetischen und kontextuellen Faktoren (Umweltstimuli) eine spezifische synaptische Struktur etabliert. Die Wissenschaft ist der Auffassung, dass das sich entwickelnde Gehirn externe Reize benötigt, um seine eigene Organisation herauszubilden. „Ein Mechanismus, der die Verhaltensorganisation vermutlich von Anfang an dauerhaft prägt, besteht in der neuronalen Bahnung affektiver Systeme durch das vorherrschende Interaktionsklima“17.
4.2.Bindungserfahrung und Persönlichkeit
Die Bindungstheorie beschäftigt sich ebenfalls mit der Frage nach den Auswirkungen frühkindlicher sozialer Erfahrungen auf die spätere Persönlichkeit eines Menschen.
4.2.1. Die ethologische Bindungsforschung
Als bekannteste Vertreter der ethologischen Bindungsforschung beschäftigten sich John BOWLBY und Mary AINSWORTH mit der Kontinuität von Bindungsmustern bisher am intensivsten.
4.2.1.1. Grundannahmen der Bindungstheorie
Ethologische Theorien vertreten die Hypothese, dass gewisse artspezifische Instinktprogramme existieren. BOWLBY spricht dem Bindungsverhalten eine spezifische biologische Funktion zu, welche er für ebenso wichtig hält wie das Paarungsverhalten.18 Dabei spricht er in diesem Zusammenhang nicht von ‚Trieb’ oder ‚Bedürfnis’, sondern führt es auf die Aktivierung gewisser menschlicher Verhaltenssysteme zurück. Deren Ergebnis ist die Nähe zur Mutter. Unter Bindungsverhalten versteht er also die Einforderung von Interaktionen durch beispielsweise Schreien, Lächeln oder Nachfolgen. BOWLBY sieht dieses Verhalten unabhängig von der Bedürfnisbefriedigung.
Somit knüpft die Bindungstheorie an die Neigung des Menschen an, enge emotionale Beziehungen zu anderen Menschen zu entwickeln.
4.2.1.2.. Bindungsvarianten
In diesem Abschnitt sollen die Variationen von Bindungsmustern erörtert werden, die sich bei den meisten Kindern um den ersten Geburtstag herum manifestiert haben.
Bindung meint in diesem Zusammenhang die Art der Organisation sozialer Beziehungen19. Es ist ein zielkorrigiertes Verhaltenssystem, mit dem das Kind eigenständig das von ihm benötigte Nähe-Distanz-Verhältnis regulieren kann. Das primäre Bezugssystem des Kindes, in dem es Bindungsmuster entwickelt, gilt als Lernfeld für den Erwerb elementarer Fähigkeiten zur Bewältigung von Anforderungen und Konfliktsituationen.
AINSWORTH20 benennt drei Muster, die untereinander differentielle Unterschiede aufweisen:
Sichere Bindung: Erlebt ein Kind Kummer oder bedrohliche Situationen, entwickelt es nur dann Vertrauen in seine soziale Umwelt, wenn es Unterstützung erhält, die verlässlich, einfühlsam und verständnisvoll ist. Dann erfährt es sich als liebenswert und entwickelt ein positives Selbstbild.
Unsicher-vermeidende Bindung: Ein Kind kann beginnen, sich dauerhaft emotional zu distanzieren und seine natürlichen Kontakt-, Zuwendungsund Nähebedürfnisse zu unterdrücken, wenn in seiner sozialen Umwelt emotionale Unterstützung und Rückhalt fehlen. Das Kind wirkt dann emotional selbstgenügsam.
Unsicher-ambivalente Bindung resultiert aus der Erfahrung inkonsistenten Verhaltens seitens der primären Bindungspersonen. Das bedeutet, dass das Verhalten der Eltern für das Kind nicht vorhersehbar ist: gelegentlich sind sie zugewandt und interessiert, verhalten sich dann aber aus für den Säugling nicht erkennbaren Gründen ablehnend. Zudem sind Vater und Mutter stark mit sich selbst beschäftigt. Hieraus entsteht eine übermäßige Anhänglichkeit. Der Wunsch nach Nähe und Aufmerksamkeit wird groß, darunter mischt sich jedoch der Ärger auf die Bindungspersonen.
Für eine sichere Bindung sind die Feinfühligkeit sowie die Kontingenz in der frühen Mutter-Kind-Interaktion von großer Bedeutung. Folgende beiden Beispiele sollen die Wichtigkeit dieser beiden Variablen verdeutlichen:
Beispiel 1: Es kommt zu keinem funktionierenden, interaktiven Zusammenwirken zwischen dem Säugling und der Bezugsperson, weil die Mutter beispielsweise die Signale des Kindes übersieht oder falsch interpretiert - aus Sicht des Kindes ist das Verhalten der Mutter nicht feinfühlig und nachvollziehbar. Es reagiert mit Rückzug und Vermeidung. Die Interaktionssequenzen verkürzen sich und die Phasen, in denen sich das Kind aus der Interaktion zurückzieht, werden länger.
Beispiel 2: Steht dem Kind jedoch eine Bezugsperson gegenüber, die in der Lage ist wie ein Spiegel auf die seine Verhaltensäußerungen zu reagieren, verlängern sich die Interaktionssequenzen und es kommt zu einem intensiven und harmonischen, kommunikativen Austausch. An diesem Zusammenspiel wirkt das Kind aktiv mit und erhält somit die Möglichkeit, erste Kontroll- und Kompetenzerfahrungen zu machen.
4.3. Neuere Ergebnisse der Bindungsforschung
Schon BOWLBY stellte klar, dass „die zufriedenstellende Entwicklung der Bindung für die seelische Gesundheit (des Menschen) ... wichtig ist“21 und „daß Bindungsverhalten nicht mit der Kindheit verschwindet, sondern das ganze Leben hindurch anhält.“22
Weiterhin erkennt VÖLKER23, dass sich die frühe Beziehungsqualität zur Mutter bis zum Schuleintritt als sehr stabil erweist.
Verschiedene Studien24 aus den 19990er Jahren konnten folgende Merkmale der kindlichen Persönlichkeit auf ihre Bindungserfahrungen zurückführen: Sicher gebundene Kinder neigen eher zu einem positiven Weltbild und lernen offensichtlich den einfühlsamen Umgang mit anderen bereits zuhause.
Außerdem läßt sich bei ihnen ein besseres Selbstwertgefühl beobachten. Sie haben häufiger gute Freunde und sind seltener schlechtgelaunt, feindselig und aggressiv. Kinder mit unsicherer Bindung zeigen sich eher abhängig und unselbständig.
Im Vorschulalter weisen Kinder mit sicherer Bindung mehr Konzentration im Spiel auf, mehr positive Affekte und eine größere soziale Kompetenz. „(Es) drängt sich der Eindruck auf, dass Kinder mit einer sicheren Mutterbindung die sie umgebende Welt offener und realistischer wahrnehmen und weniger Ausflucht zu selektiver Wahrnehmung suchen müssen, weil mindestens eine ihrer engen Beziehungen befriedigend ist.“25
Um die Wichtigkeit einer positiven, feinfühligen und konsistenten frühen Mutter- Kind-Interaktion für eine angemessene Persönlichkeitsentwicklung abschließend noch einmal hervor zu heben, möchte ich mich auf SCHILDBACH beziehen. Sie sieht es als erwiesen an, dass Kinder positive Interaktionserfahrungen als emotionale Ressourcen auch im außerfamiliären Bereich nutzen können. Für umschriebene Bereiche konnten Zusammenhänge mit der Bindungsqualität einjähriger Kinder und Kinder bis zu einem Alter von 10 Jahren nachgewiesen werden.26
5. Literaturverzeichnis
Bowlby, John: Bindung - Eine Analyse der Mutter-Kind-Beziehung, Frankfurt am Main, 1986
Bronfenbrenner, Urie: Die Ökologie der menschlichen Entwicklung, 1. Aufl, Stuttgart 1980
Dornes, Martin: Der kompetente Säugling - Die präverbale Entwicklung des Menschen, Frankfurt am Main 1993
dtv Brockhaus Lexikon, München 1989
Rohnke, Hans-Joachim: Bindungstheorie und offene Arbeit: Erkenntnisse,
Informationen und Hinweise für ElementarpädagogInnen, aus:
KinderTageseinrichtungen aktuell, KiTa Hessen/Rheinland-
Pfalz/Saarland, Heft 10/2001
Schildbach, Beate: Einfühlsame Mutter kann Belastbarkeit des Kindes erhöhen - Ergebnisse aus der Bindungsforschung, aus: beziehungsweise, Heft 21/2001
Völker, Susanne: Frühe Interaktionsmuster zwischen Mutter und Kind - Die Bedeutung von Wärme und Kontingenz, Hamburg 2002
[...]
1 Völker, S.11
2 dies., S.11
3 nach Dornes, S. 79
4 Dornes, S.101
5 nach Dornes, S.103
6 Dornes, S.103
7 Bronfenbrenner, S. 44
8 ders., S.19
9 ders., S.29
10 ders., S.37
11 ders., S.73
12 der., S.75
13 dtv Lexikon, Bd.14, S.62
14 Völker, S.5
15 vgl. Völker, S. 7ff
16 siehe Kapitel 2
17 Völker, S.10
18 vgl. Bowlby, S.173
19 vgl. Völker, S.14f
20 vgl. Völker, S.15f u. Rohnke
21 Bowlby, S.303
22 ders., S.319
23 vgl. Völker, S.14
24 vgl. Rohnke
25 Rohnke
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit beschäftigt sich mit der frühen Eltern-Kind-Interaktion und -Bindung, deren Entstehung, Entwicklung und Bedeutung für die Charakter- und Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes. Sie untersucht, ob das erste Lebensjahr besonders entscheidend ist.
Wie hat sich die Sichtweise auf Säuglinge im Laufe der Zeit verändert?
Früher wurden Säuglinge als passive, undifferenzierte und hilflose Wesen betrachtet. Heute sieht man sie als kompetente, aktive, differenzierte und beziehungsfähige Individuen mit eigenen Fähigkeiten und Gefühlen.
Was bedeutet der Begriff "kompetenter Säugling"?
Der Begriff beschreibt die veränderte Sichtweise auf Säuglinge, die nun als aktiv, differenziert und beziehungsfähig wahrgenommen werden. Sie verfügen über Fähigkeiten und Gefühle, die ihnen ermöglichen, am sozialen Geschehen teilzunehmen und Anforderungen zu bewältigen.
Welche Rolle spielen die Sinnessysteme des Säuglings?
Aus medizinischer Sicht sind alle Sinnessysteme des Säuglings bereits direkt nach der Geburt funktionsfähig, müssen jedoch durch angemessene sensorische Stimulation weiter ausgebildet werden.
Was ist das Selbstempfinden und wie entwickelt es sich?
Das Selbstempfinden ist der zentrale Bezugspunkt, nachdem der Säugling sich selbst und die Welt erfährt und organisiert. Es entwickelt sich in Stufen: auftauchendes Selbstempfinden, Kernselbstempfinden, subjektives Selbstempfinden und verbales Selbstempfinden.
Was bedeutet die aktive Suche nach erlebter Gemeinsamkeit?
Trotz des Bedürfnisses nach Umsorgung suchen Säuglinge aktiv nach Gemeinsamkeitserlebnissen (‚self-with-others‘), ohne dass die Grenzen von Selbst und Objekt verschwimmen. Diese soziale Erfahrung kann ohne Beeinträchtigung des Selbstempfindens entstehen.
Was ist die "Ökologie der menschlichen Entwicklung" nach BRONFENBRENNER?
Es ist eine Theorie, die Entwicklung als einen Prozess der gegenseitigen Anpassung zwischen dem aktiven, sich entwickelnden Menschen und seiner Umwelt betrachtet. Diese Entwicklung findet im Kontext verschiedener Systeme statt.
Welche vier Systeme der Entwicklung gibt es nach BRONFENBRENNER?
BRONFENBRENNER unterscheidet vier Systeme: Mikrosystem (direkte Wechselbeziehungen), Mesosystem (Wechselbeziehungen zwischen Lebensbereichen), Exosystem (Lebensbereiche, an denen die Person nicht direkt beteiligt ist) und Makrosystem (kulturelle Kontexte).
Welche Rolle spielen affektive Beziehungen in der Entwicklung?
Affektive Beziehungen spielen eine zentrale Rolle, da sie zu einer fortschreitenden Komplexität im Verhalten der Beziehungspartner führen. Positive und gegenseitige Beziehungen erhöhen das Tempo und die Wahrscheinlichkeit von Entwicklungsprozessen.
Wie beeinflussen soziale Erfahrungen in der Kindheit die Persönlichkeit?
Neurophysiologische Erkenntnisse stützen die Annahme, dass soziale Erfahrungen der Kindheit die Persönlichkeit stark beeinflussen. Die Subjekt-Umwelt-Interaktion prägt die neuronale Bahnung affektiver Systeme.
Was sind die Grundannahmen der Bindungstheorie?
Die Bindungstheorie geht von der Neigung des Menschen aus, enge emotionale Beziehungen zu anderen Menschen zu entwickeln. Bindungsverhalten wird als die Einforderung von Interaktionen (Schreien, Lächeln) verstanden und ist unabhängig von der Bedürfnisbefriedigung.
Welche Bindungsvarianten gibt es?
AINSWORTH unterscheidet drei Muster: sichere Bindung, unsicher-vermeidende Bindung und unsicher-ambivalente Bindung.
Was sind die Merkmale sicher gebundener Kinder?
Sicher gebundene Kinder neigen zu einem positiven Weltbild, lernen den einfühlsamen Umgang mit anderen, haben ein besseres Selbstwertgefühl, häufig gute Freunde und sind seltener schlechtgelaunt, feindselig und aggressiv.
Was ist die Bedeutung der frühen Mutter-Kind-Interaktion für die Persönlichkeitsentwicklung?
Eine positive, feinfühlige und konsistente frühe Mutter-Kind-Interaktion ist entscheidend für eine angemessene Persönlichkeitsentwicklung. Kinder können positive Interaktionserfahrungen als emotionale Ressourcen auch im außerfamiliären Bereich nutzen.
- Quote paper
- Friederike Sturm (Author), 2002, Zum Stellenwert der frühen Eltern-Kind-Interaktion in der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106565