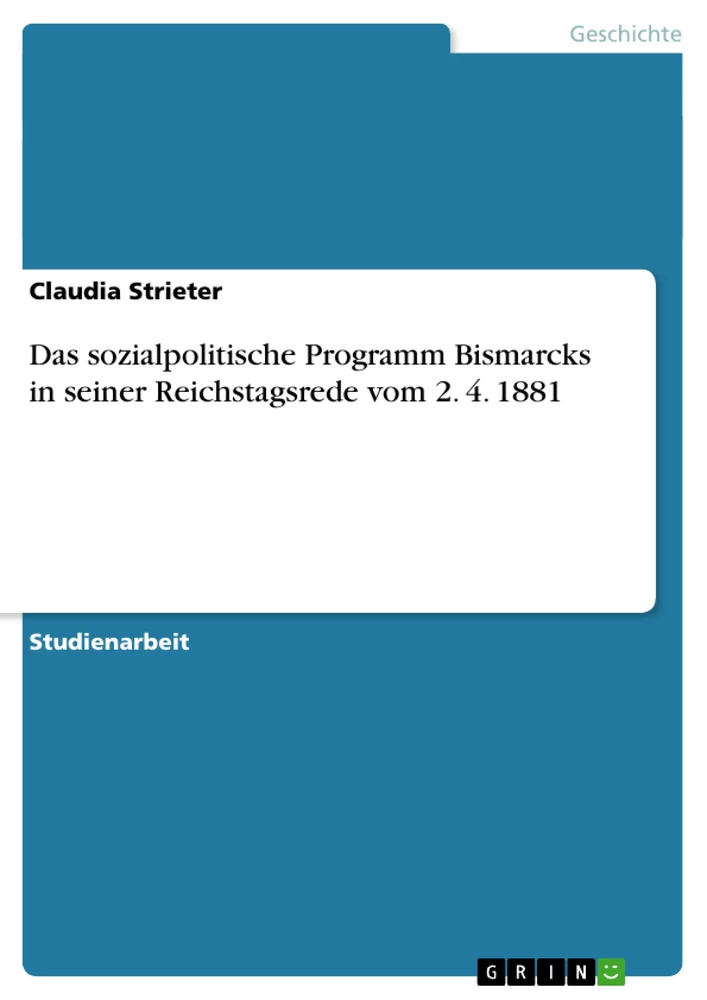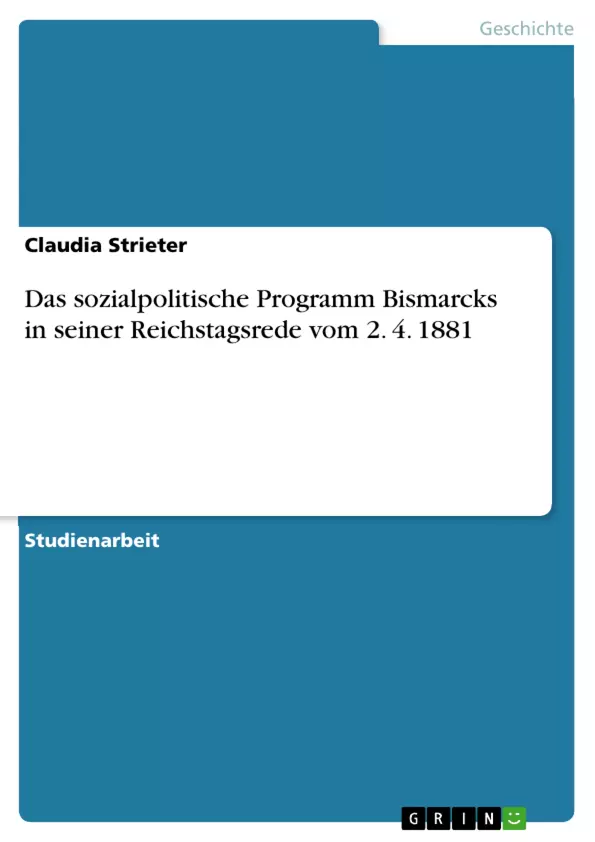In einer Zeit des Wandels, als das Deutsche Kaiserreich unter der Führung Otto von Bismarcks nach innerer Stabilität suchte, entbrannte ein Kampf um die soziale Frage, der die Nation bis ins Mark erschütterte. Diese aufschlussreiche Analyse dringt tief in die Motive und Mechanismen der Bismarckschen Sozialpolitik ein, insbesondere im Kontext der bahnbrechenden Rede vom 2. April 1881 vor dem Reichstag zum Unfallversicherungsgesetz. War es reine Nächstenliebe, politische Kalkulation oder gar der verzweifelte Versuch, die aufkeimende Arbeiterbewegung zu zähmen? Die Untersuchung beleuchtet Bismarcks vielschichtige Beweggründe, die von der Eindämmung der Sozialdemokratie über die Stärkung des Staates bis hin zu einem patriarchalisch geprägten Verantwortungsgefühl reichten. Doch die Bismarcksche Sozialgesetzgebung stieß auf Widerstand: Industrielle fürchteten um ihre Wettbewerbsfähigkeit, Großgrundbesitzer um ihre Privilegien, Arbeiter um ihre Autonomie und die Parteien im Reichstag um ihre Macht. Die Arbeit analysiert die komplexen Reaktionen der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen – von den Liberalen, die den Staatsinterventionismus ablehnten, über das Zentrum, das um kirchliche Initiativen bangte, bis hin zu den Sozialdemokraten, die in der Politik des Kanzlers eine gezielte Schwächung ihrer Bewegung witterten. Es wird gezeigt, wie Bismarck versuchte, die Kritiker zu beschwichtigen und seine Politik als notwendige Antwort auf die soziale Not und als Bollwerk gegen revolutionäre Kräfte darzustellen. Die Hausarbeit erörtert die Frage, inwieweit Bismarcks Sozialpolitik tatsächlich dazu beitrug, die Arbeiter für den Staat zu gewinnen und die politische Landschaft des Kaiserreichs nachhaltig zu prägen. Entdecken Sie die intrigenreiche Geschichte eines politischen Schachzuges, der die deutsche Sozialgeschichte für immer verändern sollte, und tauchen Sie ein in die Welt der Macht, Ideologien und sozialen Kämpfe im Kaiserreich. Diese Arbeit bietet eine profunde Analyse der Hintergründe, Motive und Auswirkungen der Bismarckschen Sozialpolitik und wirft ein neues Licht auf eine der prägendsten Epochen der deutschen Geschichte, die bis heute nachwirkt. Das sozialpolitische Programm Bismarcks, das Unfallversicherungsgesetz, die Motive hinter der Gesetzgebung und die Reaktionen der Gesellschaft werden hier detailliert untersucht. Tauchen Sie ein in die Debatten des Reichstags, die Ängste der Industriellen und die Hoffnungen der Arbeiterklasse. Ein Muss für jeden, der die deutsche Geschichte und die Ursprünge des Sozialstaates verstehen will.
I. Einleitung
Im Rahmen des Proseminars über die zentralen Probleme der Innenpolitik im Ausgang der Bismarckzeit beschäftige ich mich in dieser Hausarbeit mit dem sozialpolitischen Programm Bismarcks.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Rede des Reichskanzlers Bismarck vor dem deutschen Reichstag vom 2. April 1881.1 Mit dieser Rede griff er in die Beratung des Reichstages über den Entwurf des ersten Unfallversicherungsgesetzes ein und verdeutlichte darin seinen Standpunkt zur staatlichen Sozialpolitik.
Aufgrund der Länge der Rede kann ich ihr im Zuge dieser Hausarbeit leider nicht bis ins Detail gerecht werden und sehe mich gezwungen, mich schwerpunktmäßig auf
- die Motive der Bismarckschen Sozialpolitik und
- die Haltung gegenüber der Sozialpolitik und Bismarcks Reaktion darauf
zu konzentrieren.
Bezüglich des ersten Schwerpunktes werde ich die Rede daraufhin untersuchen, inwiefern in ihr die, in der Forschungsliteratur genannten Motive Bismarcks zur Sozialpolitik zum Tragen kommen und bezüglich des zweiten Punktes werde ich nach einer kurzen Vorstellung der Positionen der verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Gruppen, darauf eingehen, wie Bismarck sich in seiner Rede damit auseinandersetzt.
II. Rede Bismarcks vor dem Deutschen Reichstag zum Unfallversicherungsgesetz vom 2. April 1881
1. Situationseinführung
Im Zuge der Industrialisierung hatte sich das Proletariat herausgebildet, dessen spezifische Merkmale die persönliche Freiheit und die „Eigentumslosigkeit“2 waren. Diese Kombination bewirkte jedoch, daßes für den Arbeiter und seine Familie, wenn er sein einziges Kapital, - nämlich seine Arbeitskraft - durch Krankheit, Unfall, vorzeitige Erwerbsunfähigkeit oder Alter verlor, kein soziales Netz gab, welches ihn auffing.3 Es gab zwar zahlreiche kleine, berufs - und branchengebundene lokale Unterstützungskassen, die in solchen Fällen Hilfe versprachen, aber diese standen, um effektiv zu sein, nur Arbeitern mit sicheren und hohen Löhnen offen. Fabrikarbeiter und Tagelöhner wurden also weitestgehend ausgeschlossen4 und waren im Notfall auf die Armenunterstützung der Gemeinden angewiesen. Die Inanspruchnahme von Armenhilfe oder der noch schlimmere Gang zum Armenhaus waren jedoch mit einem sozialen Stigma verbunden, das die in Not Geratenen als Arbeitsscheue und heruntergekommene Existenzen brandmarkte, und es war meist keine Rückkehr in normale Verhältnisse möglich.5
Die durch die Industrialisierung bedingten zunehmenden sozialen Probleme verlangten regelrecht nach einer vom Staat gelenkten und garantierten Sozialpolitik, weil die Armenhilfe, mit der in der ersten Industrialisierungsphase versucht wurde, die Not zu lindern,6 auf Dauer nicht dazu geeignet war, denn sie war traditionell lokal gebunden; das heißt zum einen, daßsie der steigenden Mobilität nicht gerecht werden konnte und zum anderen, daßsie auch finanziell nicht stark genug war, um den Problemen Herr zu werden.7
Es dauerte jedoch noch bis der Staat sozialpolitisch wirklich aktiv wurde, und zwar weil er durch die vorherrschende liberale Wirtschaftsauffassung, die eine staatlich gelenkte Sozialpolitik ablehnte und Hilfe zur Selbsthilfe verlangte, behindert wurde. Bismarck, der aufgrund der Indemnitätsvorlage 1866 ein Bündnis mit den Liberalen eingegangen war, sah sich, da er auch in der deutschen Einigungspolitik voran kommen wollte, gezwungen, die Sozialpolitik, deren Notwendigkeit er schon sehr früh erkannt hatte,8 vor der Nationalpolitik zurückzustellen.9
Erste Schritte staatlicher Sozialpolitik, die mit der liberalen Wirtschaftsauffassung vereinbar waren, die Probleme jedoch nicht zu beheben vermochten, waren das „Reichshaftpflichtgesetz“ von 1871 und das „Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen“ von 1876. Das erstgenannte Gesetz gestand den Arbeitern in den Bergwerken, Steinbrüchen oder Fabriken bei unfallbedingter Erwerbsunfähigkeit Entschädigungsansprüche gegenüber dem Unternehmer zu, wenn die Geschädigten in der Lage waren, diesem die Schuld an dem Unfall zu beweisen. Diese Regelung der Verschuldenshaftung führte zu einer ganzen Reihe von Prozessen, in denen die Arbeiter verzweifelt versuchten, ihr Recht durchzusetzen. Das Gesetz erwies sich letztlich aber als völlig unzureichend, da nur für etwa 20 Prozent aller betrieblichen Unfälle Entschädigungen gezahlt wurden. Mit dem Hilfskassengesetz war die Regierung bemüht, den Krankenversicherungsschutz auf weite Teile der Arbeiterschaft auszudehnen, indem sie den eingeschriebenen Hilfskassen beispielsweise das Recht zusprach einen örtlichen Beitrittszwang für Gesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeiter anzuordnen. Aber diese Bemühung verzeichnete nicht den erhofften Erfolg.10
Nach dem 1879 vollzogenen Bruch mit den Liberalen konnte sich Bismarck nun endlich einer Wohlfahrtspolitik des Staates zuwenden. Diese war für ihn auch aus dem Grund so dringend geworden, weil die Sozialdemokraten, die er als die gefährlichsten Gegner der Monarchie ansah,11 immer mehr Zuspruch fanden. Auf diese Gefahr reagierte er zuerst einmal nur repressiv mit dem Sozialistengesetz vom 21. Oktober 1878. Doch er war sich bewußt, daßer dadurch bei den Arbeitern keine Loyalität dem Staat gegenüber erzeugen konnte und ließin der Thronrede vom 15. Februar 1881 den Entwurf eines Unfallversicherungsgesetzes als „Vervollständigung der Gesetzgebung zum Schutze gegen die sozialdemokratischen Bestrebungen“12 ankündigen.
Der Entwurf wurde auf der Grundlage der Vorschläge des preußischen Handelsministers Theodor Hofmann und des Bochumer Industriellen Louis Baare ausgearbeitet und am 8. März 1881, nach einer geringfügigen Überarbeitung durch den Bundesrat, dem Reichstag zugeleitet. Darin war die Errichtung einer Reichsversicherungsanstalt vorgesehen, bei der alle Arbeiter, sofern sie nicht mehr als 2000 Mark im Jahr verdienten, verpflichtend gegen Unfallfolgen versichert sein sollten. Die Versicherungsprämien sollten bei denen, die über ein Jahreseinkommen von weniger als 750 Mark verfügten zu zwei Dritteln vom Unternehmer und zu einem Drittel vom Staat übernommen werden; diejenigen, die zwischen 750 und 1000 Mark jährlich verdienten, sollten ein Drittel selbst bezahlen und bei denen, die mehr verdienten, sollten die Beiträge von Arbeitnehmern und Unternehmern jeweils zur Hälfte getragen werden. Die Leistungen sollten bei völliger Erwerbslosigkeit zwei Drittel des Lohns betragen und bei Unfall mit Todesfolge, sollte den Angehörigen eine Rente zustehen.13
Die im Mittelpunkt dieser Hausarbeit stehende Rede Bismarcks wurde im Rahmen der am 1. und 2. April 1881 stattfindenden Beratungen des Reichstages über diese Gesetzesvorlage gehalten.
2. Aussagewert der Quelle
Die Rede Bismarcks vom 2. April 1881 ist vor dem Deutschen Reichstag in Reaktion auf die Angriffe der Parteien bezüglich des Unfallversicherungsgesetzes gehalten worden. Mit dem Großteil der im Reichstag vertretenen Parteien hatte Bismarck zu diesem Zeitpunkt ein gespanntes Verhältnis und nach dem Bruch mit den Nationalliberalen hatte er zunehmend große Schwierigkeiten, Mehrheiten für seine Gesetzesvorlagen zu gewinnen und war gezwungen Überzeugungsarbeit zu leisten. Vor diesem Hintergrund mußman nun überlegen, ob diese Rede Bismarcks tatsächliche Motive, die im weiteren noch genau zu erläutern sind, wiederspiegeln kann und beim genauen Lesen der Quelle stellt man mit Erstaunen fest, daßBismarck darin kaum ein Blatt vor den Mund genommen hat. Alle Motive, die er mit der Gesetzesvorlage verbindet, werden ausgesprochen oder zumindest angedeutet. Ich kann mich also der Beurteilung Gerhard A. Ritters über diese Quelle nur anschließen, der die Reichstagsrede vom 2. April 1881 als „für seine [Bismarcks - der Verfasser] Ideen grundlegende Rede“14 bezeichnet hat.
3. Motive der Bismarckschen Sozialpolitik
Bismarcks politisches Ziel, die Gefahr der Sozialdemokratie für die Monarchie dadurch abzuwenden, daßer ihnen mit Hilfe der Sozialpolitik die Basis entzieht,15 kommt in seiner Rede mehrmals zum Ausdruck. So sagt er zum Beispiel, daßneben den repressiven Maßnahmen des Sozialistengesetzes „auch positiv etwas geschehen müsse, um die Ursachen des Sozialismus, insoweit ihnen eine Berechtigung beiwohnt, zu beseitigen“16 und, daßdas Gesetz „vielleicht auch die gemäßigten Sozialdemokraten milder in ihrem Urteil über die Regierung Stimmen kann“17.
Um diese Entfremdung und eine Loyalität der Arbeiter gegenüber dem monarchischen Staat zu erreichen, sollte der Staat als Hauptkostenträger im Vordergrund stehen. Deswegen setzte Bismarck vor allem auf den Staatszuschußzur Finanzierung der Unfallversicherung, die er aber öffentlich nicht damit, sondern mit der Befürchtung vor zu hohen Belastungen der Industrie bzw. der Arbeiter begründete.18 Die Finanzierung des Staatszuschußes sollte zum einen durch die Übertragung der Lasten aus Armenverbänden auf den Staat19 und zum anderen über eine Tabak- oder Branntweinsteuer20 gedeckt werden.
Ein weiteres politisches Motiv war die Einschränkung der Macht des Reichstages.21 Dies sollte mit Hilfe der staatlichen Trägerschaft der Versicherung geschehen, die - ähnlich dem bereits gegründeten, zunächst einmal auf Preußen beschränkten Volkswirtschaftsrat - als Nebenparlament fungieren sollte. Beide sollten die Macht der Regierung gegenüber dem Reichstag stärken, denn Bismarck war davon überzeugt, daßnur die Reichsregierung in der Lage sei, solch wichtige Fragen wie die Sozialgesetzgebung in Angriff zu nehmen, weil sie im Gegensatz zu den Parteien Gesamtinteressen verfolge.22
Bismarck begründet die Errichtung der Reichsversicherungsanstalt und den Staatszuschußdamit, daßansonsten kein Versicherungszwang zu verantworten sei, denn private Versicherungen könnten im Gegensatz zu staatlichen Einrichtungen die Sicherheit der Gelder nicht garantieren.23 Der Staat tritt also sowohl als Hauptkostenträger als auch als Wohlfahrtsgarant in Erscheinung.
Neben diesen handfesten politischen Motiven war Bismarck aber auch aufgrund seiner patriarchalischen Tradition der Überzeugung, daßes die moralische Verpflichtung des Staates sei, den niederen Klassen in Notlagen zu helfen.24 Dies klingt auch in seiner Rede an, wenn er von dem, dem Gesetz inne liegenden „Gefühl menschlicher Würde“25 spricht, das auch der ärmste Deutsche behalten solle. Außerdem war es auch eine Reaktion auf tatsächlich vorhandene Probleme, die im Zuge der Industrialisierung und auch in Folge der Depression entstanden waren und nach Lösungen verlangten.26
4. Die Haltung gegenüber der Bismarckschen Sozialpolitik und Bismarcks Reaktion darauf
Diese Rede war vor allem an die Kritiker und Gegner der Sozialpolitik gerichtet. Bismarck war bestrebt deren Zweifel auszuräumen und sie dazu zu bewegen, daßsie dem Gesetz zustimmten. Die kritische Haltung gegenüber einer staatlichen Sozialpolitik stützte sich auf eine breite gesellschaftliche Basis.27 Die Beweggründe waren jedoch ganz unterschiedlicher Natur. Sie waren abhängig vom gesellschaftlichen Stand und von der Parteienzugehörigkeit.
a. Industrielle
Die Bedenken der Industriellen bezüglich der Sozialpolitik richteten sich vor allem gegen einen staatlichen Arbeiterschutz, den sie als Eingriff in die Unternehmerfreiheit ansahen.28 Bismarck kam ihnen aufgrund dessen und weil er im Arbeiterschutz eine Gefährdung der Konkurrenzfähigkeit befürchtete entgegen und nahm diesen gar nicht in sein sozialpolitisches Programm auf. Außerdem blockierte er jegliche Bemühungen des Reichstages diesbezüglich.29 Desweiteren war ein Großteil der Industriellen bemüht, die Leistungen möglichst gering zu halten, weil sie befürchteten, daßdie Arbeiter sonst zu große Unabhängigkeit gegenüber dem Unternehmer erlangen würden und weil die Arbeiter angehalten werden sollten, trotz verminderter Leistungsfähigkeit möglichst lange weiterzuarbeiten.30
Prinzipiell waren die Industriellen jedoch für eine Sozialpolitik der Fürsorge, denn sie begriffen sie „als ein Instrument zur Sicherung ihrer Interessen“31, was bedeutet, daßsie versuchten, das durch das Reichshaftpflichtgesetz immer schlechter werdende Verhältnis zu den Arbeitern zu verbessern. Aufgrund dessen übten sie, wie die Denkschrift des Bochumer Handelskammerpräsidenten Louis Baare beweist, nicht unerheblichen Einflußauf die Konzeptualisierung der Sozialgesetzgebung aus. Bezogen auf die Finanzierung der Unfallversicherung gab es auch durchaus die Bereitschaft, sich zu beteiligen, so lange die Belastung nicht zu hoch und zu gleichen Teilen auch dem Staat und den Arbeitern auferlegt werden würde.32 Eine möglicherweise zu hohe Belastung der Industrie durch die Unfallversicherung und eine daraus folgende Gefährdung ihrer Konkurrenzfähigkeit bildeten für Bismarck in seiner Rede auch die Hauptargumente für den von ihm angestrebten Staatszuschuß.33
b. Die Großgrundbesitzer
Da das Gesetz vorerst lediglich auf die Arbeiterschaft in der Industrie Bezug nahm und die Landarbeiter ausschloß, hatten die Großgrundbesitzer, denen Bismarck aufgrund seiner Herkunft besonders nahe stand, erst einmal nichts zu befürchten. Sie sorgten sich aber aufgrund der stattfindenden Diskussion, das Gesetz auf alle Berufsgruppen auszuweiten, daßdies in naher Zukunft geschehen könnte. Bismarck geht in seiner Rede auf diese Sorgen ein, indem er zum einen dem in der Öffentlichkeit herrschenden Unverständnis, daßdas Gesetz nur auf eine begrenzte Berufsgruppe bezogen ist,34 Rechnung trägt und eine Ausweitung auf „jeden Deutschen“35 in Aussicht stellt, zum anderen jedoch die Ausweitung der Versicherung auf die Landarbeiter aufgrund einer Reihe von Schwierigkeiten in weite Ferne rücken läßt.36
c. Die Arbeiter
Die soziale Lage eines Großteils der Lohnarbeiter war, wie bereits ausgeführt, bedrückend und was noch erschwerend hinzukam, war ihre gesellschaftliche Stellung, die von Diskriminierung und Isolierung gekennzeichnet war.37 Diese brisante Mischung hatte dazu geführt, daßsich die Arbeiter in Vereinen und Parteien organisiert hatten, deren Forderungen dem Liberalismus und auch der Monarchie entgegenliefen.38 Auf diese Weise wurde die Arbeiterfrage zunehmend als Bedrohung empfunden und es wurde nach Lösungen gesucht. Bismarcks Ansatz auf die Existenzängste der Arbeiter mit Schutzmaßnahmen zu reagieren, hatte, neben der Überzeugung, daßihnen wirklich geholfen werden muß,39 zum Ziel die Arbeiter zu beruhigen, sie den Sozialdemokraten zu entfremden und dem Staat gegenüber loyaler zu stimmen.40 Dabei heilte er aber nur das erste Übel, mit dem die Arbeiter zu kämpfen hatten und übersah, daßdie gefürchtete Arbeiterbewegung nicht nur um soziale Absicherung der Arbeiter sondern auch um deren gesellschaftliche Anerkennung kämpfte. Außerdem war ihm aufgrund seiner politischen Erwägungen nicht an den Bedürftigen an sich gelegen, sondern vorerst nur an den „bedrohlichen Bedürftigen“41.
Trotz der Betonung Bismarcks, daßdie Arbeiter durch dieses Gesetz zufriedener werden und ihre „menschliche Würde“42 behalten können, haftet diesem der bittere Geschmack der Hilfsbedürftigkeit an, die der Staat damit wohlwollend bekämpft, ohne dabei den Vertretern der Arbeiter Mitspracherechte einzuräumen, was außerdem ein Gefühl der Abhängigkeit vermittelte.43 Auch trug die unglückliche Verbindung mit dem Sozialistengesetz nicht gerade dazu bei, daßdie Arbeiter das Vorhaben der Regierung ausschließlich freudig aufnahmen und sich dem Staat zu Dankbarkeit verpflichtet fühlten, sondern es verstärkte teilweise auch das Mißtrauen, das durch die Gewerkschaften und die Sozialdemokraten noch geschürt werden konnte.
d. Der Reichstag
Den größten Widerstand hatte Bismarck jedoch vom Reichstag und von den in ihm vertretenen Parteien zu erwarten. Seit dem Bruch mit den Liberalen 1879 hatte er große Schwierigkeiten Mehrheiten zu gewinnen und war bestrebt, die Macht des Reichstages zu beschränken. Diese Bestrebung war den Parlamentariern jedoch nicht entgangen und erweckte deren Mißtrauen.44 Die Bedenken gegen die Sozialversicherung waren aber je nach parteipolitischem Standpunkt unterschiedlicher Art.
a) Die Liberalen
Bei den Liberalen taten sich in der Debatte besonders der Führer der Fortschrittspartei Eugen Richter und der Sezessionist Ludwig Bamberger hervor. Ihre Argumente gegen die Gesetzesvorlage bezogen sich vor allem auf die, ihrer liberalen Tradition völlig entgegenstehenden Interventionspolitik des Staates. Sie sprachen sich gegen die Einführung öffentlicher Versicherungsanstalten, gegen Staatszuschußund gegen den Versicherungszwang aus.45 Den Staatszuschußkanzelten sie als Sozialismus ab (Eugen Richter bezeichnete ihn sogar als Kommunismus) und dies vertrüge sich nicht mit dem Sozialistengesetz, wie Bamberger ausführte. Bismarck bezeichnete den Vorwurf des Staatssozialismus als „Spiel mit dem Schatten an der Wand“46 und bezüglich der anderen Kritikpunkte erteilte er der „laisser faire, laisser aller“- Politik der Liberalen eine endgültige Absage, indem er sich zur Verantwortung des Staates gegenüber den Notleidenden bekannte.47
Die Kritik Eugen Richters zielt auch auf die Finanzierung des Staatszuschußes über indirekte Steuern, wodurch eine Beitragszahlung der Arbeiter und eine zu hohe Belastung der Industrie vermieden werden sollte. Es verstoße gegen das Verursacherprinzip, wenn alle für eine relativ kleine Gruppe zahlen müßten. Dem versucht Bismarck entgenzuhalten, daßder Staat nur eine geringe Mehrbelastung zu erwarten hätte, da er einfach an die Stelle der Armenverbände tritt, die bisher ohnehin von der öffentlichen Hand getragen worden sind.48
b) Das Zentrum
Die Bedenken des Zentrums gegen die Sozialversicherung bezogen sich auf eine „Staatsomnipotenz“, die man mit diesem Gesetz verband. Der Errichtung einer Reichsversicherungsanstalt stand man aufgrund förderalistischer Bedenken skeptisch gegenüber und die Partei befürchtete, daßmit der staatlichen Fürsorgepolitik andere vor allem kirchliche Initiativen geschwächt würden.49
Bismarck, der bemüht war, das Zentrum für seine Initiative zu gewinnen, um doch noch eine Mehrheit dafür zu erlangen, ließderen Kritik in seiner Rede völlig außen vor und betonte mehrmals das christliche Element der Gesetzesvorlage.50
c) Die Sozialdemokraten
Den Sozialdemokraten ging die Initiative nicht weit genug. Ihnen fehlte das Element des Arbeiterschutzes. Sie trauten diesem Staat keine Arbeiterpolitik zu. Sie befürchteten eine gezielte Schwächung ihrer Hilfskassen und der Gewerkschaften. Kurzum sie witterten die Absicht Bismarcks nach der „Peitsche“ nun mit „Zuckerbrot“ gegen ihre Organisation vorzugehen und waren dementsprechend mißtrauisch,51 daßsie allen Grund dazu hatten, beweisen einige Aussagen der Rede Bismarcks. Einmal abgesehen von den Beleidigungen gegen die Sozialdemokraten äußert Bismarck auch recht unverblümt, das mit der Gesetzesvorlage verbundene Ziel, die Arbeiter der Partei zu entfremden, indem er es als Aufgabe der Regierung bezeichnet, neben den Gefahren der Sozialdemokratie auch „die Vorwände, die zur Aufregung der Massen benutzt werden, die sie für verbrecherische Lehren erst gelehrig machen ... zu beseitigen“52 und die Arbeiter „dem verderblichen Einflußeiner ihrer Intelligenz überlegenen Berdsamkeit der eloquenten Streber, die die Massen auszubeuten suchen, zu entreißen.“53
III. Ausblick
Zur weiteren Beratung der Gesetzesvorlage einigte man sich auf die Einsetzung einer Reichstagskommission, die den Entwurf des Unfallversicherungsgesetzes jedoch so umgestaltete, daßam Ende gerade die Elemente, auf die Bismarck besonderen Wert gelegt hatte, herausfielen. So wurde die Reichsversicherungsanstalt durch Landesversicherungsanstalten ersetzt und der Staatszuschußgänzlich gestrichen, lediglich der Versicherungszwang wurde beibehalten.54 Die Folge davon war, daßBismarck die Fassung der Kommission durch den Bundesrat ablehnen ließund den Reichstag auflöste, „um die kommenden Wahlen unter der Devise des „sozialen Königtums“ zu führen.“55 Die Wahl wurde jedoch zum Debakel, denn das Zentrum, die Linksliberalen und die Sozialdemokraten, die dem „sozialen Königtum“ am kritischsten gegenüber standen, waren die Gewinner. Zur Eröffnung des Reichstages am 17. November 1881 stellte die „Erste Kaiserliche Botschaft zur sozialen Frage“ die Einrichtung einer Unfallversicherung, einer Krankenversicherung und einer Invaliditäts- und Altersversicherung in Aussicht, welche 1884, 1883 und 1889 nach zähen Verhandlungen schließlich auch verabschiedet werden konnten.
Bismarcks Hoffnung, den Parlamentarismus zu schwächen, verkehrte sich vielmehr ins Gegenteil, denn der Reichstag hatte entscheidend auf die Gestaltung der Gesetze in seinem Sinne Einflußgenommen. Auch die erhoffte Wirkung die Arbeiter durch die Sozialversicherung den Sozialdemokraten zu entfremden und zu einer staatsloyalen Haltung zu bringen, blieb aus.56 Bismarcks Ziel dadurch seine innenpolitische Position zu stärken, wurde 1890 schließlich völlig konterkariert, als die von Wilhelm II. verfolgte Sozialpolitik des Arbeiterschutzes zur Kanzlerkrise und schließlich zur Entlassung Bismarcks führte.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daßsich die Sozialpolitik bezüglich der politischen Intentionen Bismarcks als Fehlschlag erwies, daßsie aber sozialpolitisch betrachtet, den Grundstein für eine ausbaufähige Daseinsfürsorge bildete.57
IV. Quellen- und Literaturverzeichnis
Quellenverzeichnis
- Otto von Bismarck. Werke in Auswahl, 6. Bd.: Reichsgestaltung und europäische Friedenswahrung, 2. Teil: 1877-1882, hg. von Afred Milatz (Ausgewählte Quellen zur Geschichte der Neuzeit. Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe), Darmstadt 1976, S. 514-532.
- Bismarck, Gesammelte Werke, Bd. 12
Literaturverzeichnis
- Monika Breger, Der Anteil der deutschen Großindustriellen an der Konzeptualisierung der Bismarckschen Sozialgesetzgebung, in: Bismarcks Sozialstaat. Beiträge zur Geschichte der Sozialpolitik und zur sozialpolitischen Geschichtsschreibung, hg. von Lothar Machtan, Frankfurt/New York 1994, S. 25-60.
- Johannes Frerich, Martin Frey, Handbuch der Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland, Bd. 1: Von der vorindustriellen Zeit bis zum Ende des Dritten Reiches, München/Wien 1993.
- Volker Hentschel, Geschichte der deutschen Sozialpolitik 1880-1980. Soziale Sicherung und kollektives Arbeitsrecht, Frankfurt am Main 1983.
- Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Bd. 4: Struktur und Krisen des Kaiserreichs, Stuttgart 1969.
- Heinz Lampert, Lehrbuch der Sozialpolitik, Berlin / Heidelberg / New York / Tokyo 1985.
- Wolfgang J. Mommsen, Das Ringen um den nationalen Staat. Die Gründung und der innere Ausbau des Deutschen Reiches unter Otto von Bismarck 1850 bis 1890, in: Propyläen Geschichte Deutschlands, hg. von Dieter Groh, Bd. 7.1, Berlin 1993.
- Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1918.Bd. 1: Arbeitswelt und Bürgergeist, München 1990.
- Gerhard A. Ritter, Sozialversicherung in Deutschland und England. Entstehung und Grundzüge im Vergleich, München 1983.
- Hans Rothfels, Prinzipienfragen der Bismarckschen Sozialpolitik, in: ders., Bismarck. Vorträge und Abhandlungen, Stuttgart / Berlin / Köln / Mainz 1970, S. 166- 181.
- Manfred G. Schmidt, Sozialpolitik. Historische Entwicklung und internationaler Vergleich, Opladen 1988.
- Florian Tennstedt, Sozialgeschichte der Sozialpolitik in Deutschland. Vom 18. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg, Göttingen 1981.
- W. Weddingen, Sozialversicherung I: Theorie, in: HdSW, Bd. 9, 1956, S. 594 ff.
- Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 3: Von der „Deutschen Doppelrevolution“ bis zum Ende des Ersten Weltkriegs 1849-1918, München 1995.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Außerdem habe ich mich noch mit:
Otto Quandt, Die Anfänge der Bismarckschen Sozialgesetzgebung und die Haltung der Parteien (Das Unfallversicherungsgesetz 1881-1884), in: Historische Studien, Heft 344, Berlin 1938. beschäftigt. Aber dieses Werk erschien mir, aufgrund der stark ausgeprägten nationalsozialistischen Grundtendenz nicht zitierfähig.
[...]Footnotes
- Otto von Bismarck. Werke in Auswahl, 6. Bd.: Reichsgestaltung und europäische Friedenswahrung, 2. Teil: 1877-1882, hg. von Afred Milatz (Ausgewählte Quellen zur Geschichte der Neuzeit. Freiherr vom SteinGedächtnisausgabe), Darmstadt 1976, S. 514-532. Der Herausgeber garantiert eine wortgetreue und vollständige Wiedergabe der Rede Bismarcks. ↩
- Heinz Lampert, Lehrbuch der Sozialpolitik, Berlin/Heidelberg/New York/Tokyo 1985, S. 20. ↩
- W. Weddingen, Sozialversicherung I: Theorie, in: HdSW, Bd. 9, 1956, S. 594 ff: „Er besaßalle nur erdenklichen Freiheiten, einschließlich derjenigen, zu hungern und zu verhungern, wenn er seine Arbeitskraft am Arbeitsmarkt nicht oder nur zu unzureichenden Preisen absetzen konnte, oder wenn ihm (diese) seine Arbeitskraft infolge von Alter oder Krankheit verloren ging.“ Zitiert nach: Heinz Lampert, Lehrbuch der Sozialpolitik, Berlin/Heidelberg/New York/Tokyo 1985, S. 34. ↩
- Florian Tennstedt, Sozialgeschichte der Sozialpolitik in Deutschland. Vom 18. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg, Göttingen 1981, S. 35 (im folgenden zitiert als Florian Tennstedt, Sozialgeschichte der Sozialpolitik in Deutschland, Göttingen 1981). ↩
- Wolfgang J. Mommsen, Das Ringen um den nationalen Staat. Die Gründung und der innere Ausbau des Deutschen Reiches unter Otto von Bismarck 1850 bis 1890, in: Propyläen Geschichte Deutschlands, hg. von Dieter Groh, Bd. 7.1, Berlin 1993, S. 625 (im folgenden zitiert als: Wolfgang J. Mommsen, Das Ringen um den nationalen Staat, Berlin 1993. ↩
- Florian Tennstedt, Sozialgeschichte der Sozialpolitik in Deutschland, Göttingen 1981, S. 81. ↩
- Wolfgang J. Mommsen, Das Ringen um den nationalen Staat, Berlin 1993, S. 624. ↩
- Das äußert sich beispielsweise in den Gesprächen, die er 1863 mit Lassalle geführt hatte und in dem von ihm 1871 verfaßten und 1877 überarbeiteten sozialpolitischen Programm, in dem er bereits Unfallversicherungsgesetz und Invaliditätsrente in Aussicht gestellt hatte. Vgl. dazu Lothar Gall, Bismarck. Der weiße Revolutionär, Frankfurt am Main, Berlin, Wien 1980, S.605. ↩
- Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Bd. 4: Struktur und Krisen des Kaiserreichs, Stuttgart 1969, S. 1193. ↩
- Johannes Frerich, Martin Frey, Handbuch der Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland, Bd. 1: Von der vorindustriellen Zeit bis zum Ende des Dritten Reiches, München/Wien 1993, S. 93 f . ↩
- Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1918, Bd. 1: Arbeitswelt und Bürgergeist, München 1990, S. 124. ↩
- Bismarck, Gesammelte Werke, Bd. 12, S. 186 f. ↩
- Wolfgang J. Mommsen, Das Ringen um den nationalen Staat, Berlin 1993, S. 638 f. ↩
- Gerhard A. Ritter, Sozialversicherung in Deutschland und England. Entstehung und Grundzüge im Vergleich, München 1983, S. 35. ↩
- Gerhard A. Ritter, Sozialversicherung in Deutschland und England. Entstehung und Grundzüge im Vergleich, München 1983, S. 28. ↩
- Anhang, S. 16, Z. 4-6. ↩
- Anhang, S. 15, Z. 38 f. ↩
- Anhang, S. 22, Z. 17 ff. ↩
- Anhang, S. 20, Z. 4 und S. 32, Z. 31. ↩
- Anhang, S. 25, Z. 25. ↩
- Hans Rothfels, Prinzipienfragen der Bismarckschen Sozialpolitik, in: ders., Bismarck. Vorträge und Abhandlungen, Stuttgart / Berlin / Köln / Mainz 1970, S. 177. ↩
- Anhang, S. 16, Z. 13 ff und S. 26, Z. 32 ff. ↩
- Anhang, S. 24, Z. 12 ff. ↩
- Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1918.Bd. 1: Arbeitswelt und Bürgergeist, München 1990, S. 338. ↩
- Anhang, S. 20, Z. 24. ↩
- siehe Situationseinführung. ↩
- Wolfgang J. Mommsen, Das Ringen um den nationalen Staat, Berlin 1993, S.640. ↩
- Monika Breger, Der Anteil der deutschen Großindustriellen an der Konzeptualisierung der Bismarckschen Sozialgesetzgebung, in: Bismarcks Sozialstaat. Beiträge zur Geschichte der Sozialpolitik und zur sozialpolitischen Geschichtsschreibung, hg. von Lothar Machtan, Frankfurt/New York 1994, S. 45 (im folgenden zitiert als: Monika Breger, Der Anteil der deutschen Großindustriellen an der Konzeptualisierung der Bismarckschen Sozialgesetzgebung, Frankfurt/New York 1994.). ↩
- Gerhard A. Ritter, Sozialversicherung in Deutschland und England. Entstehung und Grundzüge im Vergleich, München 1983, S. 45. ↩
- Monika Breger, Der Anteil der deutschen Großindustriellen an der Konzeptualisierung der Bismarckschen Sozialgesetzgebung, Frankfurt/New York 1994, S.45. ↩
- Monika Breger, Der Anteil der deutschen Großindustriellen an der Konzeptualisierung der Bismarckschen Sozialgesetzgebung, Frankfurt/New York 1994, S. 25. ↩
- Monika Breger, Der Anteil der deutschen Großindustriellen an der Konzeptualisierung der Bismarckschen Sozialgesetzgebung, Frankfurt/New York 1994, S. 29. ↩
- Vgl. Anhang, S. 19, Z. 26 ff. und S. 22, Z. 17 ff. ↩
- Wolfgang J. Mommsen, Das Ringen um den nationalen Staat, Berlin 1993, S. 641. ↩
- Anhang, S. 18, Z. 13. ↩
- ebd. Z. 23 ff. ↩
- Florian Tennstedt, Sozialgeschichte der Sozialpolitik in Deutschland, Göttingen 1981, S. 143. ↩
- Florian Tennstedt, Sozialgeschichte der Sozialpolitik in Deutschland, Göttingen 1981, S. 139. ↩
- Vgl. Anhang, S. 20, Z. 23 ff. ↩
- Der Arbeiter soll gegen die Hetze der Sozialdemokraten immunisiert werden, indem er gar nicht mehr mit Leid konfrontiert wird. (Anhang, S. 20, Z. 39 ff.) ↩
- Volker Hentschel, Geschichte der deutschen Sozialpolitik 1880-1980. Soziale Sicherung und kollektives Arbeitsrecht, Frankfurt am Main 1983, S. 10. Dieses Argument, mit welchem er schon damals in anderer Form bereits konfrontiert wurde, versucht Bismarck dadurch zu entkräften, daßdas Gesetz durch eine zu große Ausdehnung der zu Versicherten gefährdet sei. (Anhang, S. 18, Z. 19 ff.) ↩
- Anhang, S. 20, Z. 24. ↩
- Heinz Lampert, Lehrbuch der Sozialpolitik, Berlin/Heidelberg/New York/Tokyo 1985, S. 71 f. ↩
- Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1918.Bd. 1: Arbeitswelt und Bürgergeist, München 1990, S. 345. ↩
- Wolfgang J. Mommsen, Das Ringen um den nationalen Staat, Berlin 1993, S. 641 f. ↩
- Anhang, S. 22, Z. 10. ↩
- Anhang, S. 17, Z. 21 ff und auf S. 31, Z. 33 ff reagierte Bismarck auf Bambergers Vorwurf, das Gesetz ähnele dem „panem et circensem“ Roms, indem er es als ein „angenehmes Gefühl“ bezeichnete „für die weniger vom Glück begünstigten Klassen ... sorgen zu können“. ↩
- Anhang, S. 20, Z. 3 ff, S. 25, Z. 15 ff und S. 30, Z. 5 ff. ↩
- Wolfgang J. Mommsen, Das Ringen um den nationalen Staat, Berlin 1993, S. 643. ↩
- Anhang, S. 22, Z. 14; S. 25, Z. 14; S. 33, Z. 4. ↩
- Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 3: Von der „Deutscher Doppelrevolution“ bis zum Ende des Ersten Weltkriegs 1849-1918, München 1995, S. 912; Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1918.Bd. 1: Arbeitswelt und Bürgergeist, München 1990, S. 345. ↩
- Anhang, S. 21, Z. 26-28. ↩
- Anhang, S. 32, Z. 5-7. ↩
- Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Bd. 4: Struktur und Krisen des Kaiserreichs, Stuttgart 1969, S.1198. ↩
- Wolfgang J. Mommsen, Das Ringen um den nationalen Staat, Berlin 1993, S. 644. ↩
- Gerhard A. Ritter, Sozialversicherung in Deutschland und England. Entstehung und Grundzüge im Vergleich, München 1983, S. 51. ↩
- Manfred G. Schmidt, Sozialpolitik. Historische Entwicklung und internationaler Vergleich, Opladen 1988, S. 31. ↩
Häufig gestellte Fragen
- Was ist das Thema dieser Hausarbeit?
- Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem sozialpolitischen Programm Bismarcks, insbesondere mit seiner Rede vor dem Deutschen Reichstag zum Unfallversicherungsgesetz vom 2. April 1881.
- Welche Schwerpunkte werden in der Hausarbeit behandelt?
- Die Hausarbeit konzentriert sich hauptsächlich auf die Motive der Bismarckschen Sozialpolitik sowie auf die Haltung verschiedener gesellschaftlicher und politischer Gruppen gegenüber dieser Politik und Bismarcks Reaktion darauf.
- Welche Motive hatte Bismarck für seine Sozialpolitik?
- Zu den Motiven Bismarcks gehörten die Eindämmung der Sozialdemokratie, die Stärkung der Loyalität der Arbeiter gegenüber dem Staat, die Einschränkung der Macht des Reichstages, die Wahrnehmung des Staates als Wohlfahrtsgarant und eine moralische Verpflichtung des Staates, den niederen Klassen in Notlagen zu helfen.
- Wie reagierten die Industriellen auf Bismarcks Sozialpolitik?
- Die Industriellen waren besorgt über staatlichen Arbeiterschutz und sahen ihn als Eingriff in die Unternehmerfreiheit an. Sie befürchteten auch, dass die Arbeiter zu unabhängig werden könnten. Grundsätzlich waren sie aber für eine Sozialpolitik der Fürsorge, die ihre Interessen sicherte.
- Wie reagierten die Großgrundbesitzer auf Bismarcks Sozialpolitik?
- Die Großgrundbesitzer befürchteten, dass das Gesetz, das zunächst nur die Arbeiterschaft in der Industrie betraf, auf alle Berufsgruppen ausgeweitet werden könnte, insbesondere auf die Landarbeiter.
- Wie reagierten die Arbeiter auf Bismarcks Sozialpolitik?
- Die Arbeiter wurden durch die bestehende Diskriminierung und Isolierung sozial benachteiligt. Bismarcks Ansatz zur Reaktion auf die Existenzängste der Arbeiter mit Schutzmaßnahmen zielte darauf ab, die Arbeiter zu beruhigen, sie den Sozialdemokraten zu entfremden und sie dem Staat gegenüber loyaler zu stimmen.
- Wie reagierte der Reichstag auf Bismarcks Sozialpolitik?
- Der Reichstag leistete den größten Widerstand gegen Bismarcks Sozialpolitik. Die Liberalen lehnten die staatliche Intervention ab, das Zentrum befürchtete eine "Staatsomnipotenz", und die Sozialdemokraten kritisierten, dass die Initiative nicht weit genug gehe und befürchteten eine Schwächung ihrer Organisationen.
- Welche Kritikpunkte äußerten die Liberalen an der Gesetzesvorlage?
- Die Liberalen kritisierten vor allem die staatliche Intervention, die Einführung öffentlicher Versicherungsanstalten, den Staatszuschuss und den Versicherungszwang.
- Wie reagierte Bismarck auf die Kritik an seiner Sozialpolitik?
- Bismarck verteidigte die staatliche Verantwortung gegenüber den Notleidenden und wies den Vorwurf des Staatssozialismus zurück. Er betonte das christliche Element der Gesetzesvorlage, um das Zentrum zu gewinnen, und versuchte, die Arbeiter den Sozialdemokraten zu entfremden.
- Welche Auswirkungen hatte Bismarcks Sozialpolitik?
- Bismarcks Hoffnung, den Parlamentarismus zu schwächen und die Arbeiter den Sozialdemokraten zu entfremden, erfüllte sich nicht. Die Sozialpolitik erwies sich jedoch als Grundstein für eine ausbaufähige Daseinsfürsorge.
- Citation du texte
- Claudia Strieter (Auteur), 1998, Das sozialpolitische Programm Bismarcks in seiner Reichstagsrede vom 2. 4. 1881, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106605