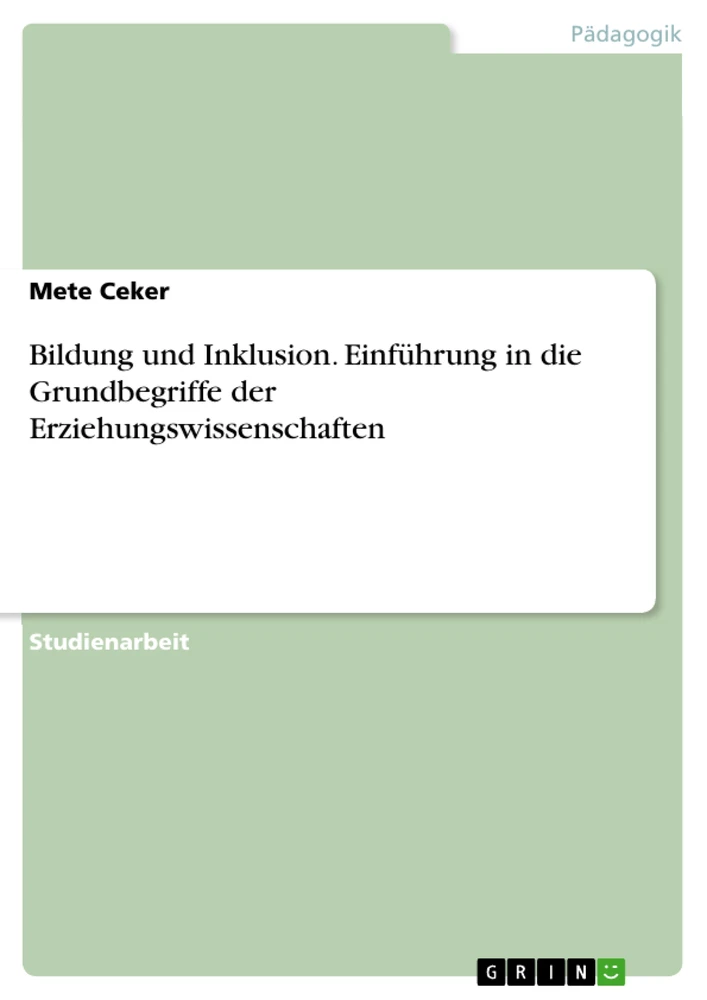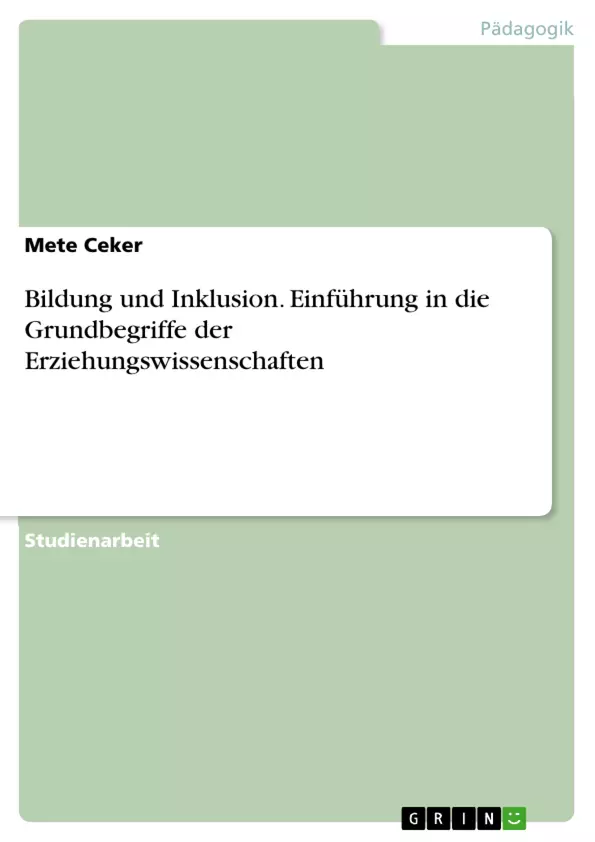Die wissenschaftliche Arbeit beschäftigt sich explizit mit dem Thema Bildung und Inklusion. Ausschlaggebend für die Wahl des Themas war der Besuch einer integrativen Klasse in der Unterstufe (5 - 10. Klasse) und die Begegnung mit Menschen mit Behinderung. Das Ziel der wissenschaftlichen Arbeit liegt darin, sich mit dem Thema Bildung und Inklusion auseinanderzusetzen, es zu analysieren und die Notwendigkeit des Bildungsbegriffs hinsichtlich der Inklusion zu erläutern.
Im ersten Schritt geht es um einige theoretische Hintergründe. Zunächst soll eine begriffliche Grundlage für die vorliegende Arbeit geschaffen werden, indem der Begriff Inklusion erklärt wird. In diesem Zusammenhang wird im nächsten Punkt die Inklusion in den historischen Kontext eingeordnet, welche sich in drei Unterthemen Exklusion zur Inklusion, die Salamanca-Erklärung und die UN-Behindertenrechtskonvention gliedert. In Kapitel drei liegt der Fokus auf dem Thema Inklusion an Schulen bezüglich auf Schulen mit gemeinsamem Lernen, Schulformen, darunter die Regel- und Förderschule, wobei man detailliert auf die Entwicklungen der Förderschulen eingeht. Letztendlich folgt das Kapitel Bildung und Schule mit den Unterkapiteln Bildung im Allgemeinen und die Funktion von Schule. Abschließend wird die Arbeit anhand eines Fazits beendet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Begriffserklärung - Was ist „Inklusion“?
- Inklusion im historischen Kontext
- Von der Exklusion zur Inklusion
- Die Salamanca – Erklärung
- Die UN-Behindertenrechtskonvention
- Inklusion an Schulen
- Schulen mit Gemeinsamem Lernen (GL-Schulen)
- Der Schulformwechsel
- Der Wechsel zu einer Regelschule
- Der Wechsel zu einer Förderschule
- Die Entwicklungen der Förderschulen
- Bildung und Schule
- Bildung im Allgemeinen
- Die Funktion von Schule
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit dem Thema „Bildung und Inklusion“ und analysiert die Notwendigkeit des Bildungsbegriffs im Hinblick auf Inklusion. Die Arbeit basiert auf eigenen Erfahrungen in einer integrativen Klasse und zielt darauf ab, das Thema zu analysieren und den Zusammenhang zwischen Bildung und Inklusion zu erhellen.
- Begriffliche Definition von Inklusion
- Historische Entwicklung von Exklusion zu Inklusion
- Inklusion im Bildungsbereich, insbesondere an Schulen
- Herausforderungen und Chancen der Inklusion
- Die Rolle von Bildung für die gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Inklusion und erläutert die grundlegende Bedeutung von Bildung für Inklusionsprozesse. Anschließend werden theoretische Hintergründe beleuchtet, indem der Begriff „Inklusion“ definiert und in den historischen Kontext eingeordnet wird. Die Entwicklung von Exklusion zu Inklusion wird anhand verschiedener Meilensteine wie der Salamanca-Erklärung und der UN-Behindertenrechtskonvention dargestellt. Der Fokus liegt anschließend auf der Anwendung von Inklusion im Bildungsbereich, insbesondere an Schulen. Das Kapitel „Inklusion an Schulen“ analysiert verschiedene Schulformen, wie Schulen mit Gemeinsamem Lernen und Förderschulen, sowie die Entwicklungen und Herausforderungen der Förderschulen. Abschließend wird die Bedeutung von Bildung und Schule für die Förderung von Inklusion diskutiert.
Schlüsselwörter
Inklusion, Bildung, Behinderung, Salamanca-Erklärung, UN-Behindertenrechtskonvention, Schulen mit Gemeinsamem Lernen, Förderschulen, gesellschaftliche Teilhabe, Menschenrechte, Bildungsgerechtigkeit
Häufig gestellte Fragen
Was wird in dieser Arbeit unter Inklusion verstanden?
Die Arbeit bietet eine begriffliche Definition von Inklusion und ordnet diese in den historischen Kontext der Erziehungswissenschaften ein.
Welche historischen Meilensteine der Inklusion werden behandelt?
Es werden insbesondere die Salamanca-Erklärung und die UN-Behindertenrechtskonvention als zentrale Dokumente auf dem Weg von der Exklusion zur Inklusion thematisiert.
Wie wird Inklusion an Schulen umgesetzt?
Der Fokus liegt auf Schulen mit gemeinsamem Lernen (GL-Schulen) sowie dem Vergleich zwischen Regel- und Förderschulen.
Welche Rolle spielt der Bildungsbegriff für die Inklusion?
Die Arbeit erläutert die Notwendigkeit eines spezifischen Bildungsbegriffs, um gesellschaftliche Teilhabe für Menschen mit Behinderung zu ermöglichen.
Was sind die aktuellen Entwicklungen bei Förderschulen?
Das Dokument analysiert detailliert die Veränderungen und Herausforderungen, denen Förderschulen im Zuge des Inklusionsprozesses gegenüberstehen.
Welche Funktion hat die Schule im Kontext der Inklusion?
Es wird untersucht, wie die Institution Schule zur Bildungsgerechtigkeit und zur Umsetzung von Menschenrechten beitragen kann.
- Quote paper
- Mete Ceker (Author), 2021, Bildung und Inklusion. Einführung in die Grundbegriffe der Erziehungswissenschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1066427