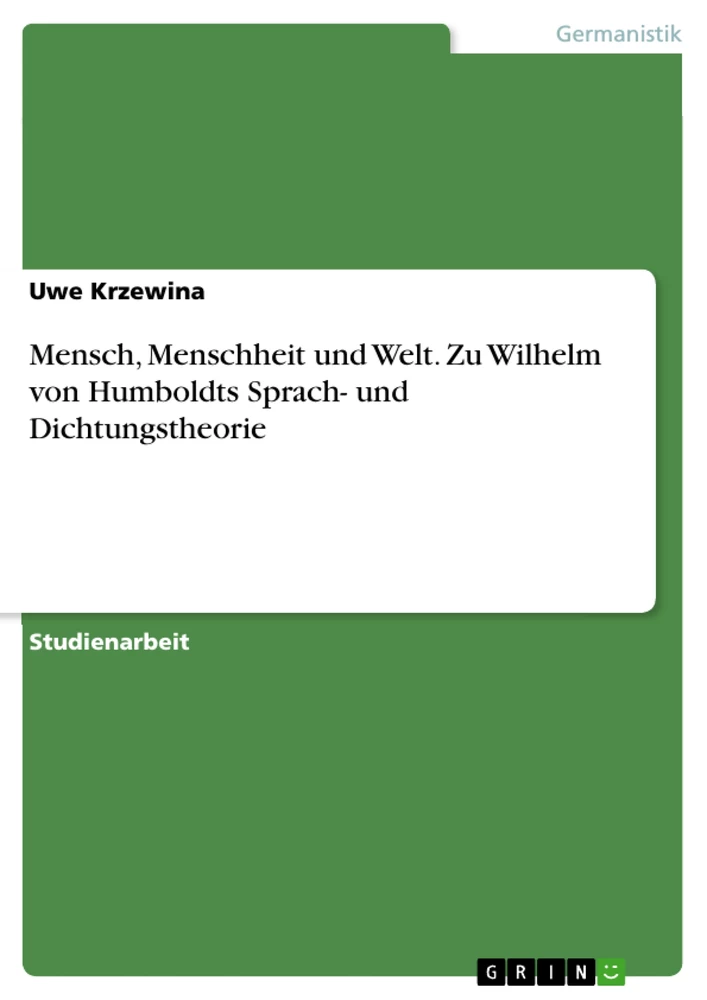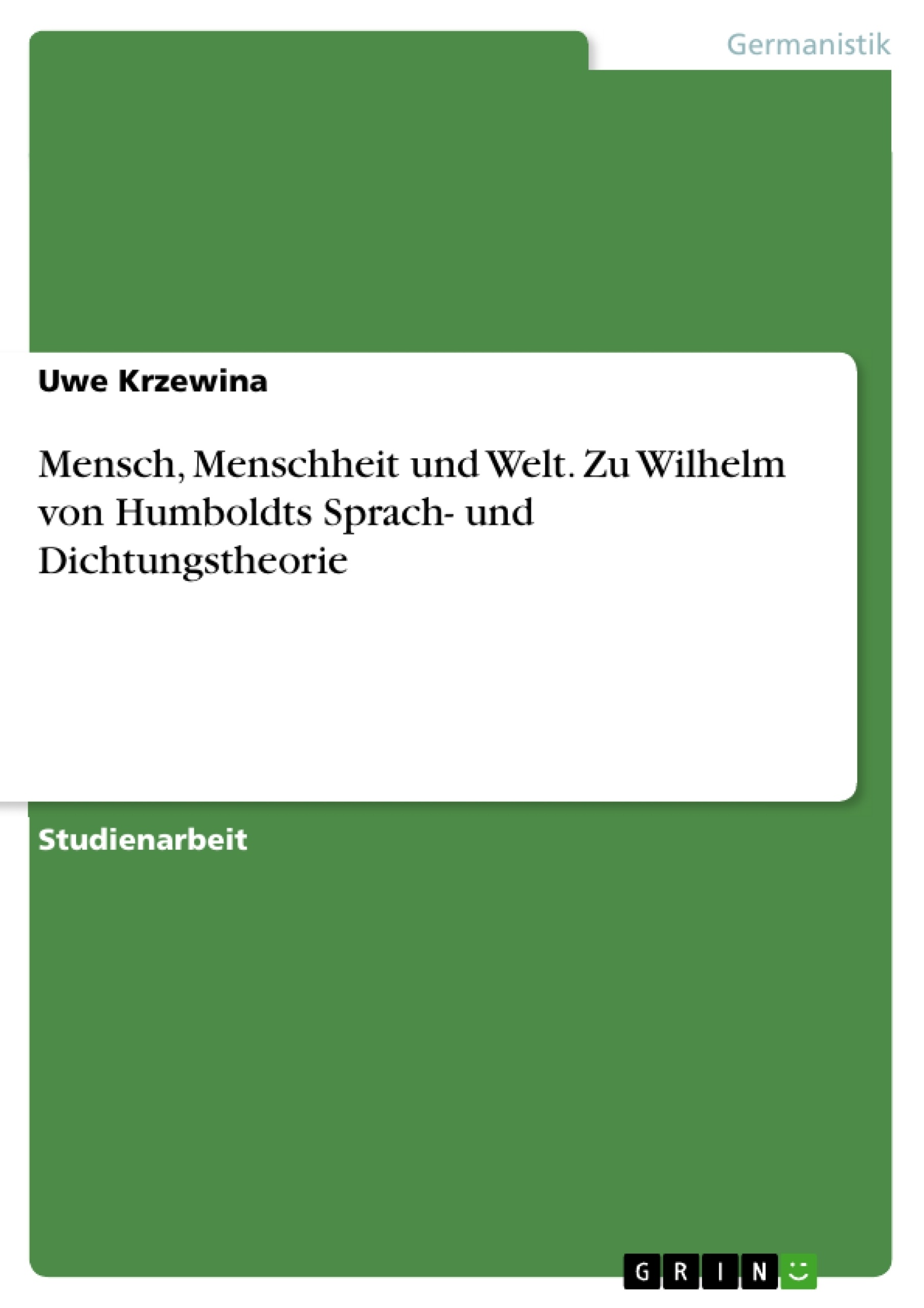Im Jahre 1831 beendete Wilhelm von Humboldt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften seine Vortragsreihe zu Fragen der Sprache, die er am 29. Juni 1820 mit der Vorlesung des Referats „Über das Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachentwickelung“ eröffnet hatte. In dieser letzten Schaffensphase seines Lebens beschäftigte sich Humboldt fast ausschließlich mit dem Sprachstudium, wobei er seine sehr ausführlichen Grundgedanken in dem ersten Akademie-Vortrag kontinuierlich weiterentwickelte, oder um sich der Humboldt-Terminologie anzunähern, weiterwebte.
Im Mittelpunkt seiner Betrachtungen stand dabei immer der Mensch, dessen elementarste Wesenseigenschaft es ist zu sprechen: „Der Mensch ist nur Mensch durch Sprache...“ .
Die drei Aspekte, die im ersten Teil meiner Arbeit näher betrachtet werden sollen, sind die teleologische Funktion von Sprache, fokussiert auf den Sprachursprung, die praktische Funktion von Sprache, also wie sie als Kommunikationsmittel benutzt wird und schließlich die erkenntnistheoretische Funktion von Sprache.
Im Anschluss daran werde ich im zweiten Teil Humboldts Dichtungstheorie eingehend beleuchten, verstand Humboldt Dichtung doch als spezifischen Gebrauch von Sprache: „Dichtung ist .. im Lichte der reifen Humboldtschen Sprachtheorie nicht mehr ... Überwindung der als bloß verstandesmäßig und willkürlich aufgefassten Sprache, sondern eine der Natur der Sprache gerade wesentlich entsprechende Art des Gebrauchs der Sprache.“ Ging es bei der Darstellung der Sprachtheorie also um den ontologischen Aspekt des Untersuchungsgegenstandes, so wird bei den Ausführungen über die Humboldtsche Dichtungstheorie die konkrete Realisation von Sprache beschrieben und die Poetologie Humboldts geklärt.
Zwar beschäftigte sich Humboldt mit Kunst und Dichtung viele Jahre bevor er zu einem Studium der Sprache gelangte. Doch soll die chronologische Reihenfolge zu Gunsten der argumentativen Folge vernachlässigt werden.
In einem abschließenden Teil werde ich dann Humboldts Sprach- und Dichtungstheorie einer Kritik bezüglich ihrer gesellschaftlichen Konsequenzen unterziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Sprache
- Sprachentwicklung im Hinblick auf den Sprachursprung
- Sprache als Kommunikationsmittel
- Sprache als Bedingung der Möglichkeit von Wahrnehmung
- Die Konstituierung des Subjekts und die Dialogizität von Sprache
- Sprache und Erkenntnis
- Die Dichtung
- Die Dichtung als spezifische sprachliche Rede
- Die Unterscheidung von Wirklichkeit und Bild
- Die Verwandlung von Wirklichkeit in ein Bild
- Der Zweck der Verwandlung
- Die Dichtung als spezifische sprachliche Rede
- Zusammenfassung
- Kritik
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Wilhelm von Humboldts Sprach- und Dichtungstheorie. Ziel ist es, Humboldts zentrale Gedanken zur Entstehung, Funktion und erkenntnistheoretischen Bedeutung von Sprache sowie seine Vorstellung von Dichtung als spezifischem Sprachgebrauch zu beleuchten.
- Sprachentwicklung und Sprachursprung
- Sprache als Kommunikationsmittel und Bedingung für Wahrnehmung
- Sprache und Erkenntnis
- Dichtung als spezifische sprachliche Rede
- Die Verwandlung von Wirklichkeit in ein Bild durch Dichtung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit stellt Humboldts Sprach- und Dichtungstheorie vor und beleuchtet seine zentrale These: „Der Mensch ist nur Mensch durch Sprache...“. Sie untersucht die teleologische Funktion von Sprache im Hinblick auf den Sprachursprung, die praktische Funktion von Sprache als Kommunikationsmittel und schließlich die erkenntnistheoretische Funktion von Sprache.
Die Sprache
Das Kapitel analysiert Humboldts Gedanken zur Sprachentwicklung, insbesondere im Hinblick auf den Sprachursprung. Es beleuchtet die Rolle der Sprache als Kommunikationsmittel, die Bedingung der Möglichkeit von Wahrnehmung und die Konstituierung des Subjekts durch Sprache. Außerdem wird die Beziehung zwischen Sprache und Erkenntnis untersucht.
Die Dichtung
Dieses Kapitel widmet sich Humboldts Dichtungstheorie und untersucht Dichtung als spezifischen Sprachgebrauch. Es beleuchtet die Unterscheidung von Wirklichkeit und Bild in der Dichtung, die Verwandlung von Wirklichkeit in ein Bild und den Zweck dieser Verwandlung.
Schlüsselwörter
Wilhelm von Humboldt, Sprachtheorie, Dichtungstheorie, Sprachentwicklung, Sprachursprung, Sprache als Kommunikationsmittel, Sprache und Erkenntnis, Dichtung als spezifischer Sprachgebrauch, Bildlichkeit, Wirklichkeitstransformation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von Wilhelm von Humboldts Sprachtheorie?
Humboldt postuliert, dass der Mensch erst durch die Sprache zum Menschen wird und betrachtet Sprache als Bedingung für Wahrnehmung und Erkenntnis.
Wie definiert Humboldt das Verhältnis von Dichtung und Sprache?
Dichtung wird als ein spezifischer, der Natur der Sprache wesentlich entsprechender Gebrauch der Sprache angesehen, nicht als bloße Überwindung des Verstandes.
Welche Funktionen der Sprache werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert die teleologische Funktion (Sprachursprung), die praktische Funktion (Kommunikation) und die erkenntnistheoretische Funktion der Sprache.
Was versteht Humboldt unter der Verwandlung von Wirklichkeit in ein Bild?
In der Dichtung wird die Wirklichkeit durch die Sprache in ein Bild transformiert, um einen spezifischen ästhetischen oder erkenntnisfördernden Zweck zu erfüllen.
Welche Rolle spielt die Dialogizität bei Humboldt?
Die Sprache dient als Mittel zur Konstituierung des Subjekts im Dialog, wobei das Ich sich erst im Austausch mit einem Du erfährt.
- Arbeit zitieren
- Uwe Krzewina (Autor:in), 2002, Mensch, Menschheit und Welt. Zu Wilhelm von Humboldts Sprach- und Dichtungstheorie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10671