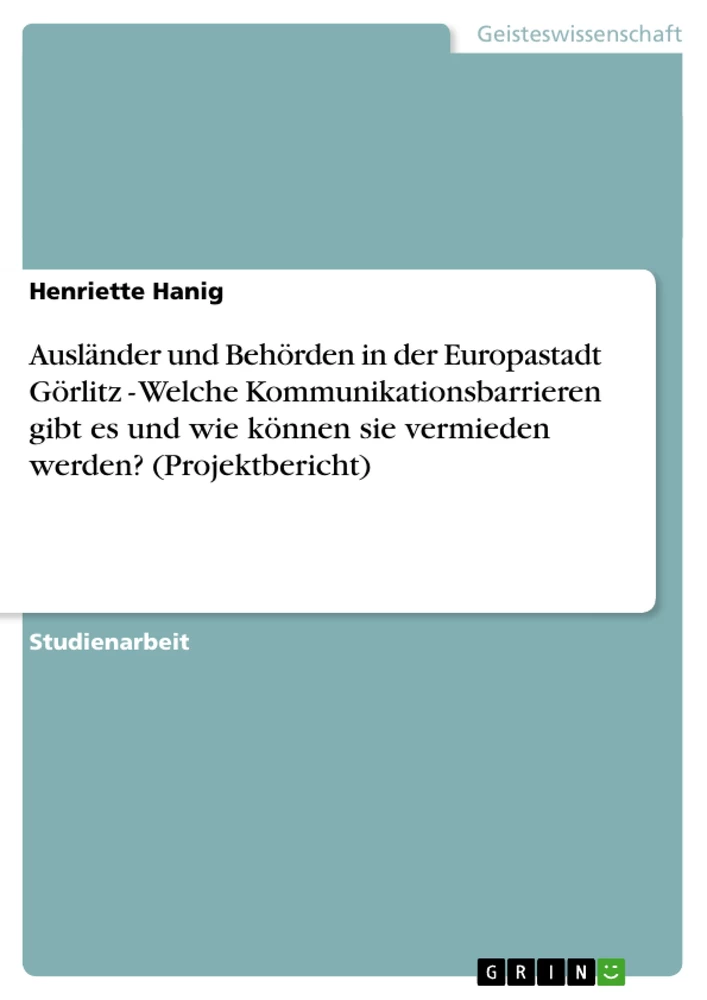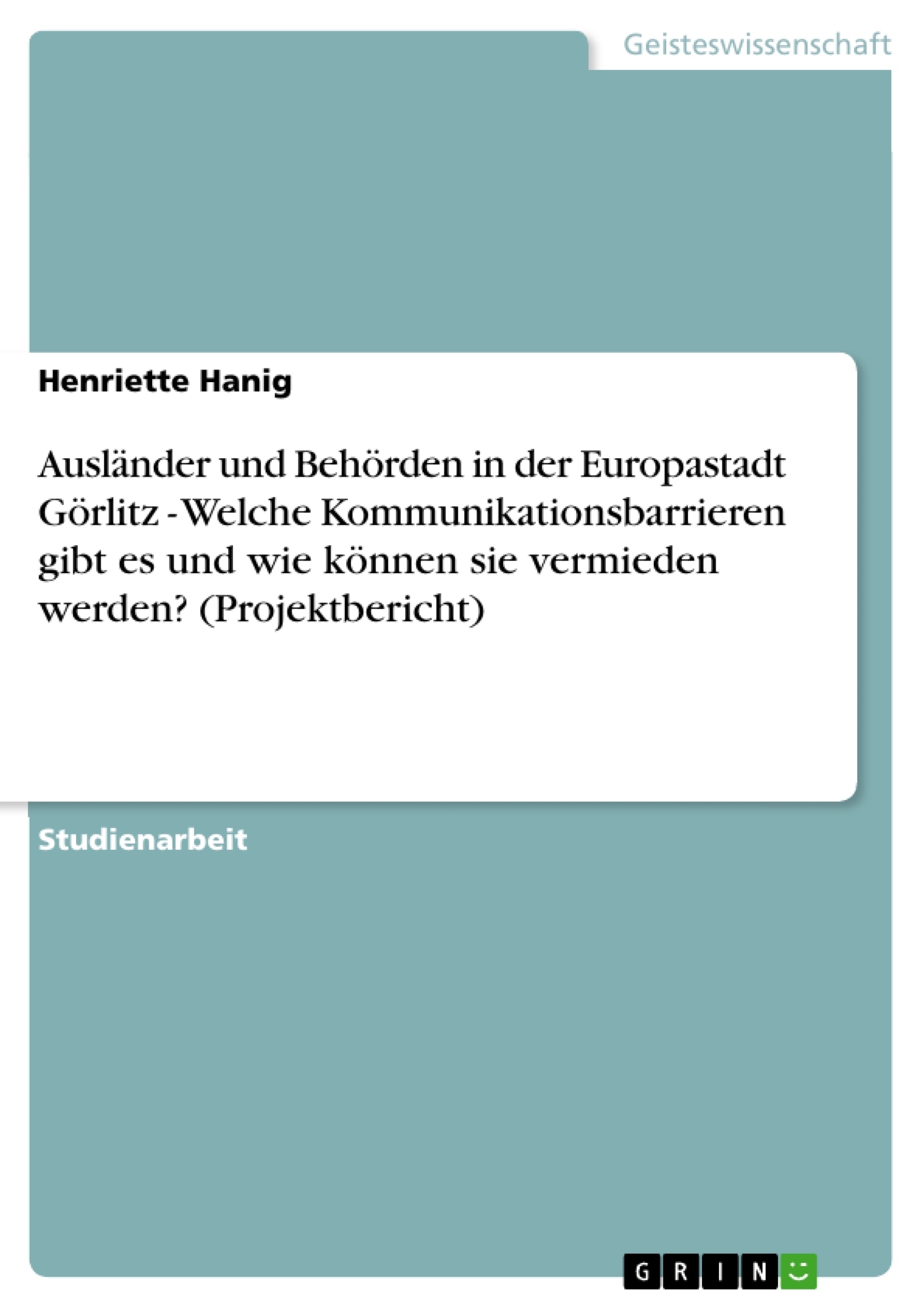Was bedeutet es, fremd in einer Stadt zu sein, in der Bürokratie und kulturelle Unterschiede aufeinandertreffen? Diese Studie, entstanden aus einem studentischen Projekt an der Hochschule Zittau/Görlitz, wirft ein Schlaglicht auf die Lebensrealitäten von Ausländern in Görlitz und deren Interaktionen mit lokalen Behörden. Im Fokus stehen die persönlichen Erfahrungen, Herausforderungen und Integrationsbestrebungen von Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, die in dieser Grenzstadt eine neue Heimat suchen. Das Projektteam, bestehend aus Studierenden der Sozial- und Heilpädagogik, beleuchtet in vier thematischen Schwerpunkten die Perspektiven von Ausländern, deutschen Bürgern, Behördenvertretern und Asylbewerbern. Durchgeführt wurden hierfür zahlreiche Interviews und Befragungen, deren Ergebnisse ein differenziertes Bild der vorherrschenden Lebensqualität, Kommunikationsstrukturen und des Integrationsklimas zeichnen. Die Studie analysiert unter anderem, wie sich der Umgang mit Behörden gestaltet, welche Rolle Sprachbarrieren spielen und inwieweit Ausländerfeindlichkeit den Alltag beeinflusst. Dabei werden nicht nur Probleme und Missstände offengelegt, sondern auch konkrete Lösungsansätze und Verbesserungsvorschläge entwickelt, um die Integration zu fördern und das Zusammenleben in Görlitz zu verbessern. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind nicht nur für Görlitz relevant, sondern bieten auch wertvolle Einblicke und Impulse für andere Städte und Gemeinden in Deutschland, die sich mit den Herausforderungen der Integration auseinandersetzen müssen. Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammengeführt und ein Fazit gezogen, das die wichtigsten Aspekte des Studiums noch einmal auf den Punkt bringt. Diese sozialwissenschaftliche Analyse ist ein Muss für alle, die sich für Migrationsforschung, Integrationspolitik und die Lebenswirklichkeit von Ausländern in Deutschland interessieren, und bietet eine fundierte Grundlage für eine konstruktive und lösungsorientierte Auseinandersetzung mit diesem wichtigen Thema. Entdecken Sie die verborgenen Geschichten und Perspektiven, die dieses Buch offenbart, und tauchen Sie ein in die komplexe Welt der Integration in einer deutschen Stadt. Erfahren Sie mehr über die Schwierigkeiten im Umgang mit deutschen Behörden, die Rolle von Sprachbarrieren und kulturellen Unterschieden und die Auswirkungen von Ausländerfeindlichkeit. Eine tiefgreifende Analyse, die zum Nachdenken anregt und neue Perspektiven eröffnet.
Index
1 - Vorwort zum besseren Verständnis unseres Anliegens
2 - Teilbericht der Projektgruppe „Befragung von Ausländern“
3 - Teilbericht der Projektgruppe „Befragung von Deutschen“
4 - Teilbericht der Projektgruppe „Befragung von Behörden“
5 - Teilbericht der Projektgruppe „Befragung von Asylbewerbern“
6 - Gesamtbetrachtung und Fazit des Projektstudiums
1 - Vorwort zum besseren Verständnis unseres Anliegens
Im 4. und 5. Semester wird im Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Zittau/Görlitz (FH) ein sogenanntes Projektstudium durchgeführt, in dem sich die StudentInnen konkret an einem der angebotenen Praxisbeispiele erproben können. In unserem Fall haben wir das Thema
„Ausländer und Behörden in der Europastadt Görlitz“ gewählt. Ziel dieses Projektstudiums sollte es sein, die Lebensqualität von Ausländern in Görlitz und die „Beziehungen“ zwischen Görlitzer Behörden und hier lebenden Ausländern zu untersuchen, Probleme aufzudecken und Lösungsansätze zu suchen. Wir sehen Görlitz dabei aber nur als ein Beispiel an und denken, dass man unsere Studie auf viele andere Städte Deutschlands beziehen und über Veränderungen nachdenken kann. Für die Studie haben wir - 18 StudentInnen der Sozial- bzw. der Heilpädagogik unter Betreuung des Professors Dr. Rolf Wirsing - uns in vier Untergruppen aufgeteilt:
1) Projektgruppe „Befragung von Ausländern“: Diese Gruppe hat eine Befragung mehrerer in Görlitz lebender ausländischer Mitbürger vorgenommen, um Näheres über ihre Situation, ihre Befindlichkeiten und ihre Sorgen speziell in dieser Stadt in Erfahrung bringen zu können und dies als Hintergrundwissen in den Bericht mit einfließen zu lassen. Natürlich spielte dabei die Befragung nach Umgang mit Behörden eine wichtige Rolle.
2) Projektgruppe „Befragung von Deutschen“: Diese Gruppe hat Görlitzer deutscher Staats- bürgerschaft nach ihren Kontakten, Erfahrungen und Meinungen über in Görlitz lebende Ausländer befragt. Dies sollte ebenfalls als wichtiges Hintergrundwissen zum besseren Verständnis der allgemeinen Situation in Görlitz dienen.
3) Projektgruppe „Befragung von Behörden“: Diese Gruppe hat versucht, sämtliche kommunale Behörden sowie aufgrund der Grenzlage auch Bundesbehörden zu befragen. Gegenstand war dabei der behördliche Umgang mit Ausländern.
4) Projektgruppe „Befragung von Asylbewerbern“: Diese Gruppe hat im nahegelegenen Löbau in zwei Heimen Asylbewerber nach ihren Befindlichkeiten und ihren Sorgen befragt. Wichtig war auch hier der Behördenkontakt und die Art, wie er sich gestaltet.
Jede der vier Gruppen hat am Ende des Projektstudiums im Februar 2001 einen Abschlußbericht vorgelegt. Im Gesamtbericht soll nun versucht werden, diese zu einer Einheit zusammenzufassen.
Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass die Befragung der Asylbewerber nicht unbedingt als Teil des Projektes „Ausländer und Behörden in Görlitz“ zu sehen ist. Grund hierfür ist der Fakt, dass sich in Görlitz kein Asylbewerberheim befindet, weshalb dieser Teil des Projektes nach Löbau verlegt wurde. Dieser Teilbericht dient als wichtiger Zusatz, wenn es um Integration von Ausländern in unserem Land geht. Waren wir uns doch bewußt, dass Flüchtlinge in Deutschland im Allgemeinverständnis eine ausgegrenzte Personengruppe sind, unter Ausländern sogar „die unterste Stufe einnehmen“. Trotz dieser Differenzierung haben sie jedoch sehr viel Behördenkontakt. Gerade hier liegen aufgrund von Unwissenheit über hiesige behördliche Vorgehensweisen und aufgrund von großen Sprachschwierigkeiten zahlreiche Probleme. Aus dieser Einsicht heraus kam es zur Bildung einer Projektgruppe, um eine Befragung von Asylbewerbern außerhalb von Görlitz vorzunehmen.
Außerdem bitten wir um Verständnis, dass die Berichte zwar in ein einheitliches Format gebracht wurden, wir aber die einzelnen Teilberichte, was ihre Form wissenschaftlicher Auswertung betrifft, in ihrer Ursprungsform belassen wollen. Wichtig sind letzten Endes die Erkenntnisse. Kürzungen wurden kaum vorgenommen, da viele Details unvermeidbar sind, um sich ein Gesamtbild machen zu können. Auch hier bitten wir um Ihr Verständnis.
Am Ende eines jeden Teilberichts gibt es einen Unterpunkt „Fazit“, in dem die wichtigsten Erkenntnisse, Problemlagen und Lösungsansätze noch einmal auf den Punkt gebracht werden.
2 – Teilbericht der Projektgruppe „Befragung von Ausländern“
Mitglieder der Projektgruppe „Befragung von Ausländern“ waren:
- S. Schmidt
- R. Köhnlein
- M. Oefler
- B. Elsner
2.1. Forschungsmethode
Die Befragung fand mit Hilfe eines Fragebogens statt. Dem Fragebogen ging das Verteilen eines Handzettels mit einer Vorankündigung unseres Vorhabens voraus. Zentrale Punkte der Befragung waren die Erforschung der Zielgruppe im Hinblick auf ihre Lebensqualität und Kommunikationsstrukturen mit Behörden und Deutschen.
Hierfür dienten Fragen:
- zur Person (z.B. Geschlecht, Alter, Nationalität)
- zu Familie und näherem Umfeld (z.B. Kinder, Haushaltsgröße, Familienstand)
- zum Rechtsstatus des Aufenthalts in der BRD
- zum Lebensumfeld (z.B. kulturelle Aspekte, wie Religion, Arbeit, Wohnsituation, Freizeitverhalten)
- zu Erfahrungen im Umgang mit Deutschen (z.B. Ausländerfeindlichkeit, Kontakt zu Deutschen)
- zum Kommunikationsverhalten mit Behörden (z.B. Probleme, Erfahrungen)
- zum allgemeinen Lebensgefühl in Görlitz
Der Fragebogen wurde von unserer Teilprojektgruppe in Eigenarbeit erstellt. 2.2. Zugang zum Feld
Durch verschiedene Multiplikatoren erhielten wir Zugang zum Feld und Kontakt zur
Zielgruppe. Im folgenden sollen die wichtigsten aufgeführt werden:
- Die Ausländerbeauftragte der Stadt Görlitz, Frau Köhler, die das Projekt unterstützt und begleitet hat
- Tipps und Ratschläge von Prof. Dr. Wirsing, der das Projekt leitete
- Mitstudenten, deren Bekannte wir befragten
- ausländische Mitstudenten
- Eigeninitiative auf von der Zielgruppe stark frequentierten Orten wie dem Wochenmarkt oder ausländischen Restaurants
2.3. Durchführung der Befragung
Zur Durchführung der Befragung haben wir meistens in Zweier-Teams gearbeitet, selten wurde eine Befragung allein durchgeführt. Eine Befragung fand generell in der unmittelbaren Umgebung der Befragten statt, wie beispielsweise Zuhause oder am Arbeitsplatz. Die Befragung einer einzelnen Person dauerte ca. eine Stunde, wobei sich die Dauer bei einzelnen Fällen stark verlängerte, weil die Befragten oftmals mehr zur Thematik zu sagen hatten, als diese quantitative Forschungsmethode zugelassen hätte. Auch Sprachbarrieren trugen zu einer längeren Befragungsdauer bei, vor allem bei ost-asiatischen Personen war dies der Fall. Jedoch ist festzustellen, dass sich die Meisten gern zu einer Befragung bereit erklärten, nachdem wir unser Anliegen vorgebracht hatten.
Folgende Prinzipien wurden von uns bei der Befragung beachtet:
- Freiwilligkeit - eine freiwillige Einwilligung in die Befragung war wichtig für eine ehrliche Beantwortung unserer Fragen
- Schweigepflicht - die Identität behandelten wir vertraulich, die beantworteten Fragebögen wurden anonymisiert und nach der Auswertung vernichtet
- Offenheit - wir gingen davon aus, dass die Befragten unsere Fragen ehrlich und aus bestem Wissen und Gewissen heraus beantworteten. Dies setzte ebenso eine Offenheit von unserer Seite her voraus, indem wir Anliegen und Zweck der Befragung offenbarten.
Im Anhang befinden sich hierzu vertikale Beziehungen in der Berechnung. Dies bedeutet den Vergleich von einzelnen Fragen mit anderen, wie zum Beispiel die Altersstruktur gemessen an den Deutschkenntnissen der Befragten. Auf diese Weise können Zusammenhänge erkannt werden.
2.4. Ergebnisse
Die Ermittlung der Ergebnisse der Befragung führten wir mit Hilfe einer Tabellenkalkulation einer Datenmatrix durch. Hierfür erstellten wir eine Datenmaske und fügten die Antworten ein, um mittels Mengenberechnungen Aussagen treffen zu können.
Allgemeines
Von den 25 befragten Personen waren 56% männlich und 44 % weiblich (Diagramme sind im Anhang aufgeführt.). Das Durchschnittsalter betrug 35 Jahre. Der Anteil der 14-21jährigen lag bei 12%, die meisten Personen (72%) waren zwischen 22 und 39 Jahr alt. Der Anteil der über 40jährigen lag bei 16%. Wir befragten die Zielgruppe nach ihrer Herkunft, wobei die aus der Türkei, Polen und Bulgarien Stammenden mit jeweils 16% die stärksten Gruppen bildeten. Weitere Heimatländer waren Frankreich (8%), Kurdistan (12%), Pakistan (4%), Russland (4%), Tschechien (4%) und Vietnam (12%), Dänemark (4%) und Großbritannien (4%). Die Muttersprache unterscheidet sich teilweise von der Nationalität, daher ist extra eine Frage dahingehend konzipiert worden. Folgende Muttersprachen kamen vor: bulgarisch, türkisch (22,2%), kurdisch, polnisch, vietnamesisch (jeweils 16,7%), französisch (11,1%), deutsch, pakistanisch, russisch, tschechisch, dänisch und englisch (jeweils 5,6%).
Es ergab sich ein breites Spektrum an Nationalitäten: An erster Stelle stand die Türkei (24%), gefolgt von Deutschland (16%), Polen (12%), Frankreich, Vietnam (jeweils 8%), Kurdistan, Russland, Tschechien, Dänemark und England (jeweils 4%). Keine Angabe machten 12% der Befragten.
Bei der Religionszugehörigkeit waren 61,9% konfessionslos, 23,8% islamisch, 19% evangelisch und 14,3 % katholisch.
Nach dem Familienstand befragt, gaben 36% der Befragten ledig an, 52% verheiratet und 12% verwitwet. Keine Kinder hatten 52% der Befragten, 24% hatten ein Kind, 8% zwei Kinder und 16% hatten drei oder mehrere Kinder. Keine der befragten Personen lebt allein in einem Haushalt. 32% leben zu zweit, 28% zu dritt, 36% leben mit vier oder mehreren Personen zusammen. Nur ein Befragter gab keine Auskunft auf diese Frage. Hinsichtlich des sozialen Kontextes haben 88% der Befragten Verwandte oder Freunde, die in ihrem Umfeld leben, nur 12% haben diese Frage verneint.
Von den Befragten besitzen 24% eine befristete Aufenthaltserlaubnis in der BRD, 60% haben eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, 12% haben eine Aufenthaltsberechtigung und eine Gestattung haben 6,4% der Befragten. Duldung und Aufenthaltsbefugnis kam bei der Zielgruppe nicht vor.
Wichtig für uns waren die Gründe für das Verlassen des Heimatlandes. 20% verließen wegen ihrer Arbeitslage ihr Heimatland, 16% verließen ihre Heimat wegen des (Ehe-)Partners, 8% aus familiären Gründen, 16% wegen politischer Flucht, 20% aufgrund des Studiums und 12% waren wirtschaftliche Flüchtlinge. Keine Angaben machten 8% der Interviewten. Gründe in die BRD zu kommen waren: Arbeit (12%), Ehe (8%), Familie (20%), politische Flucht (12%), Studium (24%), wirtschaftliche Flucht (4%). Sonstige Gründe gaben 16% der Befragten an. Keine Angaben machten 4%.
Folgende Ziele und Hoffnungen hatten die Befragten bei ihrer Ankunft in der BRD: Arbeit finden (4%), um eine Familie zu gründen (16%), Grundrechte/Lebensqualität (32%), besseres Leben führen (8%), höhere Entlohnung (4%) und Studium (20%). Keine Angaben machten 12%.
Bei 40% der Interviewten haben sich die Hoffnungen/Ziele erfüllt, bei ebenfalls 40% haben sich die Ziele einigermaßen erfüllt und bei 20% haben sie sich nicht erfüllt. Mehr als die Hälfte (52%) der Befragten kann sich vorstellen unbegrenzt in der BRD zu bleiben und 48% können sich nicht vorstellen, für immer hier zu bleiben.
Der allergrößte Teil der Befragten hat umfangreiche Deutschkenntnisse (88%), wenig Deutschkenntnisse haben 12%. Bemerkenswert ist, daß keiner ohne Deutschkenntnisse in die BRD kam. Allerdings konnten wir Personen, die der deutschen Sprache nicht mächtig waren auch nicht interviewen.
Von den Befragten würden 52% einen Sprachkurs besuchen, um ihre Deutschkenntnisse zu erweitern. Drei Personen machten hierzu keine Angaben.
Lebensumfeld
Mehr als die Hälfte (52%) empfinden die deutsche Kultur als angenehm, 44% akzeptabel, 4% unangenehm. Die Fragen zu den Möglichkeiten der Entfaltung der eigenen Kultur staffelten wir:
Die Essgewohnheiten befanden 24% als sehr gut, 52% als ausreichend, 12% als mangelhaft. Mit ihrer Freizeitgestaltung sind 20% sehr zufrieden, 60% befinden sie als ausreichend und 12% als mangelhaft. Die kulturellen Angebote finden 20% ausreichend, 48% befinden sie als mangelhaft. Die Medien befinden 12% als sehr gut, 52% als ausreichend und 24% als mangelhaft.
Von den Befragten fühlen sich 32% im Ausleben ihrer eigenen Kultur von der deutschen Bevölkerung akzeptiert, 40% fühlen sich einigermaßen akzeptiert und 16% fühlen sich nicht akzeptiert. 8% machten zu dieser Fragen keine Angaben.
Für einen geringen Teil der Befragten ist die Ausübung der Religion wichtig (16%) oder nicht so wichtig (16%). Bei fast zwei Drittel der Befragten spielt die Ausübung der Religion keine Rolle. Von jenen, die sich einer Religionsgemeinschaft zugehörig fühlen, ist es 39% möglich, ihre Religion auszuüben.
Bei der Frage nach der Wohnlage innerhalb von Görlitz ergab die Umfrage folgende Ergebnisse:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Alle der Befragten finden ihre Wohnsituation positiv, 20% befinden diese als sehr gut, 56% als gut und 24% als befriedigend. In der näheren Betrachtung ihrer Wohnsituation haben 64% ausreichend Platz zur Verfügung, 36% haben zu wenig Platz. Eine ruhige Wohnlage haben 64%, 36% verneinten dies. 68% befinden ihre Wohnlage als sicher, 32% als unsicher. 52% leben in einer angenehmen Wohnatmosphäre, 48% nicht.
60% der Befragten gehen einer bezahlten Arbeit im Sinne einer Vollbeschäftigung nach, 8% sind teilbeschäftigt und 28% haben keine Arbeit. Keine Angaben machte eine Person.
Von den beschäftigten Personen arbeiten in folgenden Berufen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Lediglich 20% der Interviewten ist es möglich, ihren erlernten Beruf auszuüben, 60% üben einen anderen Beruf aus und 20% machten dazu keine Angaben. Vier der Befragten (16%) fühlen sich beim Zugang zu Arbeitsplätzen gegenüber Deutschen benachteiligt, 72% fühlen sich nicht benachteiligt und 12% machten keine Angaben dazu. Auf ihrer Arbeitsstelle fühlen sich 36% der Befragten sehr wohl, genau so viele fühlen sich einigermaßen wohl, 28% machten keine Angaben.
Die Befragten nannten im folgenden Aktivitäten, die sie in ihrer Freizeit gerne tun:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Erfahrungen im Umgang/Zusammenleben mit Deutschen
Durch Ausländerfeindlichkeit fühlen sich 8% der Befragten bedroht, 80% der Befragten fühlen sich nicht bedroht, wissen aber dass Ausländerfeindlichkeit existiert und 12% fühlen sich dadurch nicht bedroht. Einer großen Anzahl der Befragten fällt es schwer, Kontakt zu Deutschen aufzunehmen, lediglich 16% finden leicht Kontakt. Was die Befragten zu ihrer Kommunikation mit Deutschen antworteten, wird in folgender Tabelle deutlich:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im Großen und Ganzen fällt das Ergebnis für die Deutschen gut aus. Lediglich bei der Frage, ob Wärme oder Kälte gespürt wird, geht die Tendenz in Richtung Kälte.
Im Folgenden zeigt sich, wann und wo Kontakt zu Deutschen stattfindet und wie stark er ist:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Von Deutschen wurden ca. 61% der Befragten schon einmal verbal bedroht, 21% wurden schon mal von Deutschen körperlich bedroht und knapp 9% wurden sogar von Deutschen körperlich angegriffen.
Erfahrungen im Umgang mit Behörden
Die Befragten nannten ein breites Spektrum beim Kontakt mit unterschiedlichen Behörden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Mit der Bearbeitung ihrer Angelegenheiten bei den Behörden sind 28% immer zufrieden, 28% häufig zufrieden, 16% manchmal zufrieden und selten zufrieden sind 12%, 4% sind nie zufrieden. 12% haben keine Angaben gemacht.
2.5. Vergleichende Auswertung
Im Folgenden möchten wir einen vertikalen Vergleich der Antworten durchführen, um dadurch signifikante Aussagen zu Gemeinsamkeiten bzw. Unterschieden innerhalb der Zielgruppe treffen zu können. Folgende Antwortpaare werden verglichen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Von den verglichenen Antworten erscheinen uns folgende als besonders bemerkenswert: Personen des mittleren Alters (22-39 Jahre) wurden zu einem Anteil von 66% (12 Personen) schon einmal von einem Deutschen verbal bedroht, und zwei Interviewte aus der Gruppe mittleren Alters wurden bereits körperlich angegriffen. Allerdings fühlt sich ein sehr geringer Teil der Befragten von Ausländerfeindlichkeit bedroht (8%), beide positiven Antworten stammen von Personen, die aus der Türkei kommen. Kontakt zu Deutschen haben die Befragten jüngeren Alters (14-21 Jahre) zu 100% in der Schule und überhaupt nicht innerhalb der Familie. Die Personen mittleren Alters haben im Beruf intensiven Kontakt (61%) und zwölf der Befragten haben im Freundeskreis intensiven Kontakt (67%). Fast allen Befragten fällt es leicht, Kontakt zu Deutschen aufzunehmen, nur zwei Personen (9%) mit guten Deutschkenntnissen fällt es schwer. Von jenen mit guten Deutschkenntnissen fühlen sich 13 Interviewte voll von Deutschen akzeptiert (59%). 15 Befragte (68%) empfinden, dass Deutsche mit ihnen geduldig bis sehr geduldig umgehen.
Rechtlicher Status und Kontakt zu relevanten Behörden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nahezu alle der Befragten hatten und/oder haben Kontakt zur Ausländerbehörde und ein großer Teil der Befragten hatte/hat Kontakt zum Einwohnermeldeamt. Vollkommene Zu- friedenheit mit der Bearbeitung ihrer Anliegen bei den Behörden herrscht nur bei etwa der Hälfte (47,66%) derer, die eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung haben.
2.6. Auswertung der schriftlichen Antworten
- Beschriebene Probleme mit Behörden
- Lösungsvorschläge dieser Probleme
- Vorschläge zur Verbesserung in der Verwaltung
- Allgemeines Lebensgefühl in Görlitz
In der Kategorie "Behörden" wurden die Befragten zunächst dazu aufgefordert, den Begriff "Behörde" für sich zu definieren. In der Regel antworteten die befragten Personen stich- wortartig. Wir möchten an dieser Stelle einige der Definitionen anführen:
- lange Wartezeiten, unkorrekte Erklärungen, nicht sachlich
- König und Bettler
- Ordnung muss sein
- oft nicht kooperativ
- nötig, dass alles läuft, Papierkram
- Hasse die Behörde!
- Rathaus, viel Papier, Menschen müssen dort ihre Arbeit tun, Hilfe für Bürger
- in manchen Fällen bürokratisch
- keine Probleme mit Behörden, ich wurde immer gut beraten
Die meisten der befragten Personen machten deutlich, dass sie mit einer Behörde eher Negatives in Verbindung bringen. Wir wollten daraufhin von ihnen wissen, welche konkreten Probleme sie im Umgang mit deutschen Behörden hatten. Am häufigsten traten Probleme mit der Ausländerbehörde bzw. deren Mitarbeitern auf. Die ausländischen Bürger fühlten sich zum Teil unangemessen behandelt (z.B. meint ein Befragter, dass er wegen seines Akzentes für „doof“ gehalten wurde), zudem ist für die Befragten die Behördensprache unverständlich, und sie fühlen sich im Gespräch nicht ausreichend unterstützt. Ein Befragter befand ausschließlich die Görlitzer Ausländerbehörde für unfreundlich. Ein weiteres Problem sahen die Befragten darin, dass sie sich nicht umfassend über die Inhalte und Modalitäten der Gesetze und Bestimmungen informiert fühlen. Andere kritisieren die, ihrem Anschein nach, fehlende Kompetenz der Mitarbeiter und deren arrogante unfreundliche Art (z.B. musste eine Befragte schon einen Anwalt einschalten, weil ihr ein Mitarbeiter die unbefristete Aufenthaltserlaubnis kündigen wollte). Ein vorerst letzter hier zu nennender Kritikpunkt ist, dass die Bearbeitung der Anträge zu lange dauern würde.
Bei der Bitte um Beschreibung des größten Problems, dass im Umgang mit Behörden aufgetaucht ist, kamen u. a. folgende Angaben zustande:
- Nach der Abschiebung 1992 tauchte für einen Befragten der ungerechtfertigte Vorwurf eines unrechtmäßigen Aufenthaltes im Jahre 1995 auf. Daraufhin schlug ein Mitarbeiter der Ausländerbehörde vor, den Aufenthalt doch zuzugeben, da er sowieso verjährt sei.
- Eine Befragte konnte erst vor Gericht den Status ihres Kindes klären, welches dann die doppelte Staatsbürgerschaft erhielt.
Zuletzt baten wir um eine kurze Aussage zu ihrem Lebensgefühl in Görlitz. Folgendes wurde
u.a. dazu gesagt:
- Man sollte mehr Druck auf die Stadtpolitiker ausüben, damit sie sich L A U T und D E U T L I C H gegen Rechtsextremismus äußern.
- Es ist okay solange man zehnjährigen "Rechten" aus dem Weg geht.
- Ich fühle mich beobachtet, sobald ich den Mund aufmache.
- Man fühlt sich verloren, weil man schwer mitkriegt, wo und wann was abläuft.
- Die Stadt gefällt mir.
- Die Heimatstadt meiner Frau gefällt mir gut und mit den „Tücken“ des Alltags (auch als Ausländer) denke ich fertig zu werden
Die letzte Aussage trägt der durchschnittlichen Stimmung ganz gut Rechnung. Die meisten der Befragten fühlen sich in der Stadt Görlitz wohl und sehen sich in der Lage, die auftretenden Probleme zu meistern. In der Befragung um Angelegenheiten der Behörden tauchte die meiste Kritik auf, wobei der häufigste Verbesserungsvorschlag die Einstellung von mehr Personal und fähigeren Mitarbeitern war.
2.7. Fazit
In der Befragung nach der Lebensqualität für Ausländer in der Europastadt Görlitz schob sich „das Problem Behörde“ als wichtiges Thema in den Vordergrund. Zahlreiche Menschen scheint dieses Thema stark zu bewegen und sie können viel, vor allem Negatives, dazu erzählen. Am schlechtesten von allen Behörden schnitt in der Befragung ausländischer Bürger in Görlitz die Ausländerbehörde ab. In der Konfrontation mit deren Mitarbeitern treten die meisten Probleme auf, als da genannt werden: Inkompetenz, ungerechte und unfreundliche Behandlung, Probleme mit der deutschen Sprache und infolge dessen Missverständnisse und frustrierende Erfahrungen. Sicher ist deutsch die Amtssprache, aber fremdsprachliche Kenntnisse in einer Ausländerbehörde(!) sollten selbstverständlich sein. Ein weiteres Problem sahen die Befragten darin, dass sie sich nicht umfassend über die Inhalte und Modalitäten der Gesetze und Bestimmungen informiert fühlen. Dies ist ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt. Unwissenheit bringt viele Probleme mit sich und schürt Unsicherheit.
Als Lösung könnten Handzettel oder kleine Broschüren dienen, die in mehreren Sprachen in den Behörden ausliegen.
Lange Bearbeitungszeiten sind ein weiterer Kritikpunkt, dieser gilt aber unserer Meinung nach überall und kann nicht explizit für Behörden gelten, mit denen Ausländer zu tun haben.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Projektstudiums "Ausländer und Behörden in der Europastadt Görlitz"?
Das Ziel des Projektstudiums war es, die Lebensqualität von Ausländern in Görlitz und die Beziehungen zwischen Görlitzer Behörden und hier lebenden Ausländern zu untersuchen, Probleme aufzudecken und Lösungsansätze zu suchen. Die Studie soll auch auf andere Städte Deutschlands übertragbar sein.
Wie war das Projekt organisiert?
18 StudentInnen der Sozial- bzw. Heilpädagogik teilten sich in vier Untergruppen auf:
- Befragung von Ausländern
- Befragung von Deutschen
- Befragung von Behörden
- Befragung von Asylbewerbern
Warum wurde auch eine Gruppe Asylbewerber befragt, obwohl es in Görlitz kein Asylbewerberheim gibt?
Die Befragung der Asylbewerber in Löbau wurde als wichtiger Zusatz betrachtet, um die Integration von Ausländern in Deutschland umfassender zu betrachten, da Flüchtlinge oft eine ausgegrenzte Personengruppe darstellen und dennoch viel Behördenkontakt haben. Die daraus resultierenden Probleme aufgrund von Unwissenheit und Sprachschwierigkeiten sollten analysiert werden.
Welche Forschungsmethode wurde bei der Befragung von Ausländern verwendet?
Es wurde ein Fragebogen verwendet, um die Lebensqualität und Kommunikationsstrukturen mit Behörden und Deutschen zu erforschen. Der Fragebogen enthielt Fragen zur Person, Familie, Rechtsstatus, Lebensumfeld, Erfahrungen im Umgang mit Deutschen und Behörden sowie zum allgemeinen Lebensgefühl in Görlitz.
Welche Ergebnisse kamen bei der Befragung der Ausländer in Bezug auf ihre Herkunft heraus?
Die stärksten Gruppen stammten aus der Türkei, Polen und Bulgarien. Weitere Heimatländer waren Frankreich, Kurdistan, Pakistan, Russland, Tschechien, Vietnam, Dänemark und Großbritannien.
Welche Religionen wurden von den Befragten angegeben?
Die meisten Befragten waren konfessionslos, gefolgt von islamisch, evangelisch und katholisch.
Welchen Aufenthaltsstatus hatten die Befragten?
Die meisten Befragten hatten eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, gefolgt von einer befristeten Aufenthaltserlaubnis und einer Aufenthaltsberechtigung. Einige hatten eine Gestattung.
Was waren die Hauptgründe für das Verlassen des Heimatlandes?
Die Gründe waren vielfältig und umfassten Arbeitslage, (Ehe-)Partner, familiäre Gründe, politische Flucht, Studium und wirtschaftliche Flucht.
Wie zufrieden sind die Befragten mit den Möglichkeiten der Entfaltung ihrer eigenen Kultur?
Die Essgewohnheiten wurden überwiegend als ausreichend empfunden. Mit der Freizeitgestaltung und den kulturellen Angeboten waren viele weniger zufrieden. Die Medien wurden überwiegend als ausreichend befunden.
Wie fühlen sich die Befragten im Umgang mit Deutschen?
Einige Befragte fühlen sich durch Ausländerfeindlichkeit bedroht oder wissen, dass sie existiert. Viele finden es schwer, Kontakt zu Deutschen aufzunehmen. Es gab auch Berichte über verbale und körperliche Bedrohungen durch Deutsche.
Welche Behörden wurden am häufigsten von den Befragten kontaktiert?
Die Ausländerbehörde, das Einwohnermeldeamt und das Sozialamt wurden am häufigsten genannt.
Wie zufrieden sind die Befragten mit der Bearbeitung ihrer Anliegen bei den Behörden?
Ein großer Teil der Befragten ist mit der Bearbeitung ihrer Angelegenheiten zufrieden, aber es gab auch viele, die selten oder nie zufrieden waren.
Welche Probleme wurden im Umgang mit Behörden beschrieben?
Häufige Probleme waren lange Wartezeiten, unverständliche Sprache, fehlende Kompetenz der Mitarbeiter, unfreundliche Behandlung und lange Bearbeitungszeiten.
Welche Vorschläge wurden zur Verbesserung des Umgangs mit Behörden gemacht?
Vorschläge umfassten die Einstellung von mehr Personal, die Fortbildung der Mitarbeiter, Sprachkurse für Mitarbeiter der Ausländerbehörde und die Bereitstellung von Informationen in mehreren Sprachen.
Was war das Fazit der Befragung von Ausländern?
Das "Problem Behörde" rückte in den Vordergrund. Die Ausländerbehörde schnitt am schlechtesten ab. Es wurden Inkompetenz, ungerechte Behandlung und Sprachprobleme kritisiert. Als Lösungen wurden mehr Personal, Fortbildungen und mehrsprachige Informationen vorgeschlagen.
- Quote paper
- Henriette Hanig (Author), 2001, Ausländer und Behörden in der Europastadt Görlitz - Welche Kommunikationsbarrieren gibt es und wie können sie vermieden werden? (Projektbericht), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106792