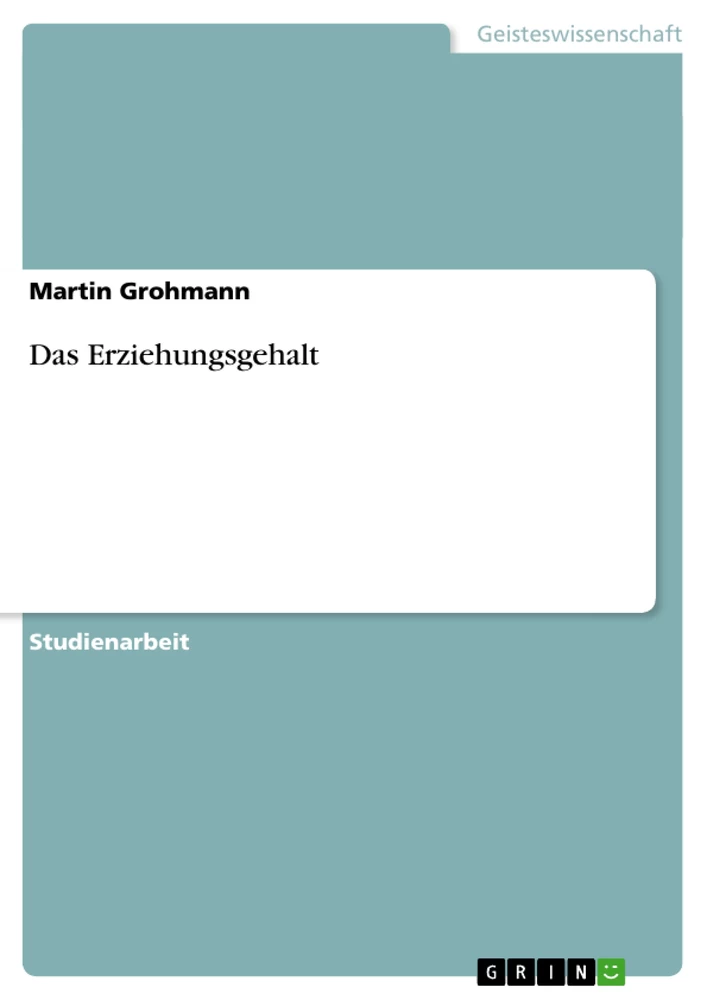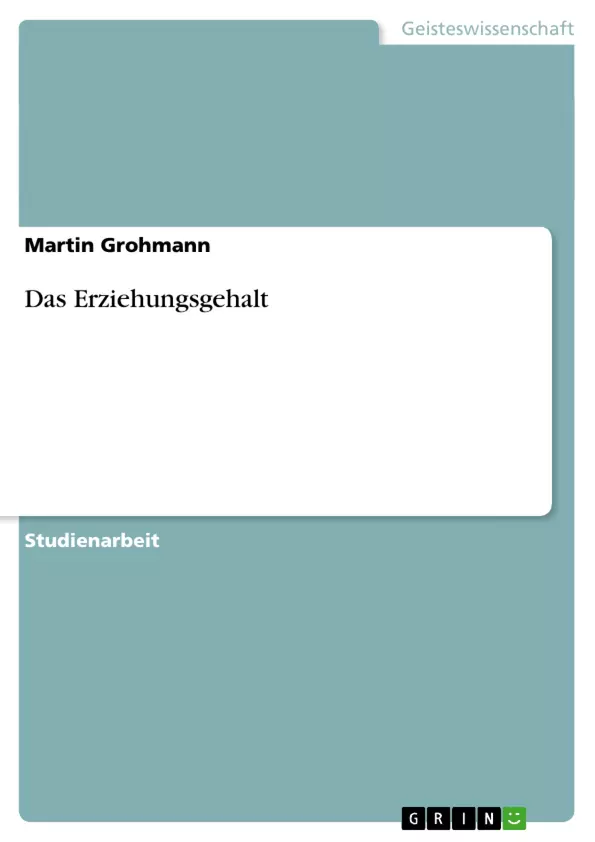Seit einigen Jahren ist das Erziehungsgehalt in der öffentlichen Diskussion. Politikwissenschaftler, Politiker, Parteien und Interessenverbände haben sich wiederholt zu verschiedenen Vorschlägen geäußert. Ich möchte untersuchen, warum die Forderungen nach einem Erziehungsgehalt laut wurden, wie es sich zum aktuellen Familienleistungsausgleich abgrenzt und wie das Erziehungsgehalt in der Öffentlichkeit von den verschiedenen Parteien und Interessenvertretungen beurteilt wird. Zur Finanzierung der verschiedenen Vorschläge äußere ich mich nur sehr kurz, da es sich immer nur um Prognosen handelt, die meist auch noch sehr wage sind.
Was will ein Erziehungsgehalt ?
Ein Recht auf ein Einkommen für Eltern, die Kinder im Vorschulalter verantwortungsvoll erziehen, zu schaffen und ihre Erziehungsarbeit damit gesellschaftlich anzuerkennen, ist der Hauptgedanke des Erziehungsgehaltes. Dieser Gedanke widerspricht unserem derzeitigen Familienleistungsausgleich, der zwar vom Namen her vorgibt familiäre Leistungen auszugleichen, in Wirklichkeit aber nicht viel mehr will als das Existenzminimum von Kindern steuerfrei zu halten. Die wichtigste Kernfrage in Zusammenhang damit, ob ein Erziehungsgehalt gezahlt werden muss, ist meiner Meinung nach: Wer ist für die Erziehung von Kindern (finanziell) verantwortlich ? Im Grundgesetz Art.6 (2) heißt es: “Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht ” Diese hier formulierte Pflicht wird auch durch Rechte der Eltern auf Hilfe zur Erziehung nach dem KJHG (SGB VIII) nicht außer Kraft gesetzt. Im Gesetz ist also ganz klar, dass die Eltern kein Recht auf Finanzierung ihrer Erziehungs- und Pflegearbeit gegenüber dem Staat haben. Zu Konflikten kommt es erst, wenn diese gesetzlichen Regelungen zu Ungerechtigkeiten führen. Wenn zum Beispiel nicht alle Bundesbürger Kinder erziehen und so die Kosten für der Erziehung der nachwachsenden Generation von der Eltern getragen werden müssen. Der Anspruch auf Unterhalt, der gegenüber den eigenen Kindern besteht, kann und sollte wohl nicht der einzige Ausgleich für den enormen finanziellen und zeitlichen Aufwand der Kindererziehung und Pflege sein. Betrachtet man das Aufziehen von Kindern als notwendige gesellschaftliche Leistung, was es zweifelsohne ist, stellt sich unweigerlich die Frage, warum diese Leistung von den Eltern finanziert werden soll und nicht von der Gesellschaft. Schließlich sind Kinder eine wesentliche Voraussetzung für den Generationenvertrag und somit für das Funktionieren sämtlicher unserer Sozialversicherungssysteme. Werte wie: “Kinder machen ihren Eltern große Freude” oder “Jeder hat das Bedürfnis in seinen Kindern weiter zu leben”, können Eltern wohl heutzutage kaum noch dazu bewegen Kinder zu bekommen und aufzuziehen. Die finanziellen Aufwendungen und die Einschränkungen in der eigenen Freiheit sind dazu einfach zu groß. In der Frage nach der Höhe der Pflegeversicherungsbeiträge für Eltern hat das Bundesverfassungsgericht bereits eine Entscheidung gefällt. Eltern erbringen eine doppelte Leistung, durch Beitragszahlung und das Aufziehung neuer Beitragszahler. Hier besteht Ungerechtigkeit. Meiner Meinung nach besteht dies Ungerechtigkeit nicht nur bei der Pflegeversicherung, sondern auch bei den anderen Sozialversicherungen und in unserer Gesellschaft allgemein. Auch wenn die kostenlose Mitversicherung von Kindern in der GKV, das Kindergeld, die Anrechnung von Betreuungszeiten bei der Rente und das Ehegattensplitting als Anerkennung familiären Mehrbedarfs gedeutet werden können, so beschränkten sich die Staatlichen Nettotransfers (ohne Krankenversicherung) laut 5.Familienbericht auf 10% der entstehenden Betreuungs- und Versorgungskosten für Kinder, der Rest (90%) verbleibt den Eltern. Das aufziehen von Kindern alleine durch private Unterhaltsstrukturen zu sichern, scheint heutzutage nicht mehr möglich. Durch ein Erziehungsgehalt würden die heute vom Staat nur allgemein durch Steuervorteile von Eltern und Verheirateten anerkannte Erziehungsleistung und Erwerbsarbeit gleich bewertet.(vgl. Opielka, M.(2000), 1)
Ziele des Erziehungsgehaltes
Neben der Anerkennung der Erziehungsarbeit der Eltern, gibt es noch zahlreiche andere Ziele, die mit der Einführung eines Erziehungsgehaltes verwirklicht werden sollen. Die verschiedenen Modelle legen ihren Schwerpunkt immer auf einzelne dieser Ziele. Die im folgenden aufgezeigten Ziele sind nicht durch ein Erziehungsgehalt allein umzusetzen. Es kann jedoch einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass diese Gedanken in das gesellschaftliche Bewusstsein kommen. Bei den meisten Zielen ist das Erziehungsgehalt ein Anfang, aber nicht der Abschluss der Bemühungen auf diesem Gebiet.
Das Erziehungsgehalt soll zu einer Aufwertung der Erziehungsarbeit beitragen (vgl. Opielka, M.(2000), 5). Das Erziehen von Kindern wird in unserem Land als selbstverständlich gesehen, als eine Arbeit, die sehr niedrig im gesellschaftlichern Ansehen steht. “Das bisschen Haushalt macht sich von allein.”, sagt mein Mann. Diese alte Liedzeile beschreibt meiner Meinung nach auch für unser heutiges Deutschland, welchen Status Haushaltsführung und Kindererziehung haben. Opielka zitiert Analysen des Bundesamtes für Statistik, wonach 50 % der gesamten gesellschaftlichen Arbeit in den Haushalten verrichtet werden, vor allem für die Erziehung und Versorgung von Kindern. für diese Arbeit wird keine finanzielle Anerkennung gezahlt, außer sie wird in öffentlichen Einrichtungen geleistet. Hier würde ein Erziehungsgehalt mehr gesellschaftliche Anerkennung schaffen. Durch die neuen Regelungen über den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt, wird auch schon ein Signal in diese Richtung gesetzt. Ein weiteres Ziel ist die Ermöglichung von mehr Partnerschaft in der Elternschaft.
Der Erziehungsurlaub wurde 1996 nur zu 1,4% von Männern genommen. Das kann Ausdruck von familiärer Arbeitsteilung sein. Tatsächlich scheint aber die finanzielle Absicherung der Familie für diese Entscheidung im Vordergrund zu stehen. Die meisten Männer verdienen mehr als ihre Frauen, und können im Gegensatz zu ihren Partnerinnen vor, während und nach derer Geburt ohne Unterbrechung ihren Beruf ausüben. In diesem Fall könnte eine hohe finanzielle Zuwendung in Form eines Erziehungsgehaltes und eine rechtlich verankerte Wiedereinstiegssicherung, die Voraussetzungen für mehr Partnerschaft in der Elternschaft begründen. Vielleicht das wichtigste, jedoch auch am meisten kritisierte Ziel des Erziehungsgehaltes, ist den Frauen größere Chancen zu eröffnen. Es ist wichtig, dass nicht ein Lebensentwurfsmodell die politischen Bemühungen prägt, sondern dass die Chancen aller Frauen erweitert werden. Ersteres ist zum Beispiel bei der staatlichen Subventionierung von Kindertagesstätten der Fall. Ein Erziehungsgehalt muss zum einen die Möglichkeit bieten sich “nur” der Kindererziehung zu widmen, und trotzdem die staatlichen Zuwendungen zu bekommen, zum anderen muss der Wiedereinstieg in den Beruf gesichert werden. Zum letzteren hat die Bundesregierung schon einiges beigetragen. Der erste Punkt ist aber immer noch nicht politisch gesichert. Das Argument, Frauen würden durch das Erziehungsgehalt an Haus und Herd gebunden, ist dadurch zu entkräften, dass es erwerbszeit- und erwerbseinkommensunabhängig sein soll. So bekommen nicht nur Frauen das Erziehungsgehalt, die sich ausschließlich der Kinderbetreuung widmen.(vgl. Wingen, M.(2000),7) Die Arbeitswelt in Deutschland ist sehr stark von Männern geprägt. Der Arbeiter ist männlich. Durch das Erziehungsgehalt würden Eltern einen größeren Handlungsspielraum bekommen, auch ihren weiblichen Teil von ihnen am Erwerbsleben teilhaben zu lassen. Nicht zu vergessen ist die Tatsache, dass es bei mehr Investitionen in die Erziehung von Kindern um Investitionen in die Gesellschaft im allgemeinen geht. Der viel beredeten “Chancengleichheit” für alle Kinder könnte man mit einem Erziehungsgehalt ein gutes Stück näher kommen. Wenn sich Eltern ohne in existentielle Not zu kommen, ganz der Kinderbetreuung widmen könnten, wäre das eine großartige Investition in die nachwachsende Gesellschaft, die sich in jedem Fall “bezahlt macht”. Es gibt noch zahlreiche andere Ziele die bestimmte Parteien und Interessengemeinschaften mit dem Erziehungsgehalt verfolgen. Wenn auch keine direkten Ziele, aber wenigstens Folgen wären eine Intensivere Nachfrage nach Konsumgütern, durch die größere Kaufkraft bei den Familien, mehr Einnahmen bei den Sozialversicherungen und das Entstehen, von neuen Arbeitsplätzen im Bereich der Kinderbetreuung, durch größere Nachfrage in diesem Bereich. Die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen könnte sinken, da einige Eltern sich dafür entscheiden nicht mehr dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen, und sich ganz ihrer Kinder zu widmen. Auch eine rückläufige Zahl von Abreibungen und eine größere Bereitschaft von Paaren sich für Kinder zu entscheiden, wird wahrscheinlich eine Folge des Erziehungsgehaltes sein. Finanzielle Gründe dürften dann bei der Frage nach Kindern eigentlich keine Rolle mehr spielen.
Gedanken zur Ausgestaltung des Erziehungsgehaltes
Schwieriger als die Notwendigkeit eines Erziehungsgehaltes zu erkennen, ist die Frage nach der Ausgestaltung, dieser sozialen Leistung. Es ist sehr gut zu erkennen, dass die verschiedenen Modelle auf bestimmte Lebenskonzepte zielen. Die beabsichtigten Wirkungen des Erziehungsgehaltes werden von den Verfassern nicht alle explizit ausgeführt, lassen sich aber erahnen. Der Unterschied zwischen dem Modell der Deutschen Hausfrauengewerkschaft und dem der Ökologisch Demokratischen Partei ist eben den Interessen ihrer Mitglieder geschuldet. Ich möchte einige Modelle vergleichen. (vlg. Wingen M. 2000 S.3f ) Wie der Name „Erziehungsgehalt“ schon sagt, erheben die Modelle alle den Anspruch, den Familien einen wesentlich höheren Geldbetrag für das Erziehen ihrer Kindern zukommen zu lassen, als das derzeit durch den Familienleistungsausgleich geschieht. Wo liegen die Gemeinsamkeiten der einzelnen Konzepte. Das Erziehungsgehalt soll die Höhe eines durchschnittlichen sozialversicherungspflichtigen Einkommens erreichen. Viele Modelle wollen diesen Wert bei einer Familie mit drei Kindern erreichen, manche bei drei Kindern unter einem bestimmten Alter z.B. 16 Jahre. Weiterhin läst bereits die Bezeichnung Erziehungsgehalt darauf schließen, dass es sich um ein sozialversicherungspflichtiges Einkommen handelt. Tatsächlich ist das für die meisten Modelle richtig festzuhalten, wobei es in der Ausgestaltung Differenzen gibt, ob die Beiträge in die allgemeinen Versicherungen zu zahlen sind oder in ein eigenes System. Weitere wichtige Überlegungen betreffen die Einkommens- und Arbeitszeitunabhängigkeit. Es besteht ein recht großer Konsens darin, dass das Erziehungsgehalt unabhängig von der Arbeitszeit sein sollte. Das ist ein großer unterschied etwa zum derzeitigen Erziehungsgeld, bei dem eine Höchstarbeitszeit festgelegt ist. Diese Unabhängigkeit ist der persönlichen Freiheit der Eltern geschuldet, die nicht aufgrund des Geldes, sonder ihrer eigenen Entscheidung ihre Kinder selbst betreuen oder eine Kinderbetreuung finanzieren sollen, um die freie Zeit für eine Berufstätigkeit zu nutzen. Durch den Wegfall von Realtransfers, würde mit dem Erziehungsgehalt eine Verteuerung der Kinderbetreuung einhergehen, die jedoch von den Eltern zu finanzieren wäre, da ihnen dann mehr Geld zur Verfügung stehen würde. Bei sehr kleinen Kindern, stellt sich die Frage nach einer Betreuungseinrichtung für Eltern aber oft gar nicht. Die meisten Modelle wollen das Erziehungsgehalt auch einkommensunabhängig. Schon wieder besteht ein Unterschied zum derzeitigen Erziehungsgeld. Es gibt keine Einkommensgrenzen. Jeder der Kinder erzieht, erhält das Erziehungsgehalt. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um einen Konsens aller Modelle. Z.B. das Konzept “Erziehungsgehalt 2000” schlägt eine Einkommensabhängigkeit vor. Beginnend mit der Einkommensunabhängigkeit, möchte ich zwei Ausgestaltungsvorschläge aufzeigen, die meiner Meinung nach auf ein bestimmtes Lebenskonzept der Eltern abzielen. Eine Einkommensabhängigkeit schafft zum einen mehr Gerechtigkeit für die Wenigverdienenden, zum anderen kann es dazu führen, dass sich ein Elternteil ausschließlich für die Erziehungstätigkeit entscheidet oder Schwarzarbeit nachgeht, weil sonst die Leistung des Erziehungsgehaltes wegfallen würden. Eine Einkommensabhängigkeit kann also in eine bestimmte Richtung der Lebensführung drängen. Der zweite Ausgestaltungsvorschlag ist der Betreuungsgutschein. Er taucht in mehreren Modellen auf. Es geht darum ab einem bestimmten Kindesalter einen Teil das Erziehungsgehaltes in Form eines Betreuungsgutscheines auszuzahlen. Dieser kann für Kinderbetreuung eingesetzt werden. Es ist aber nicht möglich, ihn in Form von Bargeld zu erhalten, wenn man seine Kinder selbst betreut. So gilt für den Betreuungsgutschein das gleiche wie für die Einkommensabhängigkeit; er fördert ein bestimmtes Bild von Lebensführung, nämlich das der erwerbstätigen Mutter. Außerdem subventioniert er die Kinderbetreuungseinrichtungen. Ich finde es nicht gut, wenn ein Erziehungsgehalt neben dem Effekt der Gleichstellung von Familien- und Erwerbsarbeit eine bestimmte Form der Lebensführung fördern und eine andere benachteiligen würde. dann wäre das Problem der Ungerechtigkeit nur verlagert, nicht aber beseitigt. Das Erziehungsgehalt sollte Eltern mehr Freiheiten geben, sie aber nicht einengen. Nicht in allem läst sich aus den Einzelnen Modellen ein Konsens ausmachen. Sehr stark differieren die Meinungen über den Zahlungszeitraum und die Abstufungen in der Höhe der Leistung in Abhängigkeit vom Alter des Kindes. Bis drei Jahre, bis sechs Jahre, bis 16 Jahre, bis zum 18. Lebensjahr oder sogar bis zum Ende der Berufsausbildung soll gezahlt werden. Die meisten Modelle stufen jedoch die Höhe des Erziehungsgehaltes in irgendeiner Weise nach dem Kindesalter ein. Das Erziehungsgehalt wird weniger, je älter die Kinder werden. Manche Modelle erwähnen, dass das Erziehungsgehalt nicht nur den Eltern, sondern möglicher Weise auch einer anderen Person gezahlt werden kann, wenn sie sich um die Erziehung der Kinder kümmert. Das alleinerziehende ein höheres Erziehungsgehalt bekommen sollen als Paare, wird auch mehrmals vorgeschlagen. Eine Folge des Erziehungsgehaltes sehen mehrere Modelle darin, dass die Kosten von Kinderbetreuungsangeboten steigen werden, da die staatlichen Subventionen wegfallen.
Das Familiengeld der CDU/CSU
Ich möchte nun das Familiengeld-Konzept der CDU/CSU vorstellen. 2002 wird Familienpolitik erstmals zu einem wichtigen Thema im Wahlkampf. Mit dem Familiengeld- Konzept bringt die CDU/CSU ihren Beitrag in die Diskussion um die Familienförderung ein. (vgl. Repnik, H.-P. (2001), 25ff ) Das Familiengeld-Konzept der CDU/CSU steht für eine grundsätzliche Neuorientierung in der Familienpolitik. Es erhebt den Anspruch Gerechtigkeit für Erziehende herzustellen. Diese Gerechtigkeit für die Erziehenden soll dadurch hergestellt werden, dass die Leistungen der Familie für die Gesellschaft wirklich anerkannt werden, die finanzielle Benachteiligung der Familien abgebaut und die Förderung junger Familien deutlich verbessert wird. Das Familiengeld steht Familien mit dauerhaft in Deutschland lebenden Kindern zu. Es soll bis zum dritten Lebensjahr 600 € betragen, vom dritten bis zum 18. Lebensjahr 300 € und ab dem 18. Lebensjahr 150 €, das übersteigt die derzeitigen Kinderund Erziehungsgeldzahlungen deutlich.
Fünf wesentliche Veränderungen möchte die CDU/CSU mit dem Familiengeld in die Familienpolitik einführen. Im Gegensatz zu den bisherigen Regelungen wird das Familiengeld einheitlich sein. Es soll die Familienförderung wirkungsvoller, transparenter und durchschaubarer gestalten. Das Stichwort ist Chancengleichheit. Die bisherigen Regelungen, die besserverdienenden mehr finanzielle Anerkennung zukommen ließen, sollen abgeschafft werden. Alle Familien, die in Deutschland leben, sollen das Familiengeld in gleicher Höhe bekommen. Dieser Gerechtigkeitsgedanke, der Gleichheit und Gerechtigkeit gleichstellt, war bisher für die SPD charakteristischer als für die CDU/CSU. Es ist interessant zu sehen, dass Die Christdemokraten nun ihr eigenes Kindergeldsystem ersetzen wollen. Der zweite Gedanke des Familiengeld-Konzeptes ist die Gerechtigkeitslücke bei den mittleren Einkommen zu schließen. Da das Kindergeld steuerkompensierend wirkt, bekommen Familien mit geringem Einkommen, durch das Kindergeld mehr zurück als sie an Steuern bezahlt haben. Familien mit hohen Einkommen bekommen durch die Kinderfreibeträge zwar nur Steuern zurück, die sie vorher bezahlt haben, jedoch ist dieser Betrag höher als das Kindergeld, dass sie für ihre Kinder bekommen würden. Das Problem, das das Familiengeld lösen soll, liegt bei den mittleren Einkommen. Diese Gruppe von Familien, bekommen durch die Steuerrückerstattung, einen Betrag, der dem Kindergeld gleicht, obwohl es nur ihre bisher gezahlten Steuern sind, die sie zurückerhalten. Diese Gerechtigkeitslücke soll mit dem Familiengeld geschlossen werden. Weiterhin soll mit dem Familiengeld der Kinderarmut entgegengewirkt werden. Den rund eine Million Kindern, die derzeit von der Sozialhilfe leben, kommen damit größere finanzielle Gestaltungsspielräume zu. Familien mit Kindern, die derzeit von der Sozialhilfe leben, weil sie die Kosten für ihre Kinder nicht selbst aufbringen können, haben durch das Familiengeld einen wesentlich geringeren Bedarf an Hilfe zum Lebensunterhalt. Daraus ergibt sich, dass sich Arbeit für sie schon wieder lohnt, wenn ihr Einkommen die Höhe dieses geringeren Bedarfes übersteigt. Hier sehe ich ein Problem. Es liegt darin begründet, dass an dieser Stelle das Familiengeld den Kindern nicht direkt zu gute kommt. Es fließt hier in den Gesamtbedarf der Familien ein und sichert nur das Existenzminimum der Kinder. Diesen Anspruch hat aber auch das Kindergeld. So würde bei Familien, die Hilfe zum Lebensunterhalt bekommen, dass Familiengeld lediglich indirekt dadurch wirken, dass die Kommunen mehr Geld, das sie vorher für Sozialhilfe ausgeben mussten, in den Ausbau z.B. von Kindertagesstätten stecken könnten. Ob das Geld jedoch wirklich in solche Aufgaben fließt, ist höchst zweifelhaft. Ein sehr wichtiges Ziel des Familiengeldes ist es, eine echte Wahlfreiheit zwischen Familienarbeit und Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. Durch die neuen finanziellen Mittel, die Familien in die Hand bekommen, wird die Entscheidung für eine intensive Familienarbeit erleichtert. Auch wird die partnerschaftliche Teilung der Elternverantwortung unterstützt, da eine Unterbrechung der Erwerbstätigkeit nicht mehr mit unerträglichen finanziellen Risiken verbunden ist. Gestützt durch die Regelungen des Rechtes auf Teilzeitarbeit und des Wiedereintritts in die Erwerbstätigkeit, können so auch Väter sich in größerem Rahmen an der Kindererziehung beteiligen, ohne dass ihre Familie in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Das Familiengeld ist steuer- und sozialabgabenfrei. Es wird unabhängig von der Erwerbstätigkeit oder dem Einkommen der Eltern geleistet. Es soll an die Inflation und an sich verändernde Steuerregelungen angepasst werden, so dass sein realer Wert den Familien ständig erhalten bleibt. Das Familiengeld soll zur Verbesserung der Erziehungssituation von Kindern führen, und wird daher bei Trennung und Scheidung nicht auf den Ehegattenunterhalt angerechnet. Diesen Punkt widerspricht sich mit einer oben genannten Aussage, dass das Familiengeld bei der Berechnung zur Hilfe zum Lebensunterhalt mit herangezogen wird. So werden Kinder, deren Eltern das Geld zum Leben durch Erwerbsarbeit erwirtschaften, denen vorgezogen, deren Eltern auf Hilfe zum Lebensunterhalt angewiesen sind. Hier greift das Prinzip der Kurzen Decke nicht so wie es eigentlich gedacht ist, nämlich den Empfänger zur Erwerbsarbeit anzureizen, sondern es verhindert die Chancengleichheit der Kinder von Empfängern der Hilfe zum Lebensunterhalt, gegenüber den Kindern von Berufstätigen Eltern. So kommt das Familiengeld gerade den Kindern in den ärmsten Familien überhaupt nicht zu gute, was es aber vorgibt.
Neben dem Familiengeld sollen die Familien durch Entlastung bei den Sozialabgaben mehr finanzielle Gerechtigkeit erfahren. Das soll durch einen nach Kinderzahl gestaffelten Bundeszuschuss zu den Versicherungsbeiträgen erfolgen. Dadurch wäre die Beitragsäquivalenz nicht verletzt und dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes über die Doppelbelastung von Familien durch Beitragszahlung und Kindererziehung genüge getan. Erziehungszeiten sollen außerdem besser als bisher bei der Rentenversicherung angerechnet werden.
Zur Finanzierung des Familiengeldes werden drei Punkte genannt, die ebenso einfach wie kompliziert sind. Sie stellen die Patentrezepte dar, die gerne von allen Parteien angeführt werden: mehr Beschäftigung, mehr Wirtschaftswachstum und Einsparungen auf Landes- und Kommunalebene. Für mich ist dieses Finanzierungsmodell nicht sehr überzeugend. Auch die Rot- Grüne- Bundesregierung hatte vor, ihre Reformen darauf aufzubauen. Dieser Plan ging leider nicht auf. Ich würde mich freuen, wenn die Schaffung eines Familiengeldes nicht allein durch mögliche Steuermehreinnahmen zu finanzieren ist, sondern wenn es durch Umschichtungen und Einsparungen, die sich automatisch durch die Einführung des Familiengeldes ergeben, zu finanzieren wäre. Leider sind die Finanzierungsvorschläge der CDU/CSU sehr einfach und scheinbar wenig durchdacht, deshalb will ich sie hier nicht ausführlich darstellen. Das Familiengeld ist kein Erziehungsgehalt im eigentlichen Sinn. Es begründet keinen eigenen Rentenanspruch für den, der vollzeitlich seine Kinder erzieht. Es ist nicht steuerpflichtig, was man von einem Gehalt aber erwarten müsste. Es hat eher den Charakter eines hohen Kindergeldes, als den eines Einkommens für die geleistete Erziehungsarbeit. Doch es gibt auch Merkmale, die es einem Erziehungsgehalt nahe bringen. Zweifellos ist die Höhe dieser staatlichen Leistung nie zuvor denkbar gewesen. Man kann schon von einer Anerkennung der Erziehungsarbeit sprechen. Auch das Durchschnittseinkommen bei drei kleinen Kindern wird erreicht. Das Familiengeld ist einkommens- und erwerbszeitunabhängig und damit ganz nah am Erziehungsgehalt. “Für alle das gleiche Geld” ist ein Gedanke am Erziehungsgehalt, der auch typisch für die Politik der CDU/CSU ist. Ganz bewusst ist die Bezeichnung “Familiengeld” gewählt. Angelehnt an andere Sozialleistungen wie Wohngeld, Kindergeld, Arbeitslosengeld, möchte sie Diskussionen aus dem Weg gehen. Ich denke, der Begriff “Gehalt” wurde hier ganz bewusst vermieden. Ich gehe weiter unten noch auf die Diskussion ein. “Familie” ist ganz wesentlich für die Politik und das Gesellschaftsbild der CDU. Andere Parteien hätten diesem Konzept sicher auch einen anderen Namen gegeben. Es bleibt zu sagen, dass die CDU/CSU einen großen Schritt in der Familienpolitik vorhat, der sich an den Gedanken zum Erziehungsgehalt orientiert.
Kritik und Familienpolitik der anderen Parteien
Die CDU/CSU ist die einzige große Partei, die Gedanken über ein Erziehungsgehalt in großem Maß in Erwägung zieht. Alle anderen Parteien lehnen ein Erziehungsgehalt grundsätzlich ab. Warum das der Fall ist, möchte ich nun darstellen. Das Verständnis von Familie weicht in den einzelnen Parteien sehr stark von einander ab. Die CDU/CSU ist die einzige Partei, die noch Ehe und Familie zusammennimmt in ihrer Familienpolitik, wie es das Grundgesetz beschreibt. Die anderen Parteien fassen aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen den Familienbegriff weiter. SPD, Bündnis 90/Die Grünen, und die FDP stimmen weitgehend darin überein, dass sie Familie als das Zusammenleben mit Kindern beschreiben. Sie fassen das in dem Slogan zusammen: Familie ist da, wo Kinder sind. Bei ihnen steht nicht die eheliche Lebensgemeinschaft im Zentrum der Politik, sondern jede Gemeinschaft, in der Kinder erzogen werden. Alleinstehende, gleichgeschlechtliche Paare, oder unverheiratete Eltern sind für sie genauso Familien wie Ehepartner mit Kindern. Die PDS geht noch einen Schritt weiter und sagt: Familie ist da, wo Nähe ist. Das soll ausdrücken, dass jede Form von gemeinschaftlichem Zusammenleben gleichbehandelt werden muss. Sie führt den Begriff der “Wahlfamilie” ein. Die Leitvorstellung ist hier, dass sich jeder seine Familie selbst zusammenstellt. Jeder entscheidet selbst darüber, für wen er oder wer für ihn sorgen soll, wer ihn beerdigen oder bei Krankheit seine Geschäfte tätigen soll.(vgl. Zum familienpolitischen Konzept der PDS (2002), 2) Diese kurze Darstellung macht die großen Unterschiede in den familienpolitischen Vorstellungen bereits deutlich.
Die amtierenden Parteien der Bundesregierung, SPD und Bündnis 90/ Die Grünen, haben mit ihrer Politik seit 1998 bereits klar gemacht, wie sie sich Familienförderung vorstellen. Wie übrigens (fast) jede Partei, stellt auch die Bundesregierung die Forderung auf, dass die Mitglieder einer Familie ihr Zusammenleben selbständig gestalten sollen und ihnen die Politik nicht hineinreden darf. Die Anhebung des Kindergeldes auf 200 € wird auch für die nächste Legislaturperiode weiterverfolgt. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein wesentliches Element rot-grüner Politik. Mit dem Gesetz zur Teilzeitarbeit und zum Wiedereinstieg in den Beruf wurde hier mehr Sicherheit vor allem für Mütter geschaffen. Die weitere Familienpolitik der SPD bleibt wenig spezifisch, anders bei den Grünen. Sie möchten, dass die Verbindung von Arbeitsplatz und Familie selbstverständlich wird. Ihre weitere Politik zielt auf einen Kindergeldzuschlag für Einkommensschwache, flächendeckende und kostenlose Kinderbetreuung, moderne, wettbewerbsorientierte Schulen als Lebens und Sozialisationsraum, flexible Arbeitszeiten für Eltern und kostenlose Verkehrsmittelnutzung für Kinder. Die Einführung eines Erziehungsgehaltes kommt für die beiden Regierungsparteien nicht in Frage, weil es ihrer Meinung nach alte Rollenverständnisse festigt. Der Vorwurf eines “Zu-Hause-bleib-Geldes” geht an die CDU/CSU in bezug auf ihr Familiengeld. Diesem Argument möchte ich die Argumentation von Michael Opielka entgegenhalten. (vgl. Opielka, M.(2000), 8) Er macht deutlich, dass ein Absinken der Müttererwerbsquote nicht zu befürchten ist, da heute sowieso nach dem Erziehungsurlaub die wenigsten Mütter einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Ein Erziehungsgehalt würde viel eher den Betreuungsmarkt beleben und den Müttern eine Erwerbstätigkeit ermöglichen. Auch wenn es sich dabei nicht um eine allgemein anerkannte Meinung handelt, denke ich, dass ein Erziehungsgehalt ein Anfang zu einer Veränderung der traditionellen Rollenverteilung sein kann.
Die PDS teilt im großen und ganzen die Auffassung der Bundesregierung, geht aber noch schärfer gegen die Ehe als gesellschaftliche Institution an. Sie möchte die “Eheförderung” ganz abschaffen und das gesparte Geld, ca.40 Mrd. € , in Kinderförderung investieren. Ganz deutlich wird hier die Trennung zwischen Ehe der Eltern und Förderung des Kindes. Die Christdemokraten würden hier sicher einen direkten Zusammenhang sehen in der “Keimzelle der Gesellschaft”. Die Kinderförderung der PDS schließt eine Kindergrundsicherung und umfangreiche Realtransfers in allen öffentlichen Bereichen ein. Die Kindergrundsicherung steht allen Kindern zu und wird nicht auf die Sozialhilfe angerechnet. Öffentliche Einrichtungen wie Schwimmbäder, öffentliche Verkehrsmittel und Museen sollen Kindern ebenso kostenlos zur Verfügung stehen wie Ganztagsbetreuungsplätze. Mit einem Recht auf Ganztagsbetreuung soll gesichert werden, dass in der Gemeinschaft soziales Verhalten geübt werden kann. (vgl. Zum familienpolitischen Konzept der PDS (2002), 3) Die PDS ist auch strikt gegen ein Erziehungsgehalt. Neben allen Argumenten der Grünen und der SPD kommt bei ihnen noch mehr der Standpunkt dazu, dass Erziehungsarbeit in der Familie gar nicht so sehr wünschenswert ist, das könnten ausgebildete Fachkräfte viel besser. Gisela Notz, die sich auf das Modell “Erziehungsgehalt 2000” bezieht, stellt fest, dass Familien mit erstem Wohnsitz im Ausland des Erziehungsgehalt gar nicht bekommen würden und der Zuschlag für Alleinerziehende viel zu niedrig ist. Ihre Behauptung, das Erziehungsgehalt würde einseitig die Kinderbetreuung in der Familie durch die Mütter fördern, ist nicht korrekt, denn das Erziehungsgehalt soll erwerbszeitunabhängig sein.(vgl. Notz, G. (2000)) Auch der Vorwurf, “Kinderlose” würden als “Trittbrettfahrer” der Kinderreichen im Alter von den Sozialversicherungsbeiträgen deren Kinder profitieren, den sie als Anmaßung hinstellt, ist berechtigt. Er wurde ja sogar vom Bundesverfassungsgericht bestätigt.
Abschließend möchte ich noch die Familienpolitik der FDP darstellen. Die FDP lehnt das Erziehungsgehalt ab, weil sie darin ein Argument sieht, weshalb Frauen keine Erwerbsarbeit annehmen könnten. In Zeiten von Vollbeschäftigung wäre das sicher auch zu verstehen, doch in der gegenwärtigen Lage mit ca. 4 Millionen Arbeitslosen, ist es für mich nicht nachvollziehbar. Die FDP möchte den existenziellen Sach-, Betreuungs-, und Erziehungsbedarf von Kindern in einem Familiengeld zusammenfassen. Das soll entweder als Zuschlag gezahlt werden, wenn das Existenzminimum nicht erreicht wird, oder von der Steuer abgezogen werden. Das Ziel der Bestrebungen der FDP ist, den Familien die Erziehung von Kindern zu erleichtern. “Privat geht vor Staat” ist auch in der Familienpolitik ein wichtiger Leitsatz der Partei. Vollzeitbeschäftigung und Ganztagsbetreuung sind die großen Stichworte in der FDP- Familienpolitik. Aus gegenseitig übernommener Verantwortung dürfen keine Nachteile erwachsen. Nettozahlungen sind von der Politik der FDP nur in existenzsicherndem Rahmen zu erwarten. Ihre Politik richtet sich an die Verdienenden und sieht bestimmte Freibeträge für Kinderbetreuung und Absatzmöglichkeiten für Betreuungskosten vor. Im großen und ganzen würde eine Regierung durch die FDP wohl große Kürzungen im sozialen Bereich mit sich bringen.
Bei der Betrachtung der Diskussion wird deutlich, dass es die von allen geforderte Nichteinmischung in die Lebensgestaltung der Familien nicht gibt. Politik und besonders Familienpolitik ist nie bloße Folge gesellschaftlicher Erfordernisse, sondern formt immer auch die Gesellschaft mit, für die sie gemacht wird. Politik und Gesellschaft beeinflussen sich wechselseitig.
Weitere Kritik am Erziehungsgehalt
Ein bisher noch nicht angesprochener Kritikpunkt betrifft das Wort “Erziehungsgehalt”. Es trägt zu der Vorstellung bei, dass sich die Eltern in einem Angestelltenverhältnis mit dem Staat befinden, der sie für die Leistung des Kindererziehens bezahlt. Wenn man diesen Gedanken weiter verfolgt, könnte man zu der Ansicht kommen, dass der Staat die Richtlinien und Ziele der Erziehung vorschreiben kann, wie das bei Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Fall ist. Auf Grund dieses möglichen Konfliktes zwischen Eltern- und Staatsinteressen ist ein anderer Ausdruck für die Geldleistung für Kindererziehung angebracht. Die CDU/CSU hat den Namen “Familiengeld” für ihren Vorschlag ausgewählt. Denkbar wäre auch “Erziehungseinkommen” (vlg. Wingen, M. (2000), 2 ), was auch meiner Meinung nach die beste Bezeichnung dafür wäre. Neben dieser grundsätzlichen Kritik an der Bezeichnung möchte ich zum Schluss noch ein paar Stimmen aus Interessenverbänden diskutieren. In einem offenen Brief zum Erziehungsgehalt, hat die Arbeitsgemeinschaft der Familienverbände auf Bundesebene bereits im Oktober 1998 ihre Bedenken zum Erziehungsgehalt vorgebracht. Im Gegensatz zu den Parteien, deren Auffassung ich oben dargestellt und bewertet habe, handelt es sich hier um eine direkte Interessenvertretung von Familien, Müttern und Vätern. Der Brief nimmt Bezug auf die Modelle vom sächsischen Sozialminister Dr. Hans Geisler (Februar 1998) und auf das Modell “Erziehungsgehalt 2000” in der damaligen Fassung. Der Hauptansatzpunkt ist der Vorwurf, dass die Modelle nicht auf eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf hin wirken, sondern finanzielle Anreize zum Berufsausstieg schaffen. Die AGF ist gegen ein Erziehungsgehalt. Sie forderte damals einen Rechtsanspruch auf familienbedingte Reduzierung der Arbeitszeit und eine Weiterentwicklung des Bundeserziehungsgeldgesetzes. Beides ist bereits umgesetzt. Die Arbeitsgemeinschaft bezweifelt, dass mit dem Erziehungsgehalt eine Höherbewertung der Erziehungsarbeit einhergeht, dass die Höhe der Familienförderung tatsächlich so hoch ist, wie sie scheint, dass sich mehr Männer in die Erziehungs- und Versorgungsarbeit mit einbeziehen lassen und ein Ausbau der Kinderbetreuungsplätze zu erwarten ist. Statt dessen befürchtet die AGF einen Ausbau des traditionellen Rollenverständnisses, wonach der Mann die finanzielle Existenz sichert und die Frau die Familienarbeit übernimmt. Das würde der pluralistischen Umstrukturierung unserer Gesellschaft nicht genügend Rechnung tragen. Für die AGF wäre eine wirkliche Aufwertung der Erziehungsarbeit nur mit einer familienfreundlichen Arbeitswelt zu erreichen, in der das Kindererziehen selbstverständlich mit dem Beruf einhergeht. Nicht die Familien müssen sich an die vorherrschenden Strukturen der Berufswelt anpassen, sondern die Arbeitswelt muss sich der Realität stellen, dass Kindererziehung selbstverständlich zum menschlichen Leben dazugehört, und das für beide Geschlechter. Nach dieser Auffassung ist die Aufrechterhaltung unseres derzeitigen Arbeitsmarktes auf die Zerstörung unserer Gesellschaft aufgebaut. In dieser ist es für viele Eltern nicht mehr möglich, Kinder und Beruf in ihr Leben zu integrieren. Das eine geht nur auf Kosten des anderen. Der deutsche Familienverband zitiert in einer Pressemitteilung den Bundespräsidenten: “Entweder keine Zeit oder kein Geld für Kinder- das ist eine selbst zerstörerische Alternative, ein Armutszeugnis unserer Gesellschaft.”.
Ein Erziehungsgehalt allein kann sicher nicht alle Probleme von Kindern und Eltern in unserem Land lösen. Auch sind die möglichen Folgen tatsächlich kaum abzusehen. Das wird daran deutlich, dass die Gegner genau das Gegenteil der Ziele der Befürworter befürchten, sollte es zur Einführung eines Erziehungsgehaltes kommen. Ich finde es trotz allen Unwägbarkeiten erfrischend, zu sehen, dass sich Politik intensiv Gedanken über die Probleme von Kindern und Eltern macht, über gesellschaftliche Strukturen und Ungerechtigkeiten. Ich bin gespannt, wie die politische Debatte auf diesem Gebiet weitergeht.
Quellenverzeichnis
CDU/CSU Fraktion im deutschen Bundestag: Familiengehalt schafft ab 2004 echte Grundlage für Wahlfreiheit. In: http://www.cducsu.de. 16.4.2002
CDP- aktuell: Erziehungsgehalt. In: http://www.cdp.de. 17.8.2001
Deutscher Familienverband: Zur aktuellen Familienpolitik. In: http://www.deutscher- familienverband.de. 15.3.2002
Entschließungsantrag der FDP: “Zukunft gestalten- Kinder und Jugendliche stärken”. In: http://www.fdp.de. 4.2002-06-10
Familienpapier der FDP: Freiheit in Verantwortung- Liberale Familienförderung in der modernen Bürgergesellschaft. In 4.2002
FAZ.NET, Rechtspolitiker Geis (CSU) : Homo- Ehe gefährdet Leitbild Familie. In: http://www.lsvd.de. 8.4.2002 Offener Brief der AGF zum “Erziehungsgehalt”. 10.1998
Opielka, Michael: Das Konzept “Erziehungsgehalt 2000”. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B 3-4 2000.
Merz, Friedrich: Gesellschaftlichen Wert der Familienarbeit herausstellen. In: 18.4.2002
Notz, Gisela: Ab 1.1.2001 Erziehungsgehalt Wieder eine Neuauflage der Hausfrauenehe?. In: Sozialistische Zeitung Nr.26 vom 21.12.2000, Seite 7
Partei Bibeltreuer Christen (Hrsg.): Kinder sind Geschenke Gottes. ?
Rau, Petra: Familie ist da wo Kinder sind- Politik für ein familien- und kinderfreundliches Deutschland. Rede im deutschen Bundestag 18.4.2002
Regierungsprogramm der SPD 2002-2006: Antrag des Parteivorstandes für den außerordentlichen Bundesparteitags am 2.Juni 2002 in Berlin. In: http://www.spd.de.23.4.2002
Repnik, H.-P und Dr. Peter Ramsauer (Hrsg.) CDU/CSU Fraktion im deutschen Bundestag : Faire Politik für Familien- Eckpunkte einer neuen Politik für Familien, Eltern und Kinder. 2001
Schenk, Christina: Unser Familienbegriff bietet Raum für Selbstbestimmung- Zum familienpolitischen Konzept der PDS. In: http://www.pds-online.de.26.4.2002
Wahlprogramm der FDP. 2002
Wingen, Max: Aufwertung der elterlichen Erziehungsarbeit in der in der Einkommensverteilung Grundlagen, Möglichkeiten und Grenzen eines “Erziehungseinkommens”. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B 3-4 2000.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Erziehungsgehalt und was sind seine Ziele?
Das Erziehungsgehalt ist ein Konzept, das Eltern, die Kinder im Vorschulalter erziehen, ein Einkommen ermöglichen soll, um ihre Erziehungsarbeit gesellschaftlich anzuerkennen. Ziele sind die Aufwertung der Erziehungsarbeit, die Ermöglichung von mehr Partnerschaft in der Elternschaft und die Erweiterung der Chancen für Frauen. Es soll auch eine Investition in die Gesellschaft im Allgemeinen sein und die Chancengleichheit für alle Kinder fördern.
Warum wird ein Erziehungsgehalt gefordert?
Die Forderungen nach einem Erziehungsgehalt entstanden, weil die Erziehung von Kindern als notwendige gesellschaftliche Leistung angesehen wird, die bisher hauptsächlich von den Eltern finanziert wird. Es soll einen Ausgleich für den finanziellen und zeitlichen Aufwand der Kindererziehung und -pflege schaffen, insbesondere angesichts des demografischen Wandels und der Bedeutung von Kindern für Sozialversicherungssysteme.
Wie unterscheidet sich das Erziehungsgehalt vom aktuellen Familienleistungsausgleich?
Der Familienleistungsausgleich konzentriert sich hauptsächlich darauf, das Existenzminimum von Kindern steuerfrei zu halten. Das Erziehungsgehalt geht darüber hinaus, indem es ein Recht auf ein Einkommen für erziehende Eltern schaffen und ihre Arbeit gesellschaftlich anerkennen soll.
Wie wird das Erziehungsgehalt in der Öffentlichkeit von verschiedenen Parteien und Interessenvertretungen beurteilt?
Die CDU/CSU befürwortet das Erziehungsgehalt bzw. ein ähnliches Konzept (Familiengeld), während SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP es ablehnen. Kritiker argumentieren, dass es traditionelle Rollenverständnisse festigt und Frauen an Haus und Herd bindet. Befürworter sehen darin eine Möglichkeit, die freie Wahl zwischen Familienarbeit und Beruf zu ermöglichen und die Partnerschaft in der Elternschaft zu fördern.
Welche Ausgestaltungsvorschläge gibt es für das Erziehungsgehalt?
Es gibt verschiedene Modelle, die sich in der Höhe des Erziehungsgehaltes, dem Zahlungszeitraum und der Einkommensabhängigkeit unterscheiden. Einige Modelle schlagen auch Betreuungsgutscheine vor, die für Kinderbetreuungseinrichtungen verwendet werden können. Einig ist man sich größtenteils darin, dass das Erziehungsgehalt unabhängig von der Arbeitszeit sein sollte.
Was ist das Familiengeld der CDU/CSU?
Das Familiengeld der CDU/CSU ist ein Konzept, das Familien mit Kindern finanzielle Unterstützung gewährt. Es soll Gerechtigkeit für Erziehende herstellen, die finanzielle Benachteiligung von Familien abbauen und die Förderung junger Familien verbessern. Es ist steuer- und sozialabgabenfrei und wird unabhängig von der Erwerbstätigkeit oder dem Einkommen der Eltern geleistet. Die Höhe variiert je nach Alter des Kindes.
Welche Kritik gibt es am Familiengeld der CDU/CSU?
Kritikpunkte sind unter anderem die Finanzierung des Familiengeldes, die als wenig überzeugend dargestellt wird. Außerdem wird bemängelt, dass das Familiengeld bei Familien, die Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen, indirekt wirkt und nicht direkt den Kindern zugute kommt.
Wie positionieren sich andere Parteien zum Erziehungsgehalt und zur Familienpolitik?
SPD und Bündnis 90/Die Grünen setzen auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und lehnen ein Erziehungsgehalt ab. Die PDS plädiert für eine Kindergrundsicherung und umfangreiche Realtransfers und kritisiert die Ehe als gesellschaftliche Institution. Die FDP möchte ein Familiengeld, das den existenziellen Bedarf von Kindern deckt, und betont die Eigenverantwortung der Familien.
Welche weiteren Kritikpunkte gibt es am Erziehungsgehalt?
Ein Kritikpunkt betrifft die Bezeichnung "Erziehungsgehalt", da sie den Eindruck erwecken könnte, dass Eltern in einem Angestelltenverhältnis mit dem Staat stehen. Interessenverbände wie die Arbeitsgemeinschaft der Familienverbände befürchten, dass das Erziehungsgehalt finanzielle Anreize zum Berufsausstieg schafft und traditionelle Rollenverständnisse festigt.
- Quote paper
- Martin Grohmann (Author), 2002, Das Erziehungsgehalt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106793