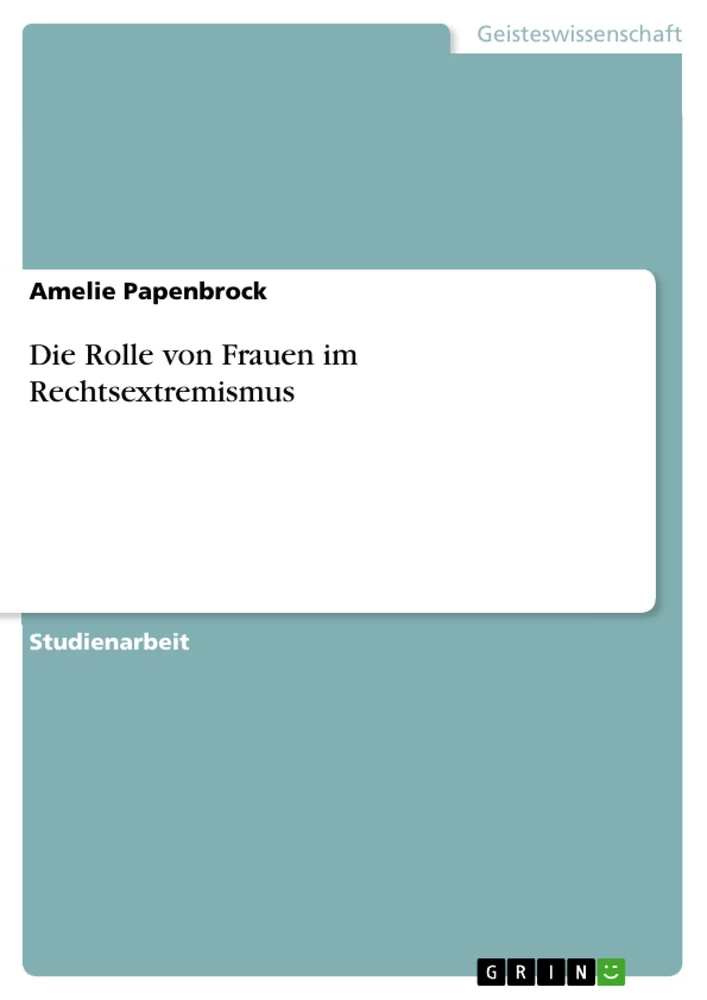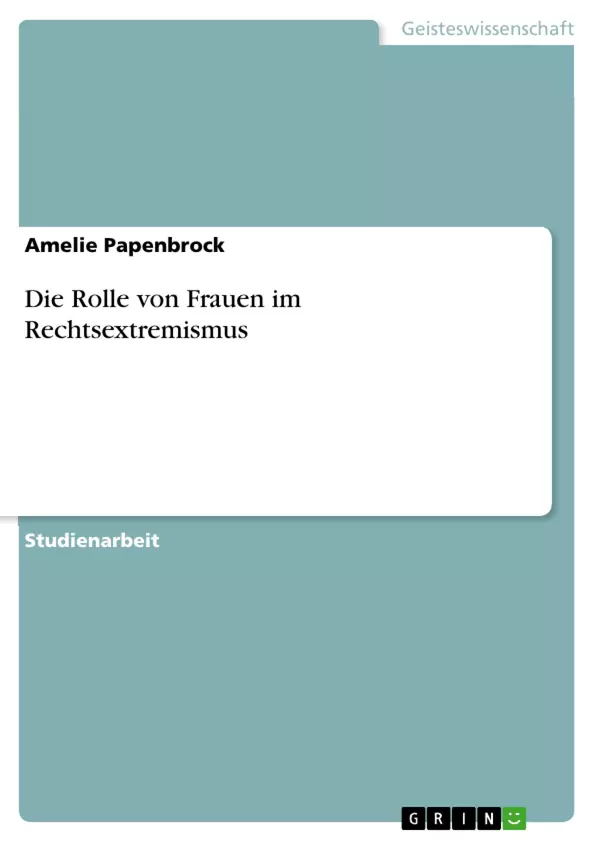In dieser Hausarbeit soll grundlegend der Frage nachgegangen werden, welche Weiblichkeitskonstruktionen in der extremen Rechten vorherrschen, ob und wie diese von den Frauen in der extrem rechten Szene realisiert werden und wie der Umgang innerhalb der sozialen Arbeit mit dem Thema aussieht, welche Problematiken hier gegeben sind und welche Handlungsempfehlungen gelten können.
Um dieser Frage nachzugehen, sollen zunächst einmal die hier verwendeten Definitionen der zentralen Begriffe kurz benannt und erläutert werden. Der zweite Teil befasst sich mit der Beteiligung von Frauen im Rechtsextremismus, hier werden verschiedene Untersuchungen und Schätzungen herangezogen, um zu klären, wie die Geschlechterverhältnisse in den verschiedenen Bereichen der extrem rechten Szene sind und wo Frauen innerhalb der Szene agieren.
Anschließend wird auf die Weiblichkeitskonstruktionen im extrem rechten Weltbild eingegangen, um diese im folgenden Kapitel auf ihre Realisierung hin zu prüfen. Abschließend soll der Umgang der sozialen Arbeit mit Rechtsextremistinnen thematisiert werden. Dies geschieht zunächst über einige Annahmen, die im Allgemeinen getroffen werden können und anschließend exemplarisch anhand von verschiedenen Arbeitsfeldern der sozialen Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärungen
- Beteiligung von Frauen in rechtsextremen Szenen
- Parteien
- Nicht-parteiförmige Organisationen
- rechtsextreme Kriminalität
- Einstellungen
- Die Rolle der Frau in der extrem rechten Weltanschauung
- Die Realität: Umsetzung des Frauenbildes
- Soziale Arbeit und Rechtsextremismus
- Frühkindliche Bildung
- Jugendarbeit
- Familienunterstützende Hilfe
- Schutz vor häuslicher Gewalt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Rolle von Frauen im Rechtsextremismus. Sie analysiert, welche Vorstellungen von Weiblichkeit in der extrem rechten Ideologie vorherrschen, ob und wie diese von Frauen in der Szene umgesetzt werden und wie die soziale Arbeit mit Rechtsextremistinnen umgeht.
- Weiblichkeitskonstruktionen in der extrem rechten Ideologie
- Beteiligung von Frauen in verschiedenen Bereichen der rechtsextremen Szene
- Realität der Umsetzung des Frauenbildes in der Szene
- Herausforderungen und Handlungsempfehlungen für die soziale Arbeit im Umgang mit Rechtsextremismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Relevanz des Themas und stellt die Forschungsfrage nach der Rolle von Frauen im Rechtsextremismus. Kapitel 2 definiert die zentralen Begriffe Rechtsextremismus und Frau. Kapitel 3 beleuchtet die Beteiligung von Frauen in der extrem rechten Szene anhand verschiedener statistischer Befunde in den Bereichen Parteien, nicht-parteiförmige Organisationen, extrem rechte Kriminalität und Einstellungen. Kapitel 4 analysiert das Frauenbild in der extrem rechten Weltanschauung.
Schlüsselwörter
Rechtsextremismus, Frauen, Gender Gap, Weiblichkeitskonstruktionen, Weltanschauung, soziale Arbeit, Rechtsextremistinnen, Frühkindliche Bildung, Jugendarbeit, Familienunterstützende Hilfe, Schutz vor häuslicher Gewalt.
Häufig gestellte Fragen
Welches Frauenbild herrscht in der extrem rechten Ideologie vor?
Das Weltbild ist oft von traditionellen Rollenbildern geprägt, die Frauen primär als Mütter und Bewahrerinnen der „Volksgemeinschaft“ sehen. Gleichzeitig gibt es moderne Konstruktionen, in denen Frauen aktivistisch auftreten.
Wie aktiv sind Frauen in rechtsextremen Parteien und Organisationen?
Die Beteiligung variiert. Während sie in Führungspositionen von Parteien seltener sind, agieren sie stark in nicht-parteiförmigen Organisationen und übernehmen dort oft soziale oder logistische Aufgaben.
Gibt es einen „Gender Gap“ im Rechtsextremismus?
Statistiken zeigen oft, dass Männer häufiger in rechtsextremen Strukturen auffallen. Die Arbeit untersucht jedoch, ob Frauen lediglich weniger sichtbar sind oder andere Formen der Beteiligung wählen.
Warum ist das Thema für die Soziale Arbeit wichtig?
Rechtsextremistinnen sind oft in unauffälligen Bereichen wie der frühkindlichen Bildung oder Jugendarbeit tätig. Sozialarbeiter müssen sensibilisiert werden, um rechtsextreme Einstellungen hinter einer „netten Fassade“ zu erkennen.
Welche Handlungsempfehlungen gibt die Arbeit für die Praxis?
Wichtig sind Fortbildungen zur Erkennung rechtsextremer Symbolik und Rhetorik sowie die Entwicklung von Strategien zur Auseinandersetzung mit rechtsextremen Eltern in Kitas oder Schulen.
- Citation du texte
- Amelie Papenbrock (Auteur), 2018, Die Rolle von Frauen im Rechtsextremismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1068766