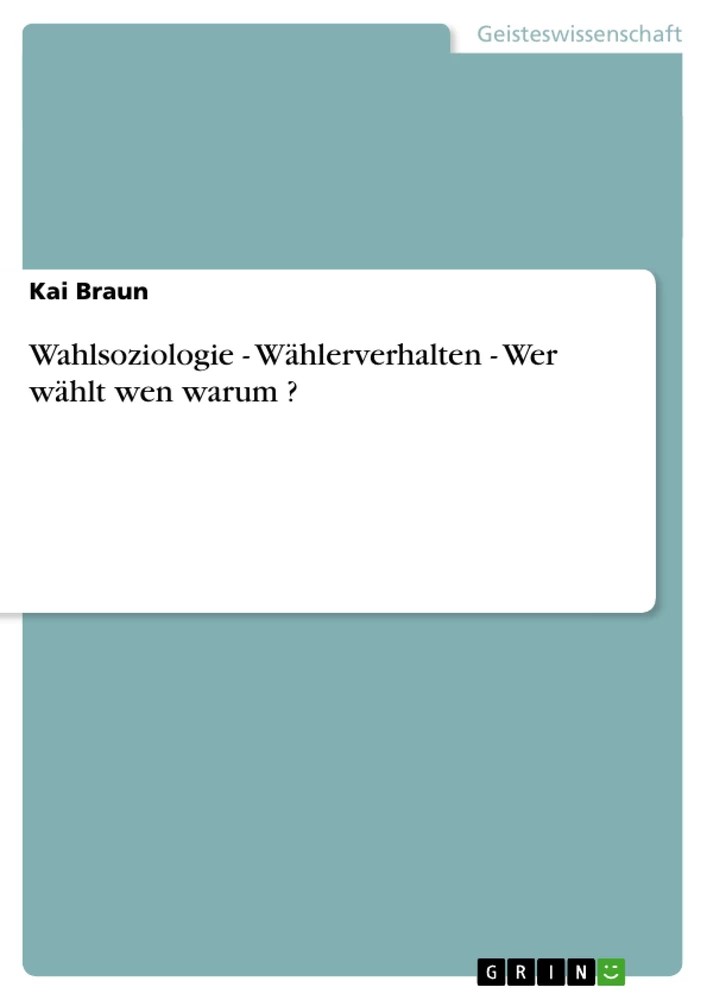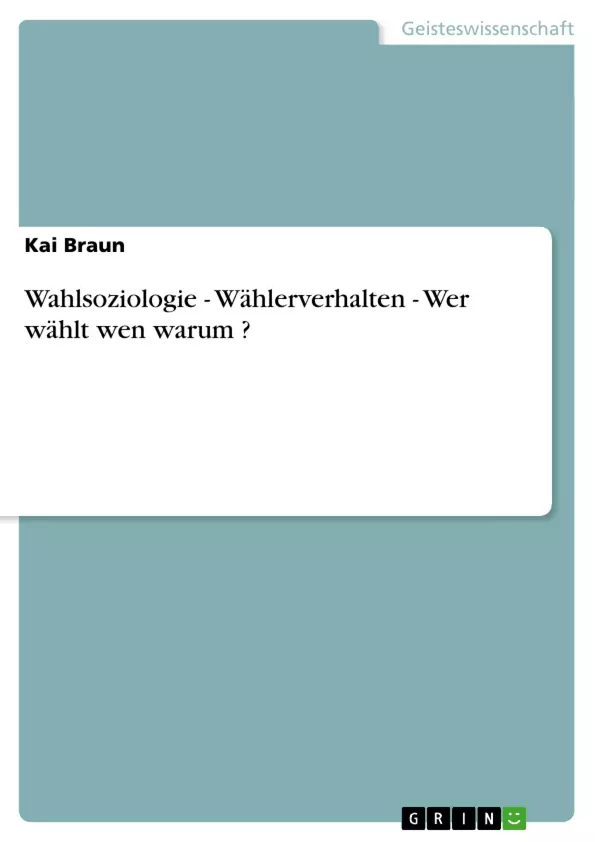1.Erklärungsmodelle von Wahlverhalten
1.1. Soziologische Ansätze
Die soziologischen Ansätze versuchen das Verhalten von Wählern auf Grund von Sozialstrukturen zu erklären. Hierbei werden zwei unterschiedlichen Modelle angewandt:
> das mikrosoziologische Erklärungsmodell (Columbia School, Paul Lazarsfeld)
> das makrosoziologische Erklärungsmodell. (Lipset und Rokkan)
Merkmale des mikrosoziologischen Modells:
- untersucht den Einfluss der unmittlebaren Umgebung des Wählers, seine Primärumwelt, also Familie, Berufskollegen, Freundeskreis
- Harmoniestreben des Einzelnen als grundlegendes Verhalten des Menschen, Gruppen- druck, Anpassung und die Kommunikation mit sog. Meinungsführern (z.b. der Vater in der Familie) führen dazu, dass bevorzugt die Partei gewählt wird, die im sozialen Umfeld des Wählers Präferenz genießt (Parteienpräferenz)
- Resultat: Gleiche Gruppenzugehörigkeit führt tendenziell zu gleichem Wahlverhalten.
- Die Kombination verschiedener Sozialfaktoren kann ein ziemlich exaktes Bild über die Wählerschaft einer Partei ergeben. Für die BRD ergeben sich z.b. folgendes Wählergruppierungen: CDU/CSU: (kath.) Kirchgänger, Mittelschicht, ohne gewerkschaftliche Bindung, auf dem Lande lebend
SPD: Facharbeiter, gewerkschaftlich gebunden, Nicht katholisch
Grüne/FDP: Stadt, höherer Bildungsabschluss, jung
Merkmale des makrosoziologischen Modells
- Es geht von grundsätzlichen Interessenskonflikten in einer Gesellschaft aus, die in einer Demokratie im Gleichgewicht gehalten werden müssen.
- Dabei lassen sich zwei grundlegende Cleavagetypen (cleave=spalten) unterscheiden:
1.Konflikte zwischen einem nationalen Zentrum und regionaler Peripherie (ethnische, territoreale, kulturelle Konflikte, z.b. Südtirol <-> Rom)
2. Sozioökonomische Konflikte oder Klassenkonflikt (Arbeiter <-> Unternehmer, Agrar <-> Industrieinteressen)
- Das Verhalten des Wählers ist nun abhängig von der Konfliktsituation in der er steht. Im ersten Konflikt wählt man (unabhängig von seiner sozioökonomischen Position) mit seiner Gemeinde, seiner Sprachgruppe, seiner Glaubensgemeinschaft usw. Typisches Bsp. war in der Weimarer Republik die kath. Zentrumspartei.
- In der BRD verlaufen die Hauptspannungslinien heute zwischen religiös orientierten Wäh- lern (eher CDU) und religiös abstinenten Wählern (andere Parteien) einerseits und zwischen Arbeitern (eher SPD) und Unternehmern/Selbständigen (eher CDU/FDP) andererseits.
Sowohl das mikro- als auch das makrosoziologische Modell erklären plausibel die Existenz von Kerngruppen, die einer Partei über Jahrzehnte die Treue halten und deshalb auch als die Stammwählerschaft einer Partei bezeichnet werden.
Allerdings werden Wahlen nicht nur durch Stammwähler gestaltet und entschieden. Die soziologischen Ansätze allein reichen also nicht aus, um das Wahlverhalten hinreichend zu erklären. Hierzu sind weitere Modelle als Ergänzung nötig. Ein ergänzendes Modell hierzu ist das Ann Arbor-Modell, welches einen sozialpsycholgischen Ansatz verfolgt.
1.2. Sozialpsychologischer Ansatz (Ann Arbor-Modell)
Merkmale:
- entwickelt an der University of Michigan in Ann Arbor
- Das Modell geht davon aus, dass die individuelle Wahlentscheidung das Ergebnis verschiedener langfristiger, d.h. vergangener und kurzfristiger, d.h. gegenwärtiger Einflüsse auf das Individuum ist. (Kausalitätstrichter, s. Abb. unten)
- Ausschlaggebend in diesem Modell ist die sog. Parteiidentifikation. Darunter versteht man eine psychologische Mitgliedschaft in einer Partei (im Gegensatz zur formalen Mitgliedschaft), die sich auf eine länger andauernde, gefühlsmäßig tief verankerte Bindung an eine bestimmte Partei begründet.
- Die Parteiidentifikation wirkt häufig als Filter bei der Wahrnehmung und Einschätzung kurzfristiger Ereignisse, d.h. die Bewertung solcher Ereignisse durch den Wählers ist durch die Identifkation "gefärbt". Man schaut durch seine "Parteibrille" die Ereignisse an.
- Die Partei mit der sich der Wähler identifiziert dient als pol. Bezugsgruppe, um im sehr komplexen Raum der Politik ohne großen Aufwand Orientierung zu finden. Dadurch wird Wahlverhalten kontinuierlich und trägt somit zu einer Stabilisierung des pol. Systems bei und macht die Wähler immun gegen extremistische Strömungen.
- Das Modell sieht auch Abweichungen von der längerfristigen Parteienbindung durch kurzfristige Einflüsse vor. Bedeutsam für solche Abweichungen sind die Orientierung des Wählers an Kandidaten, Problemen und Problemlösungskompetenz der Parteien. Der Wähler entscheidet dann kurzfristig an Hand dieser Parameter und wählt die Partei (oder den Kandidaten der Partei) von der er meint, dass sie die in seinen Augen dringensten Probleme (z.b. Arbeitslosigkeit) am Besten lösen kann.
Das Ann Arbor-Modell
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.3 Rationales Wahlverhalten
Merkmale:
- Methode aus der Ökonomie, von A.Down 1957 entwickelt
- These: Die Menschen handeln egoistisch, indem sie v.a. ihr materielles Wohlergehen zu maximieren versuchen.
- auf das Wählerverhalten bezogen: Die Menschen wählen die Partei, von der sie den größten Nutzen erwarten. Gibt es keine Alternativen im Parteienspektrum,die einen größeren Nutzen für den Wähler erkennen lassen, so wählen sie nicht.
- In der ursprünglichen Fassung wird diese These heute nicht mehr vertreten. Die Wähler entscheiden nicht ausschließlich nach ihren persönlichen materiellen Interessen. Trotzdem gibt es in der BRD zahlreiche Beispiele die rationales Wählerverhalten zeigen:
> Stimmensplitting: In den 70er Jahren erhielt die FDP zahlreiche Zweitstimmen von Wäh- lern die der SPD nahe standen. In den 80er und 90er Jahren erhielt sie die Zweitstimmen von CDU-nahen Wählern. Dieses Wahlverhalten wird als rational bezeichnet, da es einen Koaliti- onswunsch ausdrückt. Aus taktischen Gründen wird nicht die erste Parteipräferenz gewählt.
> Rationale Protestwähler am Bsp. der Republikaner: Es wird eine Partei gewählt, die kaum eine Machtchance hat, die aber sehr wohl die großen Parteien zwingt ihre Politik zu verän- dern, um das Anwachsen der Extreme zu verhindern. Der rationale Wähler erreicht somit in- direkt eine Änderung der Ziele "seiner" Volkspartei. Als der Asylkompromiss 1993 verab- schiedet war und dadurch die Zunahme der Asylbewerber gestoppt wurde, schmolz das Wäh- lerpotential der Republikaner auf ihre Kernwählerschaft zusammen, so dass die Republikaner heute keine große Rolle mehr spielen.
> 5-Prozent-Hürde: Viele neuen Parteien werden von vornherein nicht gewählt, weil der Wähler ganz rational damit rechnet, dass eine neue Partei nicht in ein Parlament einziehen kann und so seine Stimme u.U. verloren ist.