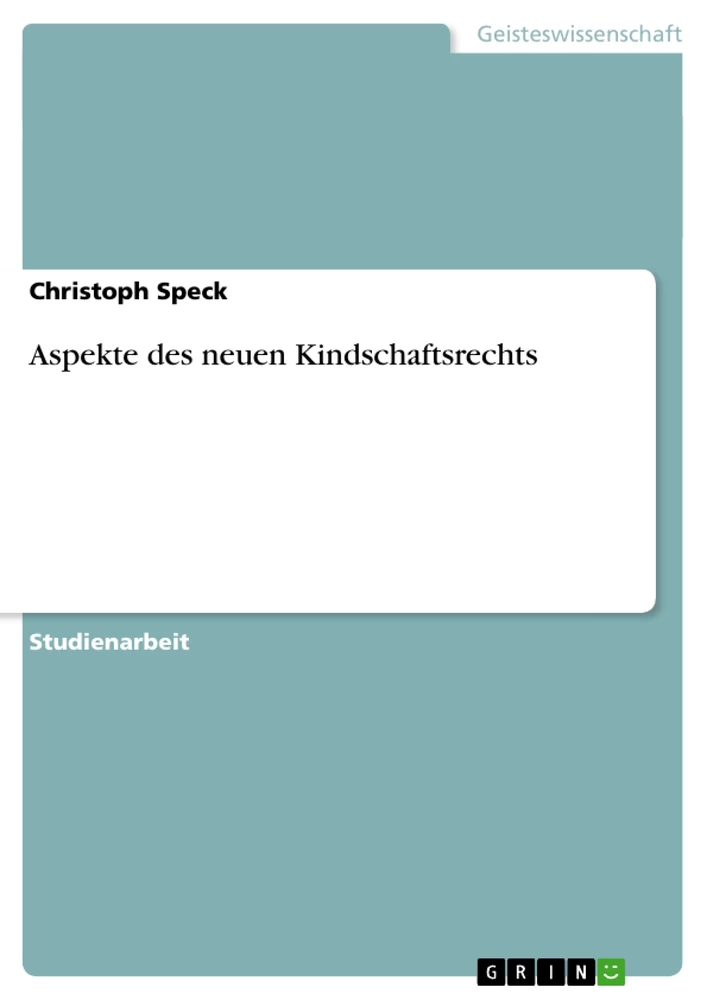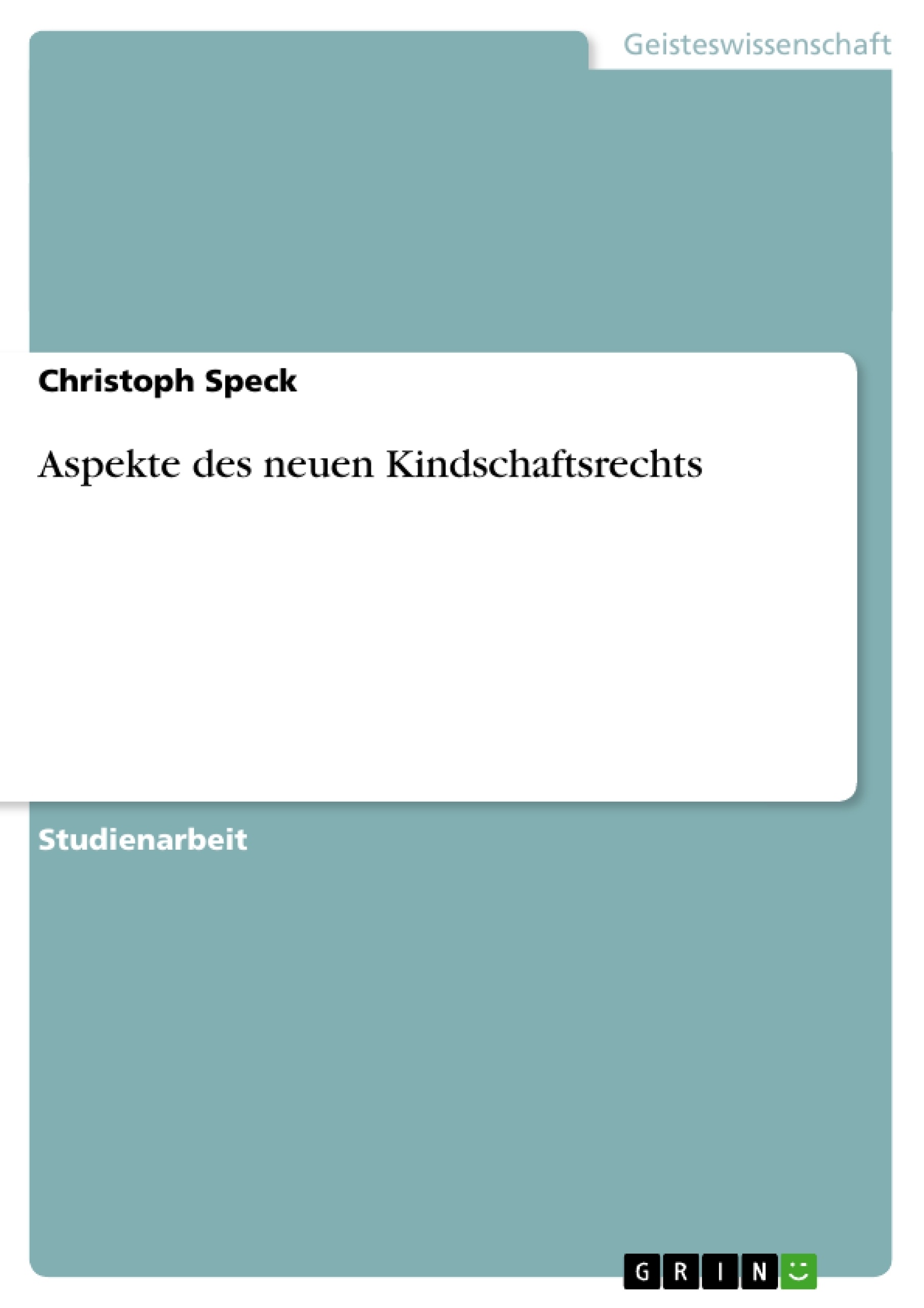Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Reform des Kindschaftsrechts - Gründe für die gesetzlichenänderungen
2.1 Sozialer Wandel
2.2 UN-Kinderrechtskonvention
2.3 Urteile des Bundesverfassungsgerichtes
3. Ziele des neuen Kindschaftsrechts
4. Schwerpunkte des neuen Kindschaftsrechts
4.1 Gleichstellung ehelicher und nichtehelicher Kinder
4.1.1 Elterliche Sorge
4.1.2 Abstammungsrecht
4.1.3 Namensrecht
4.2 Recht der elterlichen Sorge
4.2.1 Inhaltliche und allgemeine Aspekte
4.2.2 Elterliche Sorge nach Trennung und Scheidung
4.2.3 Beistandschaftsgesetz
4.2.4 Umgangsrecht
5. Kindschaftsrecht und Jugendhilfe
6. Resüm é e
7. Anhang
7.1 Quellenverzeichnis
7.2 Abbildungsverzeichnis
7.3 Alte Gesetzestexte (Stand: 1995)
7.4 Aktuelle Gesetzestexte (Stand: 1999)
7.4.1 Auszüge aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch
7.4.2 Auszüge aus sonstigen Gesetzestexten
1. Einleitung
Die folgende Hausarbeit beschäftigt sich mit zentralen Aspekten des neuen Kindschaftsrechts, d.h. mit den wichtigsten gesetzlichen Änderungen und den damit verbundenen Auswirkungen auf Kinder, Eltern, Gerichte und Jugendhilfe.
Da es den Rahmen der Hausarbeit sprengen würde, sämtliche Neuerungen aufzugreifen, wer- den Themen wie die Gleichstellung von ehelichen und nichtehelichen Kindern, das Beistand- schaftsgesetz und das Recht der elterlichen Sorge in den Vordergrund gestellt. Die Ausführungen zu den Folgen für die Beteiligten bleiben oftmals nur Ausblicke, denn die meisten neuen Gesetze traten erst am 1.7.1998 in Kraft. Somit lassen sich keine empirisch gesicherten Daten und Fakten verwenden. Die diesbezüglichen Expertenmeinungen der ver- wendeten Literatur hatten aufgrund dessen einen eher prognostischen Charakter. Um dennoch Rückmeldungen auf die Auswirkungen des neuen Kindschaftsrechts in der Praxis zu erhalten, wurden Aufsätze der Initiative VÄTERAUFBRUCH FÜR KINDER E.V. und des DEUTSCHEN KIN- DERSCHUTZBUNDES (DKSB) herangezogen.
Die Hausarbeit ist so strukturiert, dass zunächst der Reformbedarf begründet wird. Die beiden darauf folgenden Abschnitte behandeln die wichtigsten Ziele und die Konzeption des neuen Kindschaftsrechts, während sich das vierte Kapitel schwerpunktmäßig mit den jeweiligen Gesetzen auseinandersetzt. Im fünften Abschnitt geht es um den Zusammenhang zwischen der neuen Rechtsprechung und der Jugendhilfe.
Leider lassen sich die benannten Themenkomplexe inhaltlich nicht immer sauber trennen. Gesetze und Auswirkungen sind zum Teil eng miteinander verknüpft, so dass bei den Erörte- rungen zu den einzelnen Rechtsbereichen Auswirkungen gleichzeitig mit aufgeführt werden. Daneben sind auch die Schwerpunkte im vierten Kapitel nicht exakt differenzierbar. Der elter- lichen Sorge ist beispielsweise ein eigener Unterabschnitt gewidmet, obwohl die Gleichstel- lung der ehelichen und nichtehelichen Kinder ebenfalls einen Bezug zur Rechtsprechung der elterlichen Sorge aufweist.
Es gibt zum Terminus Kindschaftsrecht keine Definition von Seiten des Gesetzgebers. Im engeren Sinne versteht man darunter den „Teil des Familienrechts, der sich mit den Rechtsbeziehungen zwischen den Eltern und den Kindern beschäftigt“ (vgl. SCHIMKE 1998, 1). Diese regelt das Vierte Buch des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) „Familienrecht“, insbesondere der zweite Abschnitt „Verwandtschaft“. Der Abschnitt umfasst die Bereiche Abstammung, Unterhaltspflicht, Rechtsverhältnis zwischen den Eltern und dem Kinde im allgemeinen, elterliche Sorge, Beistandschaft und Annahme als Kind.
Im weiteren Sinne bezieht sich das Kindschaftsrecht auch auf die Rechtsfolgen, die die Anwendung des BGB nach sich zieht. Hierzu gehören neben dem Bereich der Jugendhilfe auch die Folgen, die an die Verwandtschaft der Beteiligten geknüpft sind.
Gesetzliche Änderungen im Zuge der Kindschaftsrechtsreform traten also nicht nur im BGB, sondern unter anderem auch im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), im Gesetzüber die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) und im Personenstandsgesetz (PStG) auf.
2. Die Reform des Kindschaftsrechts - Gründe für die gesetzlichen Änderungen
Am 1.1.1980 wurde eine breitgefächerte Änderung des Kindschaftsrechts verabschiedet, wobei insbesondere die elterliche Sorge in Einzelregelungen eine Neubearbeitung erfuhr. Allerdings stellte diese keine zufriedenstellende rechtliche Situation dar.
Drei wesentliche Faktoren sorgten dafür, dass das Kindschaftsrecht ein weiteres Mal reformiert wurde bzw. werden musste (vgl. BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ et al. (Hrsg.) 1999, 10; vgl. SCHIMKE 1998, 2):
1. Es war (ist) ein zunehmender sozialer Wandel zu verzeichnen. Schlagworte in dem Zu- sammenhang sind Individualisierung und Pluralisierung.
2. Es wurden Impulse aus der UN-Kinderrechtskonvention aufgegriffen.
3. Einige Urteile des Bundesverfassungsgerichtes setzten Änderungen aus dem Jahre 1980 teilweise außer Kraft.
2.1 Sozialer Wandel
Im Zuge der zunehmend aufkommenden Individualisierung und Pluralisierung der Lebens- formen ist eine stark wachsende Anzahl an Scheidungen zu beobachten. Noch 1970 wurde lediglich jede fünfte Ehe geschieden, während es 1998 bei steigender Tendenz bereits jede dritte Ehe war, wobei die Scheidungsrate in Großstädten in noch höheren Bereichen lag (vgl. SCHIMKE 1998, 7). Die hohen Scheidungsraten spiegeln sich in der Summe alleinerziehender Elternteile wieder. 1991 verzeichnete man 1.476.000 alleinstehende Elternteile (davon ca. 86% Frauen) und über 2.000.000 minderjährige Kinder in Ein-Eltern-Familien (vgl. OBER- LOSKAMP 1994, 21).
Des weiteren hat sich die Anzahl unverheirateter Lebensgemeinschaften von 1972 (138.000) bis 1991 (1.393.000) mehr als verzehnfacht (vgl. ebd. 1994, 5).
Zum einen bedeutet dies, dass die Ehe nicht mehr zwangsläufig den Normalfall partnerschaftlicher Bindung darstellt. Zum anderen stieg die Anzahl nichtehelicher Kinder. Waren es 1979 noch etwa 41.500, so wurden 1995 knapp 88.000 außereheliche Geburten registriert. Bezieht man die neuen Bundesländer mit ein, waren es 1995 insgesamt etwa 123.000 nichteheliche Kinder (vgl. BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ et al. (Hrsg.) 1999, 10).
Die vormals per Gesetz divergierende Rechtsprechung bezüglich ehelicher und unehelicher Kinder war daher reformbedürftig.
Ebenfalls reformbedürftig war aufgrund der hohen Scheidungsquoten das Recht der elterlichen Sorge, wobei in den meisten Scheidungsfällen vormals der Mutter das Sorgerecht zugesprochen wurde. Man begründete die Übertragung der Alleinsorge auf ein Elternteil mit der Annahme, dass eine Scheidung das Ende der Familie bedeute und die Aufrechterhaltung der gemeinsamen Sorge daher nicht mehr möglich sei (s. Kap 4.2).
Die zunehmende Gewalt gegen Kinder, der oftmals fehlende Kontakt zu Gleichaltrigen bzw. Geschwistern, die Institutionalisierung der Kindheit und das Armutsrisiko für alleinerziehen- de Eltern und kinderreiche Familien waren weitere gesellschaftliche Faktoren, die Kind- schaftsrechtsreformbedarf hervorriefen (vgl. SCHIMKE 1998, 11ff.). Kinder und Familien be- nötigen verbesserte Beratungsmöglichkeiten seitens der Jugendhilfe, ein Mehr an Schutz vor Gewalt und insbesondere die „Aufrechterhaltung der Beziehungen des Kindes zu beiden El- tern im Falle von Trennung oder Scheidung für seine weitere Entwicklung“ (www.kinderschutzbund-nrw.de/273.htm).
2.2 UN-Kinderrechtskonvention
Am 20.11.1989 wurde bei einer Vollversammlung der VEREINTEN NATIONEN (UN) die UNKinderrechtskonvention verabschiedet. In 54 Artikeln regelt diese die Rechte von Kindern rund um den Globus.
Die Konvention wird von den drei Eckpfeilern protection, participation und provision gebildet („Die Kinderrechtskonvention drückt die Grundwerte im Umgang mit Kindern, ihrem Schutz und ihrer Beteiligung aus.“, SCHIMKE 1998, 17).
Protection meint vor allem Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung, vor Kriegen und Katastrophen. Participation bezieht sich einerseits auf die freie kindliche Meinungsäuße- rung gegenüber erwachsenen Beteiligten und andererseits darauf, dass Kinder Anspruch auf den Erhalt kindgerechter Informationen haben. Provision bedeutet das kindliche Recht auf Gesundheitsversorgung, Grundbildung, Sozialversicherung und menschenwürdige Wohnver- hältnisse.
In der BRD trat die UN-Kinderrechtskonvention am 5.4.1992 in Kraft. Deutschland hat sich damit bereit erklärt, sein Rechtssystem insoweit zu verändern, dass den Anforderungen der UN Genüge getan wird.
Allerdings gab es zwischen der deutschen und der UN-Rechtssprechung teilweise erhebliche Divergenzen. Ein Hauptunterschied lag in der Rechtsprechung zum Umgang der Eltern mit dem Kind. Die Konvention vertritt die Ansicht, dass Kinder das Recht auf Umgang mit beiden Elternteilen haben. In dieser Form gab es das Umgangsrecht in der BRD nicht. Dies änderte sich erst durch das neue Kindschaftsrecht.
Eine weitere große Lücke stellte die Stellung des Kindes vor Gericht dar. Mit den Aspekten participation, protection und provision wollte die UN-Kinderrechtskonvention unter anderem erreichen, dass das Kind in der Rechtsprechung als Subjekt zu behandeln ist. Im Gegensatz dazu wurde das Kind nach altem deutschen Gesetz mehr als Rechtsobjekt gesehen wurde. Die Rechte der Eltern standen hierarchisch über denen des Kindes, welches teilweise zum „Spielball“ für Streitigkeiten zwischen den Elternteilen oder zwischen Staat und Eltern avancierte. Daher bestand hier ebenfalls Reformbedarf.
Trotz der gesetzlichen Änderungen in der deutschen Rechtsprechung und der Annäherung an die UN-Richtlinien konnten bis dato noch nicht sämtliche Anforderungen erfüllt werden. SCHIMKE vertritt die Meinung, dass das Hauptziel der Konvention, die Persönlichkeit des Kindes zu schützen, zu fördern und zu beteiligen, nur durch eine Änderung des Grundgesetzes angemessen erreicht werden könne (ebd. 1998, 6).
2.3 Urteile des Bundesverfassungsgerichtes
In den 1980er Jahren setzte das Bundesverfassungsgericht durch einige Urteile zum Teil wesentliche Punkte des alten Kindschaftsrechts von 1980 außer Kraft. Es wurden Verfahren ausgesetzt, Teile des Kindschaftsrechts für verfassungswidrig erklärt und es entstand eine Rechtsunsicherheit (vgl. ebd. 1998, 4f.). Daraus erwuchs eine unbefriedigende Rechtssituation, die den Gesetzgeber zum Handeln zwang. Somit wurden weitere Weichen in Richtung des neuen Kindschaftsrechts gestellt.
1982 wurde die zwingende alleinige Sorge nach der Scheidung als übermäßiger Eingriff in das Elternrecht bezeichnet.
Seit 1986 kann für Kinder in Ausnahmefällen ein Ergänzungspfleger bestellt werden.
Seit 1991 ist es verfassungswidrig, Eltern von nichtehelichen Kindern prinzipiell nicht die gemeinsame elterliche Sorge zuzusprechen.
Die drei genannten Urteile bildeten zentrale Argumente für das neue Kindschaftsrecht in puncto gemeinsame elterliche Sorge, Verfahrensrecht, Subjektstellung des Kindes in Verfahren und Gleichstellung von ehelichen und nichtehelichen Kindern.
3. Ziele des neuen Kindschaftsrechts
Dieser Abschnitt behandelt die grundlegenden Intentionen des neuen Kindschaftsrechts. Die Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen an den gesellschaftlichen Wandel als Ziel des neuen Kindschaftsrechts wurde bereits angesprochen.
Als zentrale Intention lässt sich die Stärkung des Kindeswohls bezeichnen, die in der gesamten Breite der Reform erkennbar ist. Dies wird unter anderem bei der verbesserten Subjektstellung des Kindes in der Rechtsprechung ersichtlich.
Um dieses Ziel zu erreichen, wurden wichtige gesetzliche Änderungen vorgenommen, und zwar die Gleichstellung ehelicher und nichtehelicher Kinder, das neue Beistandschaftsgesetz und das neue Umgangsrecht. Außerdem versucht man durch die Grundprinzipien der UNKinderrechtskonvention participation, provision und protection, den veränderten sozialen Bedingungen und somit dem Kindeswohl zu entsprechen.
Ein zweites wichtiges Ziel stellt die Stärkung der Rechtsposition der Eltern dar, wobei insbe- sondere das Umgangsrecht und das Recht der elterlichen Sorge darauf hinwirken sollen. Nach altem Recht wurden die Elternteile rechtlich nicht unbedingt gleich behandelt. Einige Gesetze waren eher patriarchalisch (vgl. ebd. 1998, 2), bei anderen wiederum wurden Väter benachtei- ligt. Beispielsweise gab es vor dem 1.7.1998 für Väter keine Möglichkeit, die gemeinsame Sorge für außerehelich geborene Kinder zu beantragen (vgl. MÜNDER 1998, 19).
Die Rechtsposition der Eltern wird parallel dazu durch die neue Rechtsprechung bezüglich der gemeinsamen elterlichen Sorge gestützt. Nicht nur während der Ehe ist man als Vater o- der Mutter eine wichtige Bezugsperson für das Kind, sondern auch in Fällen von Trennung, Scheidung oder nichtehelichen Lebensgemeinschaften (s. Kap.4.2.2).
Die Stärkung der Rechtsposition bedeutet weiterhin, dass der Staat geringere Eingriffsmög- lichkeiten gegenüber den Familien hat. Gerichte und Jugendämter werden nun nicht mehr wie nach altem Recht automatisch bei außerehelichen Geburten tätig (s. Kap. 4.1). Damit fallen gleichzeitig viele Vaterschaftsfeststellungen weg, was das neue Recht in der Hinsicht billiger macht.
Der letztgenannte Aspekt und die Gleichbehandlung ehelicher und nichtehelicher Kinder tra- gen dazu bei, dass das Recht einfacher und überschaubarer geworden ist (vgl. SCHIMKE 1998, 20).
Durch die Änderungen im Kindschaftsrecht ist außerdem das Ziel erreicht worden, die vom Bundesverfassungsgericht außer Kraft gesetzten Gesetze und die damit einhergehende Rechtsunsicherheitssituation zu bewältigen. Allerdings gibt es an dieser Stelle Stimmen, die eine immer noch vorhandene Rechtsunsicherheit konstatieren („Es gibt Gerichtsbezirke, die auch heute ... ‘alte‘ Fälle, damals entschieden nach den Kriterien des ‘Altgesetzes‘, zur Neu- entscheidung nur zulassen, wenn es ‘neue‘ triftige Gründe, aber entsprechend den Kriterien des ‘Altgesetzes‘, in der Sachlage gibt Eine juristisch bedenkliche Situation, die eine Fa- milienregelung vor Gericht zum Lotteriespiel macht.“, VÄTERAUFBRUCH FÜR KINDER E.V.; www.lokalseiten.de/wuppertal).
Der Artikels kritisiert, dass sowohl in Gerichten als auch in Jugendämtern der Schritt vom alten zum neuen Gesetz bislang nicht zufriedenstellend gelungen ist.
4. Schwerpunkte des neuen Kindschaftsrechts
Wie bereits eingangs erwähnt, werden nicht alle gesetzlichen Änderungen des neuen Kindschaftsrechts erörtert. Änderungen im Minderjährigenhaftungsbeschränkungsgesetz, Unterhaltsrecht, Erbrecht oder auch Betreuungsrechtsänderungsgesetz bleiben daher unberührt oder werden lediglich am Rande erwähnt.
4.1 Gleichstellung ehelicher und nichtehelicher Kinder
Im BGB existiert kein Paragraf, der die Gleichstellung ehelicher und nichtehelicher Kinder explizit thematisiert. Vielmehr sind Abschnitte wie die elterliche Sorge, das Kindesunter- haltsgesetz, das Beistandschaftsgesetz, das Abstammungsrecht, das Erbrechtsgleichstellungs- gesetz oder das Namensrecht insoweit verändert worden, als sie nunmehr im Gegensatz zum alten Kindschaftsrecht nicht mehr zwischen ehelicher und nichtehelicher Geburt differenzie- ren.
Wie bereits in Kapitel 2.3 angesprochen, bestand aufgrund einiger Urteile des Bundesverfas- sungsgerichts ein Handlungsbedarf bezüglich einiger Gesetzestexte im Kindschaftsrecht. Die rechtliche Ungleichbehandlung von ehelichen und nichtehelichen Kindern stellte dagegen einen Widerspruch dem Grundgesetz gegenüber dar (Artikel 6, Abs.5 GG: „Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen ... zu schaffen wie den eheli- chen Kindern.“).
Der Gesetzgeber wollte durch Änderungen in den o.a. Rechtsgebieten erreichen, dass diese Ungleichbehandlung abgeschafft wird. Insbesondere das alte Amtspflegschaftsgesetz, wonach man nichtehelichen Kindern pauschal einen Amtspfleger für bestimmte Aufgabenbereiche zuteilte (§§ 1706ff. BGB alte Fassung), wurde als diskriminierende Regelung aufgefasst (vgl. MÜNDER 1998, 15).
Mit dem Wegfall der Ungleichbehandlung wurden Teile des BGB schlichtweg aufgehoben. Dazu gehörten der sechste Titel „Elterliche Sorge für nichteheliche Kinder“ und der achte Titel „Legitimation nichtehelicher Kinder“ des Vierten Buches des BGB.
4.1.1 Elterliche Sorge
Bis zum 30.6.1970 standen nichteheliche Kinder zunächst per se unter staatlicher Vormund- schaft (vgl. MÜNDER 1998, 15). Daraus kann man schließen, dass Eltern in verschiedenen das Kind betreffenden Bereichen wie Umgang und Erziehung eine für sie unbefriedigende Recht- stellung innehatten.
Erst ab dem 1.7.1970 erhielt die Mutter das Sorgerecht, das oftmals allerdings durch die Amtspflegschaft, die die bis dato eintretende Vormundschaft ablöste, eingeschränkt war. Die Amtspflegschaft erstreckte sich auf Aufgabengebiete wie die Feststellung der Vaterschaft sowie Unterhalts-, Erb- und Pflichtteilsangelegenheiten (§§ 1706ff. BGB alte Fassung). Der Mutter blieb einzig die Aufgabe der Erziehung des Kindes. Unbestritten ist allerdings, dass dieser staatliche Eingriff eine Beschneidung der elterlichen Sorge und somit der Erziehung des Kindes darstellte.
Die Rechtsposition des Vaters war noch schwächer. Über den Umgang mit seinem (nichtehe- lichen) Kind konnte die Mutter bzw. musste das Vormundschaftsgericht entscheiden (vgl. SCHIMKE 1998, 28). Diese Tatsache verstieß allerdings gegen Artikel 6, Abs.2 GG: „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen ob- liegende Pflicht (...).“
Demnach hat auch der uneheliche Vater das Recht und die Pflicht auf Umgang mit dem Kind, da der Umgang einen wichtigen Bestandteil der Erziehung darstellt.
Nach neuem Recht erhält nunmehr die Mutter die volle elterliche Sorge (§ 1626a, Abs.2 BGB) für das nichteheliche Kind. Allerdings ist es jetzt möglich, dass unverheirateten Eltern die gemeinsame elterliche Sorge zugesprochen wird. Hierzu genügt ein schriftlicher Antrag, der bereits vor der Geburt gestellt werden kann (§ 1626a, Abs.1 BGB). Durch die Einführung des Antrags wollte der Gesetzgeber erreichen, dass die gemeinsame Sorge nicht gegen den Willen eines Elternteils besteht. Dies entspräche nicht dem Wohl des Kindes, da Konflikte vorprogrammiert wären (vgl. SCHIMKE 1998, 29).
Das neue Kindschaftsrecht beseitigt mit Hilfe der benannten Regelungen nicht nur die Diskriminierungen gegenüber Eltern und nichtehelichen Kindern, sondern schafft auch Bezug zur Realität, was die zunehmende Anzahl an ehelosen Partnerschaften und nichtehelichen Kindern anbetrifft (s. Kap.2.1).
4.1.2 Abstammungsrecht
Auch beim Abstammungsrecht wurde vorher zwischen ehelichen und nichtehelichen Kindern unterschieden. Daneben gab es in der alten Fassung ebenso wie im Rechtsbereich der elterlichen Sorge diskriminierende Tendenzen.
So konnte beispielsweise die Ehelichkeit eines Kindes nur vom Vater angefochten werden (vgl. MÜNDER 1998, 10f.). Inzwischen ist zwar die Vaterschaftsanerkennung von der Zustimmung der Mutter abhängig (§ 1595 Abs.1 BGB), doch dies war nach altem Recht nicht der Fall. Hier ist die Rechtsstellung der Mutter gestärkt worden.
Geregelt ist die Abstammung in den §§ 1591-1600 BGB. Die Vereinheitlichung der ehelichen und nichtehelichen Kinder hat dazu geführt, dass das Abstammungsrecht Mutter und Vater folgendermaßen definiert:
§ 1591 BGB:
„ Mutter eines Kindes ist die Frau, die das Kind geboren hat. “
§ 1592 BGB:
„ Vater eines Kindes ist der Mann,
1. der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist,
2. der die Vaterschaft anerkennt oder
3. dessen Vaterschaft nach § 1600d gerichtlich festgestellt ist. “
Die Definition zur Mutter schließt bereits moderne Fortpflanzungstechniken mit ein und bezieht zu Themen wie der Leihmutterschaft klar Stellung.
Allerdings hat der Ehemann einer Mutter die Möglichkeit, die Vaterschaft bei einer einver- nehmlich durchgeführten künstlichen Befruchtung seiner Frau anzufechten, was zu unterhalts- und erbrechtlichen Problemen führen würde. Dieses Anfechtungsrecht hätte der Gesetzgeber im Zuge der Kindschaftsrechtsreform ausschließen müssen, weil es nicht im Interesse des Wohls des Kindes liegt (vgl. SCHIMKE 1998, 22).
Abgesehen von dieser „Schwäche“ wird die neue gesetzliche Regelung zur Vaterschaft künftig voraussichtlich viele aufwendige und kostspielige Vaterschaftsfeststellungen vermeiden helfen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn schon vor der Geburt ein Scheidungsantrag anhängig ist und der neue Partner der Mutter die Vaterschaft binnen eines Jahres nach dem Scheidungsurteil anerkennt und sowohl Mutter als auch der (geschiedene) Ehemann zustimmen. Das Kind wird dem neuen Partner zugeordnet (§ 1599 BGB).
4.1.3 Namensrecht
Das Namensrecht ist ein Teil der elterlichen Sorge, da die Sorgeberechtigten den Namen bestimmen können. Im Gegensatz zu anderen Teilgebieten des neuen Kindschaftsrechts hat sich im Namensrecht relativ wenig geändert. Die Unterscheidung zwischen ehelichen und nichtehelichen Kindern wird hier ebenfalls nicht mehr vorgenommen.
Das Kind nimmt den Namen der Eltern an, bzw. im Regelfall den Namen desjenigen Elternteils, der die alleinige elterliche Sorge hat. Sind die Eltern gemeinsam sorgeberechtigt, führen aber keinen gemeinsamen Ehenamen, dann kann der Name des Vaters oder der Mutter zum Geburtsnamen des Kindes bestimmt werden (§ 1617a BGB).
Gesetzt den Fall, dass sich die Eltern nicht innerhalb eines Monats auf einen Namen für das Kind einigen können, überträgt das Familiengericht das Entscheidungsrecht auf ein Elternteil. Doppelnamen aus beiden Namen können nicht gebildet werden. (vgl. BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ et al. (Hrsg.) 1999, 22).
Bei alleiniger Sorge der Mutter kann das Kind auch nach dem Vater benannt werden, falls dieser sein Einverständnis gibt und ein dementsprechender Antrag gestellt wird. Da die wesentlichen Grundzüge des Namensrechts erhalten blieben, sind diesbezüglich keine großen Änderungen zu erwarten.
Prinzipielle Ziele der Kindschaftsrechtsreform haben nunmehr auch im Namensrecht ihren Niederschlag gefunden. Die Unterscheidung zwischen ehelichen und nichtehelichen Kindern fällt weg, das Namensrecht gestaltet sich im Großen und Ganzen übersichtlicher und einfa- cher und unverheirateten Eltern wurde per Gesetz ein erweiterter „rechtlicher Spielraum“ zu- gesprochen.
4.2 Recht der elterlichen Sorge
Der Terminus elterliche Sorge erfuhr aufgrund der Stärkung des Kindeswohls und dem Ziel, das elterliche Verantwortungsbewusstsein zu erhöhen, eine inhaltliche Wandlung, die sich in der Änderung des Begriffes niederschlug. Nach der Kindschaftsrechtsreform von 1980 wurde der Begriff „elterliche Gewalt“ durch „elterliche Sorge“ ersetzt.
Dieses Kapitel befasst sich mit den weiteren grundlegenden Aspekten des Sorgerechts, die noch nicht in den Erörterungen zur Gleichstellung ehelicher und nichtehelicher Kinder erwähnt wurden. Erwähnung finden die allgemeine Konzeption der elterlichen Sorge, die elterliche Sorge nach Fällen von Trennung und Scheidung, das Beistandschaftsgesetz und das Umgangsrecht. Andere die Sorge betreffende Gesetze bleiben unberührt
Der Gesetzgeber schuf durch den § 1697a BGB eine Art Leitfaden für das Handeln bezüglich der elterlichen Sorge, indem er das Wohl des Kindes in den Vordergrund stellte. Die Gerichte haben Entscheidungen zu treffen, die dem Wohl des Kindes am besten entsprechen. Dies kann man auch, obwohl nicht explizit aufgeführt, auf alle anderen Beteiligten (Jugendhilfe, Eltern usw.) beziehen.
4.2.1 Inhaltliche und allgemeine Aspekte
Geregelt ist die elterliche Sorge in den §§ 1626-1704 BGB. § 1626 BGB besagt, dass „die Eltern die Pflicht und das Recht haben, für das minderjährige Kind zu sorgen (elterliche Sorge)“. An dieser Stelle hat eine Änderung der Reihenfolge von Recht und Pflicht zu Pflicht und Recht stattgefunden, um die elterliche Verantwortung für das Wohl des Kindes hervorzuheben. Außerdem macht sich hier ebenfalls eine rechtliche Gleichstellung bemerkbar. War vorher noch von Vater und Mutter die Rede, so heißt es nunmehr Eltern.
Des weiteren besagt selbiger Paragraf, dass die elterliche Sorge zum einen aus der Personen und zum anderen aus der Vermögenssorge besteht. Daneben sind sorgeberechtigte Personen zugleich gesetzliche Vertreter des Kindes (§ 1629 BGB), wobei diese Tatsache keine wesentliche Änderung darstellt.
§ 1631 BGB geht näher auf die Personensorge ein, deren Aufgabengebiete für die Eltern die Bereiche Pflege, Erziehung, Beaufsichtigung und Aufenthaltsbestimmung umfassen. Ferner wird hier den Forderungen der verschiedenen Initiativen (Kinderschutzbund, Parteien...) nachgekommen, „entwürdigende Erziehungsmaßnahmen“ als unzulässig zu beschreiben. Al- lerdings hat der Gesetzgeber keine exakte Beschreibung solcher Unzulässigkeiten aufgeführt, was insbesondere SCHIMKE bedauert, der ein „absolutes Gewaltverbot“ favorisiert (ebd. 1998, 27). Auf der anderen Seite würde ein „Verbotskatalog“ wahrscheinlich ebenfalls vielerlei Fragen und Probleme aufwerfen, denn die Grenzen zwischen „würdigen“ und „entwürdigenden“ Erziehungsmaßnahmen sind erfahrungsgemäß äußerst dehnbar.
§ 1631 BGB besagt außerdem, dass der Staat in Form des Familiengerichts den Eltern auf Antrag in geeigneten Fällen der Personensorge Unterstützung zuteil werden lassen muss. Bezüglich der Vermögenssorge gab es keine grundlegenden Veränderungen. Lediglich einige bürokratische Vorschriften wurden gestrichen, welche durch eine Klausel in § 1666 Abs.2 BGB ersetzt wurden: „In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn der Inhaber der Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder seine mit der Vermögenssorge verbundenen Pflichten verletzt (...).“
Solche Verletzungen rechtfertigen staatliche Eingriffe in das Sorgerecht (vgl. ebd. 1998, 27).
4.2.2 Elterliche Sorge nach Trennung und Scheidung
Die Diskussion um die Fortsetzung der elterlichen Sorge nach Trennung oder Scheidung war ein zentraler Streitpunkt in der Kindschaftsrechtsreformdebatte und artete teilweise in einen Geschlechterkampf aus. Interessenverbände der Mütter wollten das alte Recht unter gleichzeitiger Zulassung der gemeinsamen Sorge beibehalten, während Initiativen geschiedener Väter die Fortführung der gemeinsamen Sorge zum Ziel hatten. (vgl. ebd. 1998, 33). In der folgenden Tabelle sind die zentralen Aspekte der elterlichen Sorge bei Trennung bzw. Scheidung schlagwortartig gegenübergestellt.
Abb.1: Elterliche Sorge nach Trennung und Scheidung (Quelle: eigene Darstellung)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nach altem Recht wurde im Scheidungsfalle das Sorgerecht automatisch auf ein Elternteil, de facto war dies meist die Mutter, übertragen (§ 1671 Abs.1 BGB alte Fassung: „Wird die Ehe der Eltern geschieden, so bestimmt das Familiengericht, welchem Elternteil die elterliche Sorge für ein gemeinschaftliches Kind zustehen soll.“).
Nach einer Trennung galten die gleichen Bestimmungen wie in der alten Fassung des § 1671 BGB mit der Ausnahme, dass das Familiengericht nur auf Antrag eingeschaltet wurde. Für nichteheliche Eltern galt das Gesetz nicht, da nach altem Recht keine gemeinsame Sorge möglich war.
Der Staat wurde in Form des Jugendamtes und des Familiengerichts automatisch nach dem Scheidungsprozess aktiv. In einem anhängigen Verfahren wurde die Alleinsorge einem El- ternteil zugesprochen. Das Familiengericht fungierte als Schiedsrichter und sollte herausfin- den, bei welchem Elternteil das Kind am besten aufgehoben war. Es sollte nach der für das Kind am wenigsten schädliche Alternative gesucht werden. Das Jugendamt wurde hierbei zu Stellungnahmen gebeten.
Dem alten Recht lag ein antiquiertes Verständnis von Ehe als gesellschaftlicher Lebensform zugrunde. Mit der Scheidung galt nicht nur die Ehe als beendet, es wurde auch das Kindes- wohl als gefährdet betrachtet. Man nahm an, dass das nach einer Scheidung auftretende Kon- fliktpotential keine akzeptable Fortführung der gemeinsamen Sorge möglich mache. Inzwi- schen geht man davon aus, dass „viele Eltern in der Lage sind, ihre Konflikte, die sie als Paar ausgetragen haben, von ihrer Elternschaft zu trennen“ (BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ et al. (Hrsg.) 1999, 14). Eine Trennung oder Scheidung stellt nicht mehr das Ende der Familie, son- dern lediglich eine „Neuordnung partnerschaftlicher Beziehungen“ (SCHIMKE 1998, 31) dar.
Die wichtigste Änderung durch das neue Gesetz ist, dass die gemeinsame Sorge nach Trennung oder Scheidung zunächst erhalten bleibt.
Die Beantragung der alleinigen Sorge ist erst dann möglich, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Erstens muss die Alleinsorge dem Wohl des Kindes entsprechen und zweitens muss der andere Elternteil dem Antrag zustimmen (§ 1671 BGB).
Im neuen Kindschaftsrecht wird nun nicht mehr zwischen ehelich und nichtehelich sowie Trennung und Scheidung unterschieden. Nach neuem Recht wird von „Eltern“ gesprochen, die „nicht nur vorübergehend getrennt leben“ (§ 1671 BGB).
Das Konzept des neuen Rechts besagt nicht, dass die gemeinsame Sorge nach Trennung oder Scheidung der alleinigen Sorge vorzuziehen ist oder umgekehrt. Vielmehr steckt die Absicht dahinter, Einvernehmen zwischen den Beteiligten zu erzielen, die staatliche Intervention und die damit einhergehende Zwangsentscheidung, die unter anderem als Ursache für weitere Streitigkeiten galt, einzuschränken (vgl. MÜNDER 1998, 34) und somit Konflikte zu vermei- den. Letzten Endes dienen die Ziele dem Wohl des Kindes, was dessen Subjektstellung in der Rechtsprechung verstärkt.
Um auf das Einvernehmen aller Beteiligten bezüglich der Fortführung der elterlichen Sorge hinzuwirken, wandelte sich die Rolle des Gerichts vom Schiedsrichter zum Berater. Der Staat desorganisiert nun nicht mehr die Familienverhältnisse, sondern will helfen, diese zu reorganisieren (vgl. SCHIMKE 1998, 31).
In der Praxis könnte ein Scheidungsfall folgendermaßen verlaufen: Die Eltern eines Kindes lassen sich scheiden. Das Familiengericht informiert das Jugendamt, welches die Pflicht hat, die Eltern unter anderem bezüglich des Sorge- und des Umgangsrechts zu beraten. Sie können sich auch an andere Beratungsstellen (z.B. kirchliche Träger...) wenden.
An dieser Stelle bleibt die Frage unbeantwortet, wie weit die gerichtliche Umsetzung des neu- en Rechts schon fortgeschritten ist. Der VÄTERAUFBRUCH FÜR KINDER E.V. kritisiert die (im- mer noch) fehlende Gleichberechtigung und die ihrer Meinung nach zu oft vorkommende Übertragung der Alleinsorge auf die Mütter („Es gibt zunehmend Anwälte, die der Mandan- tenschaft raten, ‘Streit‘ zu produzieren. Es gibt heute schon ‘Ratschläge‘ seitens Vertreterin- nen eines Alleinerziehendenverbandes und einer AnwältInnenvereinigung, wie frau streitig und unkooperativ in Familienrechtsfällen auftreten sollte, um Kinder, Geld, Wohnung und Alleinsorge zu erhalten.“, www.lokalseiten.de/wuppertal). Demnach ist es in der Praxis der Gerichtsbarkeit trotz des neuen Rechts zu elterlichen Sorge bezüglich Trennung und Schei- dung für eine Frau relativ leicht möglich, die Alleinsorge zu erhalten. Wenn dieses Problem tatsächlich in der Form existieren würde, bliebe die Frage offen, ob die Ursache dafür in der Rechtsprechung oder im Gesetz selber liegt.
Bleibt die gemeinsame Sorge bestehen, regelt § 1687 die Entscheidungsbefugnisse getrennt lebender Eltern. Es wird zwischen zwei Arten von Angelegenheiten unterschieden:
1. Angelegenheiten, deren Regelungen für das Kind von erheblicher Bedeutung sind, erfor- dern Einvernehmen und Absprache beider Eltern.
Beispiel: Die Entscheidung, auf welche weiterführende Schule ein Kind geschickt wird, müssen beide Elternteile einvernehmlich treffen. Eine solche Entscheidung beeinflusst den weiteren Lebensweg des Kindes und ist somit schwer abänderbar.
2. Angelegenheiten des täglichen Lebens kann der Elternteil treffen, bei dem sich das Kind meistens aufhält. Kriterien für diese Art Angelegenheiten sind Häufigkeit und Abänder- barkeit.
Beispiel: Die Frage, ob ein Kind in einen Sportverein eintreten darf, kann von einem Elternteil alleine beantwortet werden. Das Kind kann jederzeit wieder austreten, so dass die Entscheidung abänderbar ist.
Diese beiden Entscheidungsrechtsangelegenheiten sollen die Erziehung des Kindes für den Elternteil erleichtern, bei dem sich das Kind gewöhnlich aufhält. Es muss demnach nicht bei jeder „Kleinigkeit“ Rücksprache mit dem anderen Sorgerechtsinhaber gehalten werden. Werden sich Eltern bei einer Entscheidung von erheblicher Bedeutung partout nicht einig, muss notfalls das Familiengericht die alleinige Entscheidungsbefugnis in dem Punkt auf ein
Elternteil übertragen.
Abb.2: Urteil: Eltern auch nach Trennung Eltern (Quelle: Neue Westfälische, 11.11.1999)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Künftig wird mit einem Anstieg des Erhalts der elterlichen Sorge zu rechnen sein. Inzwischen hat annähernd jedes fünfte Elternpaar nach der Schei- dung die gemeinsame Sorge behalten (vgl. BUN- DESMINISTERIUM DER JUSTIZ et al. (Hrsg.) 1999, 14).
Der nebenstehende Artikel veranschaulicht ein Beispiel für die gerichtliche Anwendung des Rechts der elterlichen Sorge nach einer Trennung. Das Wohl des Kindes hat letztendlich den Aus- schlag für die gerichtliche Entscheidung gegeben.
4.2.3 Beistandschaftsgesetz
Das neue Beistandschaftsgesetz, das in den §§ 1712-1717 BGB geregelt ist, ersetzt die gesetz- liche Amtspflegschaft (§§ 1705-1710 BGB alte Fassung) und das alte Beistandschaftsgesetz (§§ 1685, 1686, 1689-1692 BGB alte Fassung). Damit ist im Zuge der Gleichstellung eheli- cher und nichtehelicher Kinder der komplette sechste Titel des Vierten Buches „Elterliche Sorge für nichteheliche Kinder“ aufgehoben worden. Deshalb ist das Beistandschaftsgesetz nunmehr in allen Fällen alleiniger elterlicher Sorge von Bedeutung (vgl. MÜNDER 1998, 25).
Der Hauptunterschied im Vergleich zur alten Rechtsprechung liegt darin, dass die Beistandschaft dem sorgeberechtigten Elternteil nicht mehr „aufgezwungen“ wird, sondern dass sie nur noch auf schriftlichen Antrag des Sorgerechtsinhabers beim Jugendamt eintritt. Daher spricht man auch von freiwilliger Beistandschaft. Die alte Beistandschaft griff direkt in die elterliche Sorge ein und signalisierte eine „Klischeevorstellung der hilfebedürftigen jungen Mutter und des verantwortungslosen Vaters“ (SCHIMKE 1998, 56).
Die elterliche Sorge wird durch das neue Recht kaum noch eingeschränkt, da der Elternteil die Beistandschaft auch jederzeit wieder beenden kann. Das bedeutet einen Rückgang der staatli- chen Intervention sowie einen quantitativen Rückgang der „alten“ Aufgabenstellungen des Jugendamtes.
Des weiteren bedeutet die Freiwilligkeit einen zeitgemäßeren und realitätsbezogeneren Umgang mit der Beistandschaft. In den meisten Fällen alleiniger Sorge erkennt der Vater die Vaterschaft von sich aus an und leistet Unterhaltszahlungen. Andernfalls sind Mütter oftmals selbst in der Lage, sich um die Aufgabenbereiche des Beistandes zu kümmern.
Diese Aufgaben umfassen die Feststellung der Vaterschaft und in die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§ 1712 BGB). Neben dem Sorgeberechtigten ist der Beistand auch gleichberechtigter gesetzlicher Vertreter des Kindes. Da sowohl der alleinerziehende Eltern- teil als auch der Beistand dem Wohl des Kindes dienen, müssen sie in möglichst allen das Kind betreffenden Bereichen Konsens erzielen. Ist dies nicht möglich, kann der Elternteil die Beistandschaft beenden und sich theoretisch letztendlich durchsetzen, obwohl Elternteil und Beistand rechtlich gesehen gleichberechtigt nebeneinander stehen (vgl. MÜNDER 1998, 24ff.).
Die folgende Abbildung soll einen möglichen rechtlichen Ablauf veranschaulichen, in dem eine Mutter die alleinige Sorge für ein nichteheliches Kind hat.
Abb.3: Gesetzliche Regelungen zur freiwilligen Beistandschaft (Quelle: eigene Darstellung)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nach der Geburt des Kindes erhält die Mutter automatisch die alleinige Sorge nach § 1626a Abs.2 BGB. Das Jugendamt erfährt von der Geburt und ist nach § 52a KJHG verpflichtet, die Mutter zu beraten, zu unterstützen und ihr Hilfe anzubieten. Dabei geht es insbesondere um die Beistandschaft. Die dünne Linie symbolisiert eine mögliche Beistandschaftsbeantragung von Seiten der Mutter nach § 1713 BGB. Das Jugendamt ist verpflichtet, einen Beistand zu stellen, der den in § 1712 BGB beschriebenen Aufgabengebieten nachkommt.
Die Beratungs- und Unterstützungspflicht des § 52a KJHG sorgt für eine wesentliche Neue- rung in der Jugendhilfe: Sie wird künftig dienstleistungsorientierter arbeiten müssen, um für ihre Beistandsleistung zu „werben“ (vgl. MÜNDER 1998, 26). Verstärkt wird diese Tatsache dadurch, dass die Beistandschaft jederzeit beantragt und ebenso beendet werden kann. Die Beistandschaft hat durch das neue Recht einen mehr sozialpädagogischen als Eingriffscharak- ter (s. auch Kap.5).
4.2.4 Umgangsrecht
In Fällen von Trennung oder Scheidung war der festzulegende Umgang der Eltern mit dem Kind ein Hauptstreitpunkt zwischen den Beteiligten. Bei nichtehelichen Kindern entschied die Mutter über den Umgang. Gegen ihren Willen konnte der Vater nur gerichtlich vorgehen. Das alte Umgangsrecht bot daher viel Konfliktpotential, weil sich Väter unter anderem benachtei- ligt fühlten. Aber auch nach Festlegung der Umgangsmodalitäten war ein spannungsgelade- nes Verhältnis zwischen den Eltern zu verzeichnen. Nicht selten kam es vor, dass ein Elternteil den Umgang des Kindes mit dem anderen Elternteil vereitelte.
Die alte Regelung konnte als Recht der Eltern an ihrem Kind bezeichnet werden, wobei das Kind lediglich als „Zankapfel“ herhielt (vgl. SCHIMKE 1998, 38f.; vgl. MÜNDER 1998, 41).
An dieser Stelle hat mit der Kindschaftsrechtsreform ein grundlegender Perspektivenwechsel stattgefunden. Die Eltern haben nun nicht mehr das Recht auf Umgang mit dem Kind, son- dern das Kind hat das Recht auf Umgang mit beiden Elternteilen (§ 1684 Abs.1 BGB). Dabei spielt es keine Rolle, ob eine gemeinsame Sorge oder Alleinsorge besteht. Eine Trennung oder Scheidung weist für ein Kind schwerwiegende (entwicklungs-)psycho- logische Probleme auf. Es „braucht das Gefühl, nicht an dem Auseinandergehen der Eltern Schuld zu haben, die Sicherheit, nicht unversorgt oder allein gelassen zu sein, das Erleben, dass Mutter und Vater mit der neuen Situation klar kommen, die Freiheit, Mutter und Vater in gleichem Maße gern haben zu dürfen und zu beiden eine Beziehung pflegen zu können“ (www.kinderschutzbund-nrw.de/273.htm).
Ferner sagt § 1684 BGB, dass die Eltern nicht nur das Umgangsrecht, sondern auch die Umgangspflicht haben. Daneben haben sie dafür Sorge zu tragen, dass das Umgangsrecht des Kindes eingehalten wird, d.h. sie müssen alles unterlassen, was zu einer Beeinträchtigung des kindlichen Umgangsrechts beiträgt.
Das neue Kindschaftsrecht entspricht an dieser Stelle den Forderungen der UNKinderrechtskonvention, da die kindliche Subjektstellung in der Rechtsprechung gefördert wurde. Gemäß dem Aspekt participation kann das Kind in einer umgangsrechtlichen Verhandlung dem Gericht seine Beziehung zu den Eltern darstellen.
Der Jugendhilfe kommt erneut die Beraterrolle zu. Sie soll den Eltern bei der Umsetzung des Umgangsrecht Unterstützung zukommen lassen (§ 18 Abs.3 KJHG).
Eine weitere Änderung des Umgangsrechts wird in § 1685 BGB deutlich. Der Kreis der um- gangsberechtigten Personen erweitert sich um die Großeltern, Stiefeltern, Geschwister und Pflegeeltern.
Des weiteren gewährt das Gesetz dem Kind Schutz beim Umgang. Das Familiengericht kann gegebenenfalls anordnen, dass der Umgang nur mit „mitwirkungsbereiten Dritten“ stattfinden darf (§ 1684 Abs.4 BGB). Dritte können Träger der Jugendhilfe oder ein Verein sein. Prinzipiell gesehen will das neue Gesetz eine möglichst einvernehmliche Lösung herbeiführen. Erst in zweiter Konsequenz käme eine Entscheidung des Familiengerichts zum Tragen. Ein laufendes Verfahren kann ausgesetzt werden, wenn das Gericht erkennt, dass die Eltern sich entweder einigen oder beraten lassen.
5. Kindschaftsrecht und Jugendhilfe
In diesem Abschnitt sollen die bereits angesprochenen Aufgaben der Jugendhilfe nicht wiederholt, sondern lediglich ergänzt und akzentuiert werden.
OBERLOSKAMP hebt die Verknüpfung zwischen Jugendhilfe und Kindschaftsrecht hervor, indem sie sagt, dass „das Kindschaftsrecht über die Jugendhilfe hinaus in fast allen Gebieten der sozialen Arbeit Bedeutung hat“ (ebd. 1994, 9).
Das neue Kindschaftsrecht führt zu einer Verschiebung der Aufgaben der Jugendhilfe. Alte Aufgabenbereiche existieren nicht mehr, während sich neue Hilfemöglichkeiten eröffnen. Als klassische Betätigungsfelder der Jugendhilfe fielen die gesetzliche Amtspflegschaft und die Aufgaben, die sich aus der automatischen gerichtlichen Entscheidung über die elterliche Sorge bei Scheidungen ergaben, weg. Die Eingriffsmöglichkeiten der Jugendhilfe in familiäre Situationen sind rückläufig, weil sie von Ordnungsaufgaben befreit wurde. Stattdessen wird die Jugendhilfe unterstützungsfreudiger, dienstleistungs- und angebots- orientierter arbeiten müssen, um dem Bürger seine Sozialleistungen „anzubieten“ (vgl. MÜN- DER 1998, 68). Neben Beratungsaufgaben bezieht sich das insbesondere auf die freiwillige Beistandschaft.
Fachlich kompetente Beratung, Information und Unterstützung soll den „Kunden“ von der Klischeevorstellung abbringen, dass dieser von einer Behörde Jugendamt ausgeht, die „in überholten Über- und Unterordnungs-Verhältnissen gegenüber den Bürgern denkt“ (ebd. 1998, 65). Professionelles sozialpädagogisches Handeln steht nicht im Widerspruch zu einer kundenorientierten Arbeitsweise.
Unterstützend wirken muss die Jugendhilfe neben den Beistandschaftsaufgaben insbesondere dann, wenn sie als Verfahrenspfleger (§ 50 FGG) fungiert und die Interessen des Kindes gegenüber den Sorgeberechtigten vertritt.
Die Zusammenarbeit mit dem Gericht wird sich ebenfalls nachhaltig verändern. Das Famili- engericht soll auf die einvernehmliche Einigung der Eltern hinwirken. Weil Juristen für sol- che Aufgaben nicht zwangsläufig prädestiniert sind, könnte das Jugendamt das Familienge- richt unterstützen.
Wie schon an einigen Stellen erwähnt, hat das Umdenken Richtung Dienstleistungsorientie- rung und die Aufgabenverschiebung in der Jugendhilfe bislang noch nicht vollständig stattge- funden. Kritik wird beispielsweise an Jugendämtern geübt, in denen ab Freitagmittag niemand erreichbar zu sein scheint („Bis heute tragen staatliche Jugendämter dazu bei, dass Kinder ihre ‘Besuchs‘-Väter nicht sehen können, weil ‘begleiteter Umgang‘ in hochstrittigen Fällen nun mal am häufigsten am Wochenende anfällt, aber praktisch zu diesen Zeiten keine Unterstüt- zung erhält. Es gibt in Deutschland keinen ‘Familienservice‘ für alle Mitglieder einer zerbro- chenen Familie von Seiten der Jugendämter.“, www.lokalseiten.de/wuppertal). Nach Meinung des Vereins Väteraufbruch für Kinder ist weder der Perspektivenwechsel „Kindessicht“ noch die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in Gerichten oder Ju- gendämtern vollzogen („Auf den Fluren der Jugendämtern ist fast ausschließlich Frauen/ Mütter-Literatur zu sehen Vielfach sind Schreiben und Verhaltensweisen des Jugendamtes bekannt, die Mütter nichtehelicher Kinder vor der gemeinsamen Sorge warnen.“, ebd.).
Die hauptsächlichen Schwierigkeiten in der Umsetzung des neuen Kindschaftsrechts liegen wahrscheinlich darin, das Spannungsverhältnis zwischen professionellem Handeln, dem Schutz der Kinder und der Orientierung an den Interessen der Bürger angemessen zu bewältigen (vgl. MÜNDER 1998, 68).
Letzten Endes muss sich die Jugendhilfe jedoch bei kindschaftsrechtlichen Fällen am Wohl des Kindes ausrichten.
6. Resümée
Das neue Kindschaftsrecht hat den hervorgerufenen Reformbedarf zumindest formal aufge- griffen und abgedeckt. Die wichtigen gesetzlichen Änderungen zur Gleichstellung ehelicher und nichtehelicher Kinder, zum Umgangsrecht, zur elterlichen Sorge und zur Beistandschaft haben zur Gleichberechtigung, zum Wohl des Kindes und zum Perspektivwechsel „Kindes- sicht“ beigetragen.
Wie bereits erwähnt, kommt der Jugendhilfe von Gesetzes wegen eine verstärkte Beraterrolle zu. Hier liegen Chancen und Herausforderungen. Allerdings könnten sich auch Problemfelder öffnen. Oftmals wird Beratung von Gerichten „verordnet“. Beim Umgangsrecht zum Beispiel kann eine Verhandlung aufgrund einer Beratung der Eltern ausgesetzt werden. Es werden also die Gerichte den Eltern nahe legen, sich beraten zu lassen. Daraus könnte sich die problemati- sche Situation ergeben, dass die Eltern die Beratung als aufgezwungen empfinden. Die Frei- willigkeit kommt nicht an allen Stellen des neuen Kindschaftsrechts zum Tragen, wie dies bei der Beistandschaft der Fall ist. Allerdings ist sie ein wichtiges Beratungselement.
Es bleibt abzuwarten, inwieweit die komplette Umstellung auf die veränderten Aufgaben von Jugendhilfe und Staat aufgegriffen und bewältigt wird.
7. Anhang
7.1 Quellenverzeichnis
BECK, C.H. (HRSG.): Bürgerliches Gesetzbuch. München 1999
BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ/ BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND (HRSG.): Das neue Kindschaftsrecht - Fragen und Antworten zum Abstam- mungsrecht, zum Recht der elterlichen Sorge, zum Umgangsrecht, zum Namensrecht und zu den Neuregelungen im gerichtlichen Verfahren. Bonn 1999
BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND (HRSG.): Kinder- und Jugendhilfegesetz (Achtes Buch Sozialgesetzbuch). Bonn 1999
CD-Rom:
DEINERT, H.: Recht und Gesetz für den PC, Duisburg 1995 auf der CD-Rom: Canyon Digital Media GmbH: Pegasus - Vol.3, Unterhaching 1996
Internet:
www.lokalseiten.de/wuppertal/1999/07/9907020.html; 25.7.1999 (Aufsatz vom VÄTER- AUFBRUCH FÜR KINDER E.V.)
www.kinderschutzbund-nrw.de/273.htm; 13.1.2000 (Aufsatz vom DKSB)
www.gesichertesleben.de/archiv/recht/2056.html; 13.1.2000
MÜNDER, J.: Das neue Kindschaftsrecht - Kindschaftsrechtsreformgesetz, Beistand- schaftsgesetz. München 1998
OBERLOSKAMP, H.: Kindschaftsrechtliche Fälle für Studium und Praxis. Neuwied, Kriftel, Berlin 1994
SCHIMKE, H.: Das neue Kindschaftsrecht - Eine Einführung mit den wichtigsten Gesetzes- texten. Neuwied 1998
7.2 Abbildungsverzeichnis
Abb.1: Elterliche Sorge nach Trennung und Scheidung (eigene Darstellung)
Abb.2: Urteil: Eltern auch nach Trennung Eltern (Artikel aus der Tageszeitung NEUE WESTFÄLISCHE vom 11.11.1999)
Abb.3: Gesetzliche Regelungen zur freiwilligen Beistandschaft (eigene Darstellung)
7.3 Alte Gesetzestexte (Stand: 1995)
§ 1671. [Elterliche Sorge nach der Scheidung oder Nichtigerklärung der Ehe]
(1) Wird die Ehe der Eltern geschieden, so bestimmt das Familiengericht, welchem Elternteil die elterliche Sorge für ein gemeinschaftliches Kind zustehen soll.
(2) Das Gericht trifft die Regelung, die dem Wohle des Kindes am besten entspricht; hierbei sind die Bindungen des Kindes, insbesondere an seine Eltern und Geschwister, zu berücksichtigen.
(3) Von einem übereinstimmenden Vorschlag der Eltern soll das Gericht nur abweichen, wenn dies zum Wohle des Kindes erforderlich ist. Macht ein Kind, welches das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat, einen abwei- chenden Vorschlag, so entscheidet das Gericht nach Absatz 2.
(4) Die elterliche Sorge ist einem Elternteil allein zu übertragen. Erfordern es die Vermögensinteressen des Kindes, so kann die Vermögenssorge ganz oder teilweise dem anderen Elternteil übertragen werden.
(5) Das Gericht kann die Personensorge und die Vermögenssorge einem Vormund oder Pfleger übertragen, wenn dies erforderlich ist, um eine Gefahr für das Wohl des Kindes abzuwenden. Es soll dem Kind für die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen einen Pfleger bestellen, wenn dies zum Wohle des Kindes er- forderlich ist.
(6) Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend, wenn die Ehe der Eltern für nichtig erklärt worden ist.
§ 1672. [Elterliche Sorge bei Getrenntleben der Eltern]
Leben die Eltern nicht nur vorübergehend getrennt, so gilt § 1671 Abs. 1 bis 5 entsprechend. Das Gericht entscheidet auf Antrag eines Elternteils; es entscheidet von Amts wegen, wenn andernfalls das Wohl des Kindes gefährdet wäre und die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden.
§ 1685 [Beistandschaft]
(1) Das Vormundschaftsgericht hat dem Elternteil, dem die elterliche Sorge, die Personensorge oder die Ver- mögenssorge allein zusteht, auf seinen Antrag einen Beistand zu bestellen.
(2) Der Beistand kann für alle Angelegenheiten, für gewisse Arten von Angelegenheiten oder für einzelne An- gelegenheiten bestellt werden.
§ 1686. [Aufgaben des Beistandes]
Der Beistand hat innerhalb seines Wirkungskreises den Vater oder die Mutter bei der Ausübung der elterlichen Sorge zu unterstützen.
§ 1690. [Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Vermögenssorge]
(1) Das Vormundschaftsgericht kann auf Antrag des Vaters oder der Mutter dem Beistande die Geltendma- chung von Unterhaltsansprüchen und die Vermögenssorge übertragen; die Vermögenssorge kann auch teil- weise übertragen werden.
(2) Der Beistand hat, soweit das Vormundschaftsgericht eine Übertragung vornimmt, die Rechte und Pflichten eines Pflegers. Er soll in diesen Angelegenheiten mit dem Elternteil, dem er bestellt ist, Fühlung nehmen.
Sechster Titel. Elterliche Sorge für nichteheliche Kinder
§ 1705. [Grundsatz]
Das nichteheliche Kind steht, solange es minderjährig ist, unter der elterlichen Sorge der Mutter. Die Vorschriften über die elterliche Sorge für eheliche Kinder gelten im Verhältnis zwischen dem nichtehelichen Kinde und seiner Mutter entsprechend, soweit sich nicht aus den Vorschriften dieses Titels ein anderes ergibt.
§ 1706. [Amtspfleger]
Das Kind erhält, sofern es nicht eines Vormunds bedarf, für die Wahrnehmung der folgenden Angelegenheiten einen Pfleger:
1. für die Feststellung der Vaterschaft und alle sonstigen Angelegenheiten, die die Feststellung oder Änderung des Eltern-Kindes-Verhältnisses oder des Familiennamens des Kindes betreffen,
2. für die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen einschließlich der Ansprüche auf eine an Stelle des Un- terhalts zu gewährende Abfindung sowie die Verfügung über diese Ansprüche; ist das Kind bei einem Drit- ten entgeltlich in Pflege, so ist der Pfleger berechtigt, aus dem vom Unterhaltspflichtigen Geleisteten den Dritten zu befriedigen,
3. die Regelung von Erb- und Pflichtteilsrechten, die dem Kind im Falle des Todes des Vaters und seiner Ver- wandten zustehen.
§ 1707. [Ausnahmen von der Pflegschaft]
Auf Antrag der Mutter hat das Vormundschaftsgericht
1. anzuordnen, dass die Pflegschaft nicht eintritt,
2. die Pflegschaft aufzuheben oder
3. den Wirkungskreis des Pflegers zu beschränken.
Dem Antrag ist zu entsprechen, wenn die beantragte Anordnung dem Wohle des Kindes nicht widerspricht. Das Vormundschaftsgericht kann seine Entscheidung ändern, wenn dies zum Wohle des Kindes erforderlich ist.
§ 1708. [Bestellung eines Pflegers vor der Geburt]
Schon vor der Geburt des Kindes kann das Vormundschaftsgericht zur Wahrnehmung der in § 1706 genannten Angelegenheiten einen Pfleger bestellen. Die Bestellung wird mit der Geburt des Kindes wirksam.
§ 1709. [Jugendamt als Amtspfleger]
Mit der Geburt eines nichtehelichen Kindes wird das Jugendamt Pfleger für die Wahrnehmung der in § 1706 bezeichneten Angelegenheiten, wenn das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat und nach § 1705 unter der ehelichen Sorge der Mutter steht. Dies gilt nicht, wenn bereits vor der Geburt des Kindes ein Pfleger bestellt oder angeordnet ist, dass eine Pflegschaft nicht eintritt, oder wenn das Kind eines Vormunds bedarf. § 1791c Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 gilt entsprechend.
§ 1710. [Vormund für nichteheliche Kinder]
Steht ein nichteheliches Kind unter Vormundschaft und endet die Vormundschaft kraft Gesetzes, so wird der bisherige Vormund Pfleger nach § 1706, sofern die Voraussetzungen für die Pflegschaft vorliegen.
§ 1711. [Umgangsrecht]
(1) Derjenige, dem die Personensorge für das Kind zusteht, bestimmt den Umgang des Kindes mit dem Vater. § 1634 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(2) Wenn ein persönlicher Umgang mit dem Vater dem Wohle des Kindes dient, kann das Vormundschaftsge- richt entscheiden, dass dem Vater die Befugnis zum persönlichen Umgang zusteht. § 1634 Abs. 2 gilt ent- sprechend. Das Vormundschaftsgericht kann seine Entscheidung jederzeit ändern.
(3) Die Befugnis, Auskunft Über die persönlichen Verhältnisse des Kindes zu verlangen, bestimmt § 1634 Abs. 3.
(4) In geeigneten Fällen soll das Jugendamt zwischen dem Vater und dem Sorgeberechtigten vermitteln.
7.4 Aktuelle Gesetzestexte (Stand: 1999)
7.4.1 Auszüge aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch
§ 1591. [Mutterschaft]
Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat.
§ 1592. [Vaterschaft]
Vater eines Kindes ist der Mann,
1. der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist,
2. der die Vaterschaft anerkannt hat oder
3. dessen Vaterschaft nach § 1600d gerichtlich festgestellt ist.
§ 1600. [Anfechtungsberechtigte]
Berechtigt, die Vaterschaft anzufechten, sind der Mann, dessen Vaterschaft nach § 1592 Nr.1 und 2, § 1593 besteht, die Mutter und das Kind.
§ 1617. [Geburtsname bei Eltern ohne Ehenamen, bei gemeinsamer Sorge]
(1) Führen die Eltern keinen Ehenamen und steht ihnen die Sorge gemeinsam zu, so bestimmen sie durch Erklä- rung gegenüber dem Standesbeamten den Namen, den der Vater oder die Mutter zur Zeit der Erklärung führt, zum Geburtsnamen des Kindes. Eine nach der Beurkundung der Geburt abgegebene Erklärung muss öffentlich beglaubigt werden. Die Bestimmung der Eltern gilt auch für ihre weiteren Kinder.
(2) Treffen die Eltern binnen eines Monats nach der Geburt des Kindes keine Bestimmung, überträgt das Fami- liengericht das Bestimmungsrecht einem Elternteil. Absatz 1 gilt dementsprechend. Das Gericht kann dem Elternteil für die Ausübung des Bestimmungsrechts eine Frist setzen. Ist nach Ablauf der Frist das Bestim- mungsrecht nicht ausgeübt worden, so erhält das Kind den Namen des Elternteils, dem das Bestimmungs- recht übertragen ist.
(3) Ist ein Kind nicht im Inland geboren, so überträgt das Gericht einem Elternteil das Bestimmungsrecht nach Absatz 2 nur dann, wenn ein Elternteil oder das Kind dies beantragt oder die Eintragung des Namens des Kindes in ein deutsches Personenstandsbuch oder in ein amtliches deutsches Identitätspapier erforderlich wird.
§ 1617a. [Geburtsname bei Eltern ohne Ehenamen und gemeinsame Sorge}
(1) Führen die Eltern keinen Ehenamen und steht die elterliche Sorge nur einem Elternteil zu, so erhält das Kind den Namen, de dieser Elternteil im Zeitpunkt der Geburt des Kindes führt.
(2) Der Elternteil, dem die elterliche Sorge für ein unverheiratetes Kind allein zusteht, kann dem Kind durch Erklärung gegenüber dem Standesbeamten den Namen des anderen Elternteils erteilen. Die Erteilung des Namens bedarf der Einwilligung des anderen Elternteils und, wenn das Kind das fünfte Lebensjahr vollen- det hat, auch der Einwilligung des Kindes. Die Erklärungen müssen öffentlich beglaubigt werden. Für die Einwilligung des Kindes gilt § 1617c Abs.1 entsprechend.
§ 1626. [Elterliche Sorge, Grundsätze]
(1) Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen (elterliche Sorge). Die elterliche Sorge umfasst die Sorge für die Person des Kindes (Personensorge) und das Vermögen des Kin- des.
(2) Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende Fähigkeit und das wachsende Be- dürfnis des Kindes zu selbständigem verantwortungsbewusstem Handeln. Sie besprechen mit dem Kind, soweit es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und streben Einver- nehmen an.
(3) Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen. Gleiches gilt für den Um- gang mit anderen Personen, zu denen das Kind Bindungen besitzt, wenn ihre Aufrechterhaltung für seine Entwicklung förderlich ist.
§ 1626a. [Gemeinsame elterliche Sorge durch Sorgeerklärungen]
(1) Sind die Eltern bei der Geburt des Kindes nicht miteinander verheiratet, so steht ihnen die elterliche Sorge dann gemeinsam zu, wenn sie
1. erklären, dass sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen (Sorgeerklärungen), oder
2. einander heiraten.
(2) Im übrigen hat die Mutter die elterliche Sorge
§ 1627. [Ausübung der elterlichen Sorge]
Die Eltern haben die elterliche Sorge in eigener Verantwortung und in gegenseitigem Einvernehmen zum Wohle des Kindes auszuüben. Bei Meinungsverschiedenheiten müssen sie versuchen, sich zu einigen.
§ 1629. [Gesetzliche Vertretung]
(1) Die elterliche Sorge umfasst die Vertretung des Kindes. Die Eltern vertreten das Kind gemeinschaftlich; ist eine Willenserklärung gegenüber dem Kind abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber einem Elternteil. Ein Elternteil vertritt das Kind allein, soweit er die elterliche Sorge allein ausübt oder ihm die Entscheidung nach § 1628 übertragen ist. Bei Gefahr im Verzug ist jeder Elternteil dazu berechtigt, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes notwendig sind; der andere Elternteil ist unverzüglich zu unterrich- ten.
(2) Der Vater und die Mutter können das Kind insoweit nicht vertreten, als nach § 1795 ein Vormund von der Vertretung des Kindes ausgeschlossen ist. Steht die elterliche Sorge für ein Kind den Eltern gemeinsam zu, so kann der Elternteil, in dessen Obhut sich das Kind befindet, Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil geltend machen. Das Familiengericht kann dem Vater und der Mutter nach § 1796 die Vertretung entziehen; dies gilt nicht für die Feststellung der Vaterschaft.
(3) Sind die Eltern des Kindes miteinander verheiratet, so kann ein Elternteil, solange die Eltern getrennt leben oder eine Ehesache zwischen ihnen anhängig ist, Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Eltern- teil nur im eigenen Namen geltend machen. Eine von einem Elternteil erwirkte gerichtliche Entscheidung und ein zwischen Eltern geschlossener gerichtlicher Vergleich wirken auch für und gegen das Kind.
§ 1630. [Bestellung eines Pflegers; Familienpflege]
(1) Die elterliche Sorge erstreckt sich nicht auf Angelegenheiten des Kindes, für die ein Pfleger bestellt ist.
(2) Steht die Personensorge oder die Vermögenssorge einem Pfleger zu, so entscheidet das Familiengericht, falls sich die Eltern und der Pfleger in einer Angelegenheit nicht einigen können, die sowohl die Person als auch das Vermögen des Kindes betrifft.
(3) Geben die Eltern das Kind für längere Zeit in Familienpflege, so kann das Familiengericht auf Antrag der Eltern oder der Pflegeperson Angelegenheiten der elterlichen Sorge auf die Pflegeperson übertragen. Für die Übertragung auf Antrag der Pflegeperson ist die Zustimmung der Eltern erforderlich. Im Umfang der Übertragung hat die Pflegeperson die Rechte und Pflichten eines Pflegers.
§ 1631. [Inhalt der Personensorge; Verbot entwürdigender Maßnahmen; Unterstützung der Eltern]
(1) Die Personensorge umfasst insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen.
(2) Entwürdigende Erziehungsmaßnahmen, insbesondere körperliche und seelische Misshandlungen, sind unzu- lässig.
(3) Das Familiengericht hat die Eltern auf Antrag bei der Ausübung der Personensorge in geeigneten Fällen zu unterstützen.
§ 1666. [Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls]
(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen durch missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes, durch unverschuldetes Versagen der Eltern oder durch das Verhalten eines Dritten gefährdet, so hat das Familiengericht, wenn die Eltern nicht gewillt oder in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden, die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Maß- nahmen zu treffen.
(2) In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn der Inhaber der Vermö- genssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder seine mit der Vermögenssorge verbundenen Pflichten verletzt oder Anordnungen des Gerichts, die sich auf die Vermögenssorge beziehen, nicht befolgt.
(3) Das Gericht kann Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge ersetzen.
(4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung gegen einen Dritten treffen.
§ 1671. [Übertragung de Alleinsorge nach bisheriger gemeinsamer elterlicher Sorge bei Getrenntleben der Eltern]
(1) Leben Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, nicht nur vorübergehend getrennt, so kann jeder Elternteil beantragen, dass ihm das Familiengericht die elterliche Sorge oder einen Teil der elterlichen Sorge allein überträgt.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben, soweit
1. der anderer Elternteil zustimmt, es sei denn, dass das Kind das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat und der Übertragung widerspricht, oder
2. zu erwarten ist, dass die Aufhebung der gemeinsamen Sorge und die Übertragung auf den Antragsteller dem Wohl des Kindes am besten entspricht.
(3) Dem Antrag ist nicht stattzugeben, soweit die elterliche Sorge auf Grund anderer Vorschriften abweichend geregelt werden muss.
§ 1684. [Umgangsrecht von Kind und Eltern]
(1) Das Kind hat das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil; jeder Elternteil ist zum Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt.
(2) Die Eltern haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum jeweils anderen Elternteil beein- trächtigt oder die Erziehung erschwert. Entsprechendes gilt, wenn sich das Kind in der Obhut einer anderen Person befindet.
(3) Das Familiengericht kann über den Umfang des Umgangsrechts entscheiden und seine Ausübung, auch gegenüber Dritten, näher regeln. Es kann die Beteiligten durch Anordnungen zur Erfüllung der in Absatz 2 geregelten Pflicht anhalten.
(4) Das Familiengericht kann das Umgangsrecht oder den Vollzug früherer Entscheidungen über das Umgangs- recht einschränken oder ausschließen, soweit dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. Eine Entscheidung, die das Umgangsrecht oder seinen Vollzug für längere Zeit oder auf Dauer einschränkt oder ausschließt, kann nur ergehen, wenn andernfalls das Wohl des Kindes gefährdet wäre. Das Familiengericht kann insbe- sondere anordnen, dass der Umgang nur stattfinden darf, wenn ein mitwirkungsbereiter Dritter anwesend ist. Dritter kann auch ein Träger der Jugendhilfe oder ein Verein sein; dieser bestimmt dann jeweils, welche Einzelpersonen die Aufgabe wahrnimmt.
§ 1685. [Umgangsrecht anderer Bezugspersonen]
(1) Großeltern und Geschwister haben ein Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn dieser dem Wohl des Kindes dient.
(2) Gleiches gilt für den Ehegatten oder früheren Ehegatten eines Elternteils, der mit dem Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft gelebt hat, und für Personen, bei denen das Kind längere Zeit in Familienpflege war.
(3) § 1684 Abs.2 bis 4 gilt entsprechend.
§ 1687. [Entscheidungsrecht bei gemeinsamer elterlicher Sorge getrennt lebender Eltern]
(1) Leben Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, nicht nur vorübergehend getrennt, so ist bei Entscheidungen in Angelegenheiten, deren Regelung für das Kind von erheblicher Bedeutung ist, ihr gegen- seitiges Einvernehmen erforderlich. Der Elternteil, bei dem sich das Kind mit Einwilligung des anderen El- ternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich aufhält, hat die Befugnis zur alleini- gen Entscheidung in Angelegenheiten des täglichen Lebens. Entscheidungen in Angelegenheiten des tägli- chen Lebens sind in der Regel solche, die häufig vorkommen und die keine schwer abzuändernden Auswir- kungen auf die Entwicklung des Kindes haben. Solange sich das Kind mit Einwilligung dieses Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung bei dem anderen Elternteil aufhält, hat dieser die Befugnis zur alleinigen Entscheidung in Angelegenheiten der tatsächlichen Betreuung. § 1629 Abs.1 Satz 4 und § 1684 Abs.2 Satz gelten dementsprechend.
(2) Das Familiengericht kann die Befugnisse nach Absatz 1 Satz 2 und 4 einschränken oder ausschließen, wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist.
§ 1697. [Anordnung von Vormundschaft oder Pflegschaft durch das Familiengericht]
Ist auf Grund einer Maßnahme des Familiengerichts eine Vormundschaft oder Pflegschaft anzuordnen, so kann das Familiengericht auch diese Anordnungen treffen und den Vormund oder Pfleger auswählen.
§ 1687a. [Kindeswohl als allgemeines Prinzip]
Soweit nicht anderes bestimmt ist, trifft das Gericht in Verfahren über die in diesem Titel geregelten Angelegenheiten diejenige Entscheidung, die unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten sowie der berechtigten Interessen der Beteiligten dem Wohl des Kindes am besten entspricht.
§ 1712. [Gegenstand der Beistandschaft; Antragserfordernis]
(1) Auf schriftlichen Antrag eines Elternteils wird das Jugendamt Beistand des Kindes für folgende Aufgaben:
1. die Feststellung der Vaterschaft,
2. die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen einschließlich der Ansprüche auf eine Stelle des Unterhalts zu gewährende Abfindung sowie die Verfügung über diese Ansprüche; ist das Kind bei einem Dritten ent- geltlich in Pflege, so ist der Beistand berechtigt, aus dem vom Unterhaltspflichtigen Geleisteten den Dritten zu befriedigen.
(2) Der Antrag kann auf einzelne der in Absatz 1 bezeichneten Aufgaben beschränkt werden.
§ 1713. [Befugnis zur Antragstellung]
(1) Den Antrag kann ein Elternteil stellen, dem für den Aufgabenkreis der beantragten Beistandschaft die allei- nige elterliche Sorge zusteht oder zustünde, wenn das Kind bereits geboren wäre. Der Antrag kann auch von einem nach § 1776 berufenen Vormund gestellt werden. Er kann nicht durch einen Vertreter gestellt wer- den.
(2) Vor der Geburt des Kindes kann die werdende Mutter den Antrag auch dann stellen, wenn das Kind, sofern es bereits geboren wäre, unter Vormundschaft stünde. Ist de werdende Mutter in der Geschäftsfähigkeit be- schränkt, so kann sie den Antrag nur selbst stellen; sie bedarf hierzu nicht der Zustimmung ihres gesetzli- chen Vertreters. Für eine geschäftsunfähige werdende Mutter kann nur ihr gesetzlicher Vertreter den Antrag stellen.
§ 1714. [Eintritt der Beistandschaft]
Die Beistandschaft tritt ein, sobald der Antrag dem Jugendamt zugeht. Dies gilt auch, wenn der Antrag vor der Geburt des Kindes gestellt wird.
§ 1715. [Beendigung der Beistandschaft]
(1) Die Beistandschaft endet, wenn der Antragsteller dies schriftlich verlangt. § 1712 Abs. 2 und § 1714 gelten entsprechend.
(2) Die Beistandschaft endet auch, sobald der Antragsteller keine der in § 1713 genannten Voraussetzungen mehr erfüllt.
§ 1716. [Wirkungen der Beistandschaft]
Durch die Beistandschaft wird die elterliche Sorge nicht eingeschränkt. Im übrigen gelten die Vorschriften über die Pflegschaft mit Ausnahme derjenigen über die Aufsicht des Vormundschaftsgerichts und die Rechnungslegung sinngemäß; die §§ 1791, 1791c Abs. 3 sind nicht anzuwenden.
7.4.2 Auszüge aus sonstigen Gesetzestexten
Artikel 6 Grundgesetz
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderem Schutze der staatlichen Ordnung.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.
(5) Den nichtehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen.
§ 18 KJHG. [Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge]
(1) Mütter und Väter, die allein ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen, haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge einschließlich der Geltendmachung von Unterhalts- oder Unterhaltsersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen. Ein jun- ger Volljähriger hat bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhalts- oder Unterhaltsersatzansprüchen.
(2) Ist anzunehmen, dass ein Kind nichtehelich geboren wird, so hat die Mutter einen Anspruch darauf, das vor der Geburt die Feststellung der Vaterschaft durch geeignete Ermittlungen und sonstige Maßnahmen vorbe- reitet wird; dies gilt nicht wenn mit dieser Aufgabe ein Pfleger für das noch nicht geborene Kind betraut ist oder wenn das Vormundschaftsgericht angeordnet hat, dass eine Pflegschaft nicht eintritt
(3) Die Mutter eines nichtehelichen Kindes hat Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Geltendma- chung ihrer Ansprüche auf Erstattung der Entbindungskosten nach § 1615 k und auf Unterhalt nach § 1615 l des Bürgerlichen Gesetzbuchs
(4) Mütter und Väter, denen die elterliche Sorge nicht zusteht, haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts. Bei der Herstellung von Besuchskontakten und beider Ausführung gerichtlicher oder vereinbarte Umgangsregelungen soll in geeigneten Fällen Hilfestellung geleistet werden.
§ 52a. [Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsan- sprüchen]
(1) Das Jugendamt hat unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind, der Mutter Beratung und Unterstützung insbesondere bei der Vaterschaftsfeststellung und der Gel- tendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes anzubieten. Hierbei hat es hinzuweisen auf
1. die Bedeutung der Vaterschaftsfeststellung,
2. die Möglichkeiten, wie die Vaterschaft festgestellt werden kann, insbesondere bei welchen Stellen die Va- terschaft anerkannt werden kann,
3. die Möglichkeit, die Verpflichtung zur Erfüllung von Unterhaltsansprüchen oder zur Leistung einer an Stelle des Unterhalts zu gewährenden Abfindung nach § 59 Abs.1 Satz 1 Nr.3 beurkunden zu lassen,
4. die Möglichkeit, eine Beistandschaft zu beantragen, sowie auf die Rechtsfolgen einer solchen Beistand- schaft,
5. die Möglichkeit der gemeinsamen Sorge. Das Jugendamt hat der Mutter ein persönliches Gespräch anzubie- ten. Das Gespräch soll in der Regel in der persönlichen Umgebung der Mutter stattfinden, wenn diese es wünscht.
(2) Das Angebot nach Absatz 1 kann vor der Geburt des Kindes erfolgen, wenn anzunehmen ist, dass seine Eltern bei der Geburt nicht miteinander verheiratet sein werden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kindschaftsrecht?
Das Kindschaftsrecht ist der Teil des Familienrechts, der sich mit den Rechtsbeziehungen zwischen Eltern und Kindern beschäftigt. Es regelt Bereiche wie Abstammung, Unterhaltspflicht, elterliche Sorge, Umgangsrecht und Beistandschaft.
Warum wurde das Kindschaftsrecht reformiert?
Die Reform des Kindschaftsrechts war notwendig aufgrund von sozialem Wandel (Individualisierung, Pluralisierung), der UN-Kinderrechtskonvention und Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes, die Teile des alten Rechts außer Kraft setzten.
Welche Ziele verfolgt das neue Kindschaftsrecht?
Zentrale Ziele sind die Stärkung des Kindeswohls, die Stärkung der Rechtsposition der Eltern, die Gleichstellung ehelicher und nichtehelicher Kinder, die Vereinfachung des Rechts und die Beseitigung von Rechtsunsicherheiten.
Was bedeutet die Gleichstellung ehelicher und nichtehelicher Kinder im neuen Kindschaftsrecht?
Die Gleichstellung bedeutet, dass es keine rechtliche Unterscheidung mehr zwischen ehelichen und nichtehelichen Kindern in Bezug auf elterliche Sorge, Abstammungsrecht und Namensrecht gibt. Nicht-verheiratete Eltern können nun beispielsweise auch die gemeinsame elterliche Sorge beantragen.
Was sind die wesentlichen Änderungen im Recht der elterlichen Sorge?
Die "elterliche Gewalt" wurde durch "elterliche Sorge" ersetzt. Das Wohl des Kindes steht im Vordergrund. Bei Trennung oder Scheidung bleibt die gemeinsame Sorge zunächst erhalten. Entwürdigende Erziehungsmaßnahmen sind unzulässig.
Was ändert sich an der elterlichen Sorge nach Trennung oder Scheidung?
Nach dem neuen Recht bleibt die gemeinsame Sorge nach Trennung oder Scheidung grundsätzlich erhalten. Die Beantragung der alleinigen Sorge ist nur möglich, wenn sie dem Wohl des Kindes entspricht und der andere Elternteil zustimmt.
Was ist das Beistandschaftsgesetz und wie hat es sich geändert?
Das neue Beistandschaftsgesetz ersetzt die frühere Amtspflegschaft. Die Beistandschaft erfolgt nur noch auf schriftlichen Antrag des sorgeberechtigten Elternteils beim Jugendamt (freiwillige Beistandschaft). Der Staat greift weniger in die elterliche Sorge ein.
Was ist das Umgangsrecht und wie hat es sich geändert?
Nicht die Eltern haben das Recht auf Umgang mit dem Kind, sondern das Kind hat das Recht auf Umgang mit beiden Elternteilen. Eltern haben nicht nur ein Umgangsrecht, sondern auch eine Umgangspflicht. Der Kreis der umgangsberechtigten Personen wurde erweitert (Großeltern, Geschwister etc.).
Welche Rolle spielt die Jugendhilfe im neuen Kindschaftsrecht?
Die Jugendhilfe übernimmt eine verstärkte Beraterrolle. Sie unterstützt Eltern bei der Umsetzung des Umgangsrechts und in Beistandschaftsangelegenheiten. Sie soll unterstützungsfreudiger und dienstleistungsorientierter arbeiten.
Welche Kritik gibt es am neuen Kindschaftsrecht?
Kritisiert wird unter anderem, dass die Umstellung auf die veränderten Aufgaben der Jugendhilfe noch nicht vollständig stattgefunden hat und dass die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in Gerichten und Jugendämtern nicht immer gewährleistet ist.
Was ist die Bedeutung von § 1697a BGB?
§ 1697a BGB stellt das Wohl des Kindes in den Vordergrund und dient als Leitfaden für das Handeln bezüglich der elterlichen Sorge.
Wer ist Vater eines Kindes nach § 1592 BGB?
Vater eines Kindes ist der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter verheiratet ist, der die Vaterschaft anerkennt oder dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt wurde.
Welche Rechte haben Großeltern und Geschwister im Bezug auf das Umgangsrecht?
Großeltern und Geschwister haben ein Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn dieser dem Wohl des Kindes dient (§ 1685 BGB).
Was regelt § 1687 BGB?
§ 1687 BGB regelt die Entscheidungsbefugnisse getrennt lebender Eltern bei gemeinsamer elterlicher Sorge. Es wird zwischen Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung und Angelegenheiten des täglichen Lebens unterschieden.
- Citar trabajo
- Christoph Speck (Autor), 2000, Aspekte des neuen Kindschaftsrechts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106936