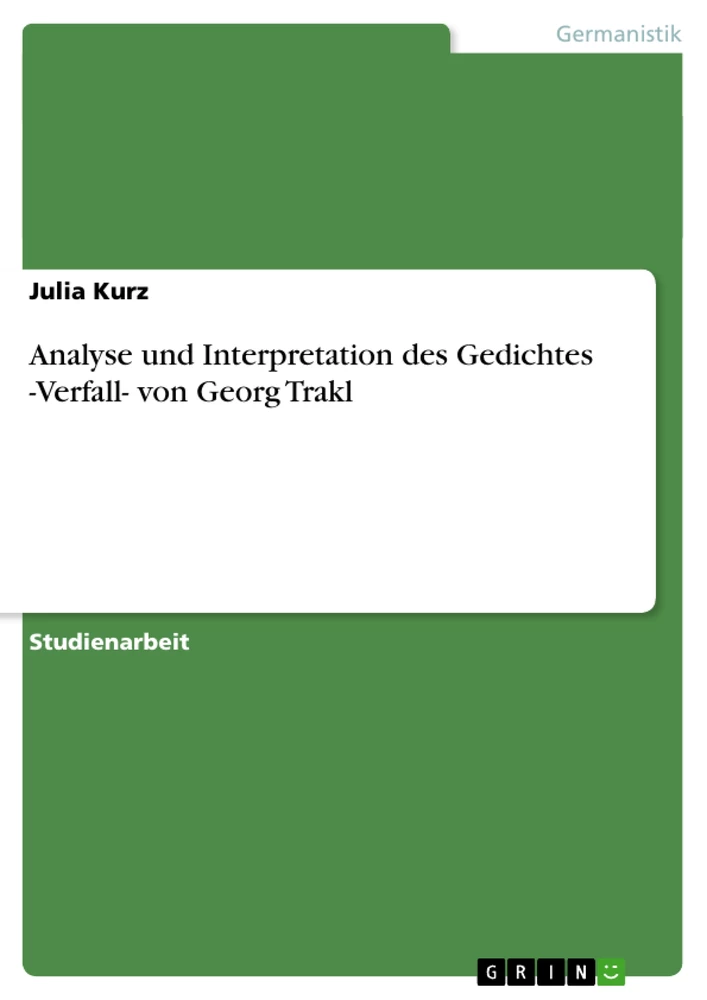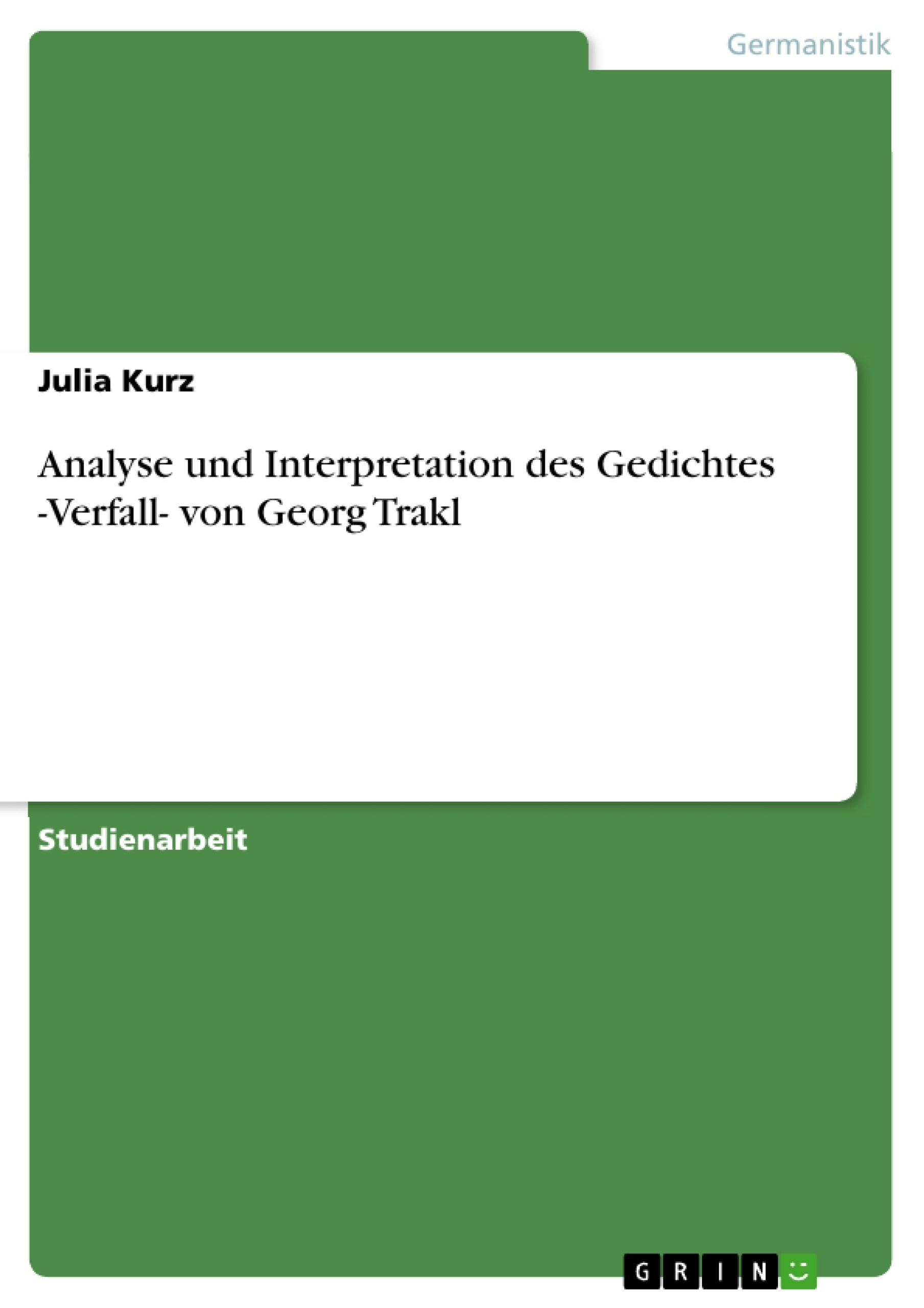Am 3. Februar 1887 wurde Georg Trakl in Salzburg als viertes von sechs Kindern geboren.
Sein Vater, Tobias Trakl, war Eisenhändler und mit seiner bereits zweiten Frau Maria
Catharina Trakl, geborene Halik verheiratet. Seine Jugend verbrachte Georg Trakl mit seiner
Familie in Salzburg. Dort besuchte er mit fünf Jahren zunächst die der katholischen
Lehrerbildungsanstalt angeschlossene Übungsschule und weitere fünf Jahre später, im Herbst
1897 kam Trakl auf das Staatsgymnasium. Dort mußte er die vierte Klasse wiederholen, aber
schon zu dieser Zeit schieb der junge Georg Trakl Gedichte und war Mitglied des Dichter-
Zirkels „Apollo“. Am Ende der siebten Klasse wurde Trakl wieder nicht versetzt und verließ
das Gymnasium, woraufhin ihn sein Vater für die Apothekerlaufbahn bestimmte. Nach der
Absolvierung eines dreijährigen Praktikums in der Apotheke „Zum weißen Engel“ in
Salzburg studierte er Pharmazie an der Universität in Wien. Im Herbst 1910 schloß er sein
Studium mit dem Gesamtprädikat „genügend“ als Magister der Pharmazie ab.
Schließlich ließ er sich als Militärmedikamentenbeamter aktivieren, arbeitete jedoch nur ein
halbes Jahr in der Apotheke des Garnisionsspitals in Innsbruck, dann hielt er die
Anstrengungen dieses Dienstes nicht mehr aus und ließ sich in die Reserve versetzen.
Daraufhin nahm ihn sein Freund Ludwig von Ficker, der Herausgeber des „Brenner“ - einer
Halbmonatszeitschrift in der einige von Trakls Gedichten veröffentlicht wurden - bei sich auf.
Nach einem dramatischen Erlebnis nach der Schlacht bei Grodek im August 1914, wo er in
seiner Verzweiflung versuchte sich selbst umzubringen wurde er im September in das
Garnisonsspital in Krakau zur Beobachtung des Geisteszustandes eingewiesen. Am Abend
des 3. Novembers 1914 starb Georg Trakl infolge einer Kokainvergiftung im Alter von 27
Jahren.2
2 Vgl. „Georg Trakl – Die Dichtungen“, 11. Auflage; Otto Müller Verlag Salzburg 1938 S. 5-7; und „Georg
Trakl – Das dichterische Werk“; DtV 1972; 16. Auflage 2001, S. 317-323.
Inhaltsverzeichnis
- Georg Trakl: Verfall
- Dichter und Daten
- Die Jahrhundertwende - Eine Zeit des Umbruchs
- Die Metrik des Gedichtes: Verfall
- Interpretation
- Vergleiche und Metaphern
- Weitere stilistische Mittel
- Schlußwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert und interpretiert Georg Trakls Gedicht "Verfall". Ziel ist es, das Gedicht im Kontext von Trakls Leben und der Epoche der Jahrhundertwende zu verstehen und seine stilistischen Mittel zu untersuchen.
- Biographischer Kontext von Georg Trakls Leben und Werk
- Stilistische Analyse des Gedichtes "Verfall"
- Interpretation der zentralen Motive und Symbole
- Der Einfluss der Jahrhundertwende auf Trakls Dichtung
- Verbindung zwischen Naturbeschreibung und innerem Zustand des lyrischen Ichs
Zusammenfassung der Kapitel
Georg Trakl: Verfall: Dieses Kapitel präsentiert den vollständigen Text des Gedichtes "Verfall" von Georg Trakl, welches im Mittelpunkt der gesamten Hausarbeit steht. Die scheinbar idyllische Naturbeschreibung des Abends und des Vogelzugs wird im Laufe des Gedichts durch Bilder des Verfalls und des Todes konterkariert. Dieser Kontrast bildet die Grundlage für die anschließende Analyse.
Dichter und Daten: Dieses Kapitel skizziert die wichtigsten biographischen Daten Georg Trakls. Es beschreibt seine Herkunft, seine Ausbildung, seine Schwierigkeiten im schulischen und beruflichen Bereich, seine Verbindung zur Literatur und seinen frühen Tod durch eine Kokainvergiftung. Diese Informationen schaffen einen Kontext für das Verständnis seiner Werke und seines düsteren Blicks auf die Welt.
Die Jahrhundertwende - eine Zeit des Umbruchs: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen und kulturellen Kontext, in dem Trakls Werk entstand. Es beschreibt die Jahrhundertwende als eine Zeit des Umbruchs und der Unsicherheit, die sich in Trakls Gedichten widerspiegelt. Die Analyse fokussiert sich auf den "Jugendstil" und seine Entwicklung, wobei der Garten als zentrales Motiv und seine symbolische Bedeutung für Trakls Werk erläutert werden. Der Übergang vom scheinbar heilen Garten zum verfallenden Garten spiegelt den Übergang von einer vermeintlich harmonischen zur zerfallenden Welt wider.
Schlüsselwörter
Georg Trakl, Verfall, Jahrhundertwende, Jugendstil, Symbolismus, Naturlyrik, Todesmotiv, Interpretation, Stilmittel, Biographischer Kontext.
Häufig gestellte Fragen zu Georg Trakls "Verfall"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit analysiert und interpretiert Georg Trakls Gedicht "Verfall". Sie untersucht das Gedicht im Kontext von Trakls Leben und der Epoche der Jahrhundertwende und analysiert dessen stilistische Mittel.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den biographischen Kontext von Georg Trakls Leben und Werk, eine stilistische Analyse des Gedichtes "Verfall", die Interpretation der zentralen Motive und Symbole, den Einfluss der Jahrhundertwende auf Trakls Dichtung und die Verbindung zwischen Naturbeschreibung und innerem Zustand des lyrischen Ichs.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit enthält Kapitel zu folgenden Themen: den vollständigen Text von "Verfall", die wichtigsten biographischen Daten Georg Trakls, die Jahrhundertwende als Zeit des Umbruchs, die Metrik des Gedichts, eine Interpretation des Gedichts, Vergleiche und Metaphern, weitere stilistische Mittel und ein Schlusswort.
Wie wird das Gedicht "Verfall" in der Hausarbeit behandelt?
Das Gedicht "Verfall" steht im Mittelpunkt der Arbeit. Es wird zunächst vollständig präsentiert und dann im Hinblick auf seine scheinbar idyllische Naturbeschreibung, die im Laufe des Gedichts durch Bilder des Verfalls und des Todes konterkariert wird, analysiert. Dieser Kontrast bildet die Grundlage der Analyse.
Welche Rolle spielt der biographische Kontext?
Die biographischen Daten Georg Trakls, einschließlich seiner Herkunft, Ausbildung, Schwierigkeiten und seines frühen Todes, schaffen einen Kontext für das Verständnis seines düsteren Blicks auf die Welt und seiner Werke.
Wie wird die Jahrhundertwende in der Hausarbeit behandelt?
Die Jahrhundertwende wird als Zeit des Umbruchs und der Unsicherheit beschrieben, die sich in Trakls Gedichten widerspiegelt. Die Analyse konzentriert sich auf den Jugendstil und seine Entwicklung, wobei der Garten als zentrales Motiv und seine symbolische Bedeutung für Trakls Werk erläutert wird. Der Übergang vom heilen zum verfallenden Garten symbolisiert den Übergang von einer vermeintlich harmonischen zur zerfallenden Welt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Georg Trakl, Verfall, Jahrhundertwende, Jugendstil, Symbolismus, Naturlyrik, Todesmotiv, Interpretation, Stilmittel, Biographischer Kontext.
Welche Art von Analyse wird durchgeführt?
Die Hausarbeit beinhaltet eine stilistische Analyse des Gedichts "Verfall", die Interpretation der zentralen Motive und Symbole, sowie eine Betrachtung des Einflusses der Jahrhundertwende auf Trakls Dichtung.
Welches ist das zentrale Motiv des Gedichts?
Ein zentrales Motiv des Gedichts ist der Kontrast zwischen einer scheinbar idyllischen Naturbeschreibung und Bildern des Verfalls und des Todes.
- Citar trabajo
- Julia Kurz (Autor), 2001, Analyse und Interpretation des Gedichtes -Verfall- von Georg Trakl, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10700