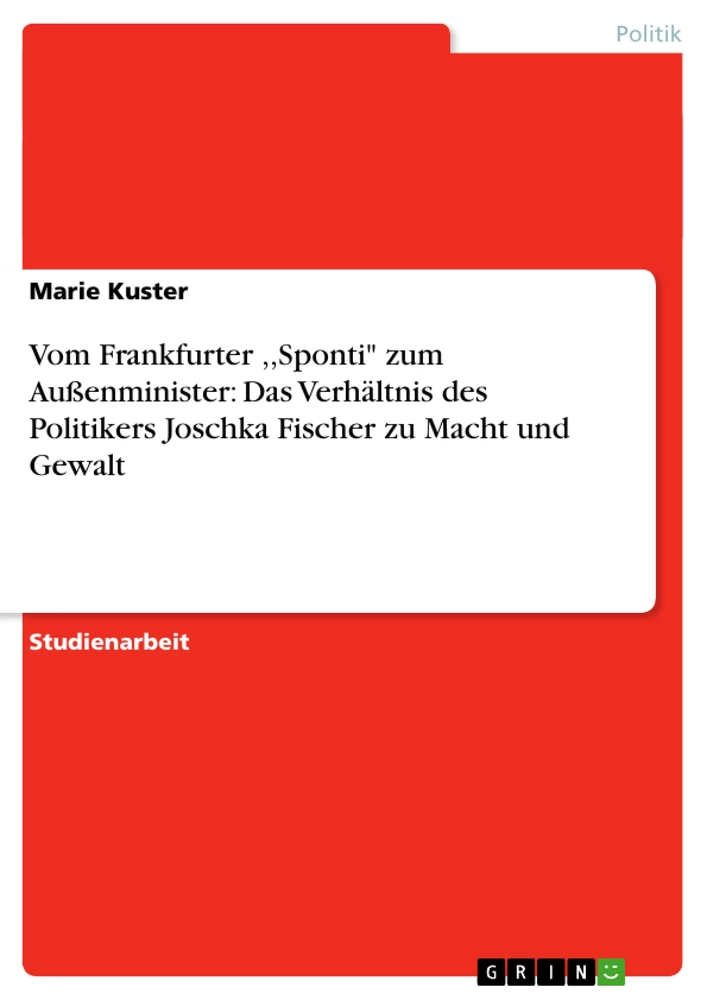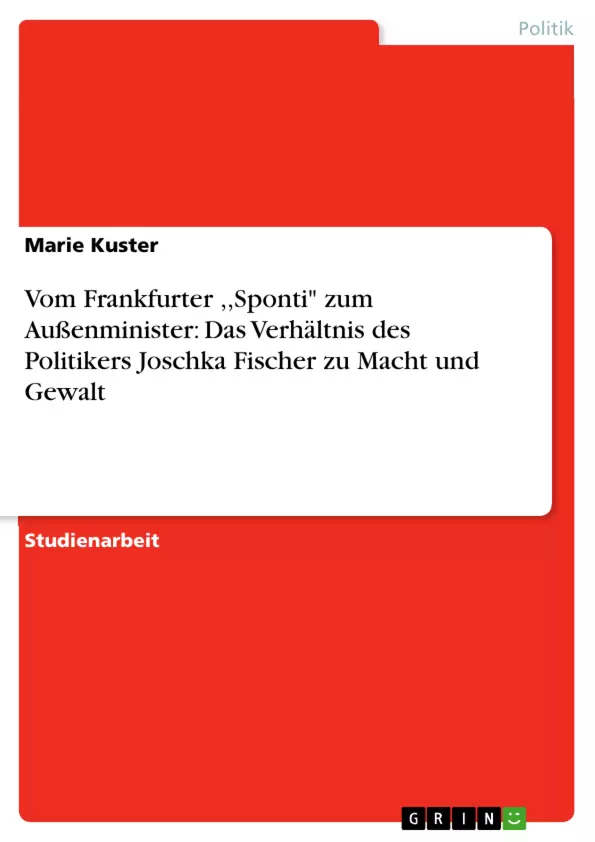Bundesaußenminister und Vizekanzler Joschka Fischer steht zur Zeit der Abfassung
dieser Arbeit aufgrund seiner systemoppositionellen Vergangenheit in den
70er Jahren unter massivem innenpolitischen Druck: Nahezu täglich kommen neue
Vermutungen über Fischers Beteiligung an gewaltsamen Aktionen auf, die Rede
ist von einem Untersuchungsausschuß, und sogar ein Ermittlungsverfahren wegen
Falschaussage ist eingeleitet worden. Dies ist Thema in überregionalen Print- und
Rundfunkmedien.
Weniger Berücksichtigung in der Öffentlichkeit finden hingegen die jüngst publik
gewordenen Erkenntnisse über Fischers Rolle beim Krieg der NATO gegen Jugoslawien,
den beispielsweise der CDU-Bundestagsabgeordnete Willy Wimmer einen
„ordinären Angriffskrieg“1 nennt und der mit „offenkundigen Unwahrheiten“2 und
Lügen „in unvorstellbarem Ausmaß“3 legitimiert worden zu sein scheint. Dieser
Sachverhalt steht in krassem Widerspruch zu den Gründen, die auch von Fischer
für den Krieg vorgebracht worden sind.
Interessant erscheint daher, sich mit Fischers Verhältnis zu zwei Phänomenen auseinanderzusetzen,
zu denen er in seinem Leben schon zwei sehr unterschiedliche
Auffassungen vertreten hat: (Staats-)Macht und Gewalt. Was bewog Fischer in
den 70er Jahren, die Staatsmacht zu bekämpfen und gegen den Staat gerichtete
Gewalt zumindest nicht prinzipiell zu verdammen, wie kam der Umschwung zustande,
der darin endete, daß Fischer als Außenminister staatliche Macht und Gewalt
gegen einen anderen Staat ausgeübt hat?
Der Begriff „Gewalt“ wird hier verstanden als Zufügung körperlicher Schmerzen.
Ausübender von Gewalt kann daher theoretisch jeder Mensch sein, verantwortlich
für die Ausübung von Gewalt aber auch jemand, der ohne negative Konsequenzen
für sich selbst anderen die Ausübung von Gewalt gegen andere Menschen befehlen
kann.
Der Begriff „Macht“ wird hier verstanden als Möglichkeit, Gewalt gegen andere
Menschen auszuüben oder zu befehlen, ohne Sanktionen befürchten zu müssen.
1 Zit. nach: „Von Konkret“ (Editorial), in: Konkret Nr. 3/2001, S. 4.
2 Hamburger Abendblatt, zit. nach: ebd.
3 Die Presse, zit. nach: ebd.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fischers Vergangenheit und die öffentliche Auseinandersetzung damit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis des Politikers Joschka Fischer zu Macht und Gewalt, insbesondere im Kontext seiner systemoppositionellen Vergangenheit in den 1970er Jahren und seiner späteren Rolle als Bundesaußenminister. Die Analyse beleuchtet den Wandel seiner Positionen und die öffentliche Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit.
- Fischers Beteiligung an gewaltsamen Aktionen in den 1970er Jahren
- Der Wandel von Fischers Haltung zu Macht und Gewalt
- Die öffentliche Debatte um Fischers Vergangenheit im Kontext seiner politischen Karriere
- Die Diskrepanz zwischen Fischers früherer Ablehnung staatlicher Gewalt und seiner späteren Ausübung derselben als Außenminister
- Die Rolle der Medien in der öffentlichen Wahrnehmung von Fischers Vergangenheit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die aktuelle innenpolitische Situation um Joschka Fischer im Jahr 2001 dar, geprägt von Kontroversen über seine Beteiligung an gewaltsamen Aktionen in den 1970er Jahren und seine Rolle im NATO-Krieg gegen Jugoslawien. Die Arbeit untersucht Fischers wechselndes Verhältnis zu Macht und Gewalt, von seiner systemoppositionellen Vergangenheit bis hin zu seiner Tätigkeit als Außenminister, und fragt nach den Ursachen dieses Wandels. Der Begriff "Gewalt" wird definiert als die Zufügung körperlicher Schmerzen, während "Macht" als die Möglichkeit definiert wird, Gewalt auszuüben oder zu befehlen, ohne Sanktionen zu befürchten.
Fischers Vergangenheit und die öffentliche Auseinandersetzung damit: Dieses Kapitel beschreibt ausführlich Fischers Jugend und seinen Weg in die Frankfurter Sponti-Szene der 1970er Jahre. Es schildert seine Beteiligung an Hausbesetzungen, Straßenkämpfen und anderen Aktionen der außerparlamentarischen Opposition, inklusive eines Vorfalls, bei dem er einen Polizisten schlug. Das Kapitel analysiert Fischers Rolle in der Frankfurter Studentenbewegung und die Entwicklung seiner politischen Ansichten. Die zunehmende öffentliche Auseinandersetzung mit Fischers Vergangenheit im Jahr 2001, ausgelöst durch Zeugenaussagen und Medienberichte, wird detailliert dargestellt. Die öffentlichen Reaktionen und die Frage nach der Vereinbarkeit von Fischers Vergangenheit mit seinem Amt als Außenminister werden beleuchtet. Das Kapitel zeichnet ein umfassendes Bild von Fischers Engagement in der linksextremen Szene und den damit verbundenen Gewalttaten, bevor er seine politische Karriere startete. Seine Entwicklung von einem militanten Aktivisten zu einem einflussreichen Politiker wird eingehend betrachtet, wobei sowohl seine eigenen Aussagen als auch Zeitzeugenberichte berücksichtigt werden.
Schlüsselwörter
Joschka Fischer, Macht, Gewalt, Sponti-Szene, Studentenbewegung, 1970er Jahre, NATO-Krieg gegen Jugoslawien, öffentliche Auseinandersetzung, politische Karriere, Systemopposition, Wandel der politischen Positionen, Militanz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Joschka Fischer - Macht, Gewalt und politische Karriere
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Verhältnis des ehemaligen deutschen Außenministers Joschka Fischer zu Macht und Gewalt, insbesondere im Kontext seiner systemoppositionellen Vergangenheit in den 1970er Jahren und seiner späteren politischen Karriere. Sie untersucht den Wandel seiner Positionen und die öffentliche Auseinandersetzung damit.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet Fischers Beteiligung an gewaltsamen Aktionen in den 1970er Jahren, den Wandel seiner Haltung zu Macht und Gewalt, die öffentliche Debatte um seine Vergangenheit, die Diskrepanz zwischen seiner früheren Ablehnung staatlicher Gewalt und seiner späteren Ausübung derselben als Außenminister, sowie die Rolle der Medien in der öffentlichen Wahrnehmung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel über Fischers Vergangenheit und die öffentliche Auseinandersetzung damit, sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter. Die Einleitung beschreibt die politische Situation um Fischer im Jahr 2001 und definiert die Begriffe "Gewalt" und "Macht". Das Hauptkapitel beschreibt detailliert Fischers Jugend, seine Beteiligung an Aktionen der außerparlamentarischen Opposition, und die öffentliche Debatte um seine Vergangenheit im Jahr 2001.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Fischers eigene Aussagen, Zeitzeugenberichte und Medienberichte, um ein umfassendes Bild von Fischers Engagement in der linksextremen Szene und seiner politischen Entwicklung zu zeichnen.
Welche Definitionen von "Gewalt" und "Macht" werden verwendet?
Gewalt wird definiert als die Zufügung körperlicher Schmerzen. Macht wird definiert als die Möglichkeit, Gewalt auszuüben oder zu befehlen, ohne Sanktionen zu befürchten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Joschka Fischer, Macht, Gewalt, Sponti-Szene, Studentenbewegung, 1970er Jahre, NATO-Krieg gegen Jugoslawien, öffentliche Auseinandersetzung, politische Karriere, Systemopposition, Wandel der politischen Positionen, Militanz.
Was ist der Fokus des Kapitels über Fischers Vergangenheit?
Das Kapitel beschreibt detailliert Fischers Weg in die Frankfurter Sponti-Szene, seine Beteiligung an Hausbesetzungen und Straßenkämpfen, inklusive eines Vorfalls, bei dem er einen Polizisten schlug. Es analysiert seine Rolle in der Studentenbewegung und die Entwicklung seiner politischen Ansichten, sowie die zunehmende öffentliche Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit im Jahr 2001.
Welche Schlussfolgerung lässt sich aus der Analyse ziehen? (Hinweis: Diese Frage kann nicht direkt aus dem gegebenen Text beantwortet werden, da die Schlussfolgerungen nicht explizit genannt werden.)
Der Text legt den Fokus auf die Beschreibung der Ereignisse und die Darstellung der öffentlichen Debatte. Eine explizite Schlussfolgerung wird im vorliegenden Auszug nicht gezogen. Eine vollständige Analyse des Textes wäre notwendig, um eine fundierte Antwort zu geben.
- Quote paper
- Marie Kuster (Author), 2001, Vom Frankfurter ,,Sponti" zum Außenminister: Das Verhältnis des Politikers Joschka Fischer zu Macht und Gewalt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107013