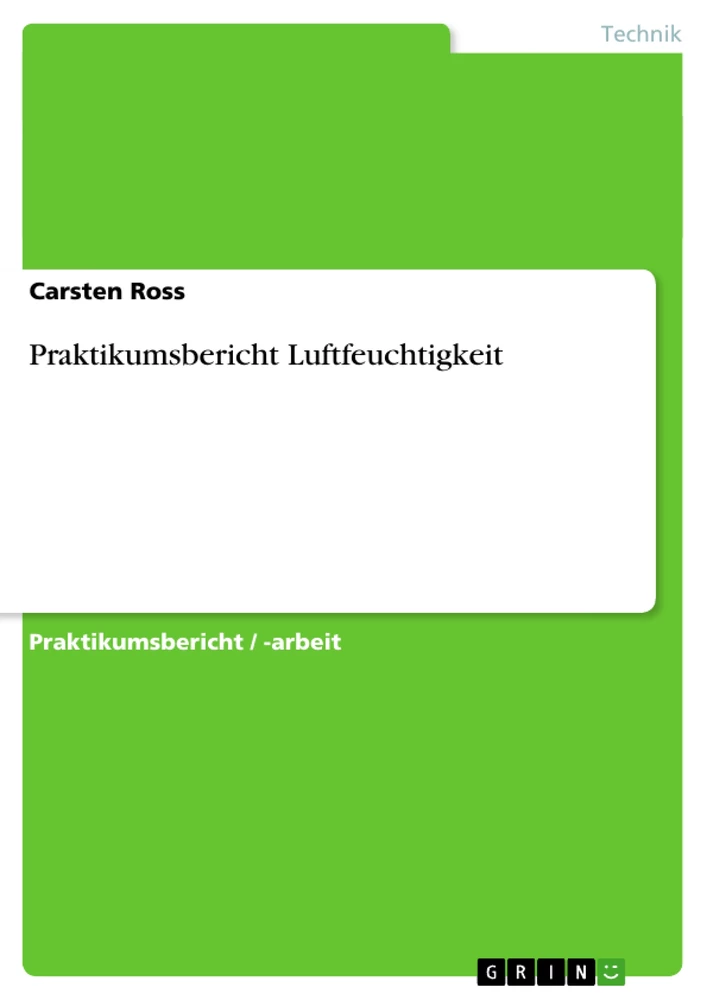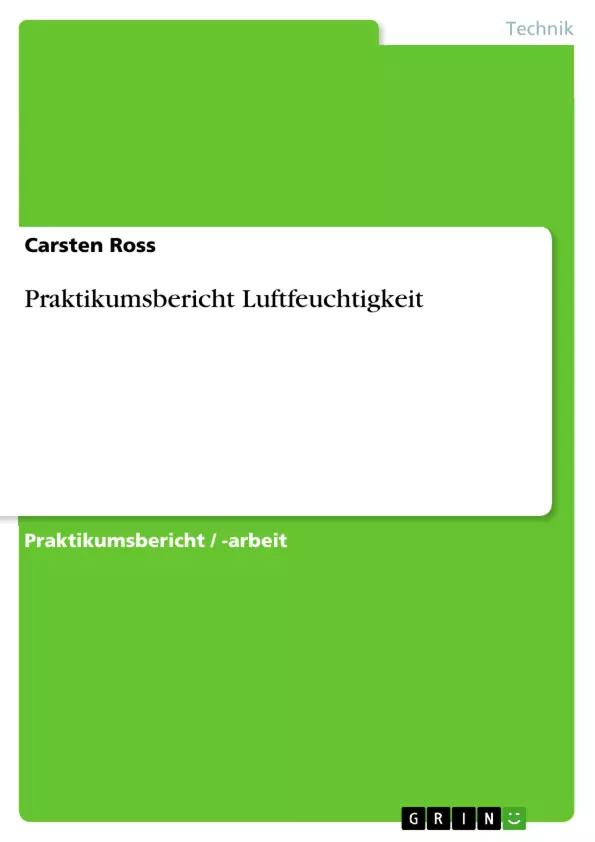Wie fühlt sich die Luft wirklich an? Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Hygrometrie, einer Wissenschaft, die unsichtbare Wasserdampfgehalte messbar macht. Dieser Bericht enthüllt die Geheimnisse präziser Luftfeuchtigkeitsbestimmung anhand zweier klassischer Methoden: dem Taupunkt-Hygrometer und dem Aspirations-Psychrometer. Entdecken Sie, wie subtile Temperaturveränderungen und clevere physikalische Prinzipien genutzt werden, um die relative Luftfeuchte zu entschlüsseln. Von Lambrechts elegantem Taupunkt-Hygrometer, das die Kondensation von Wasserdampf auf einer gekühlten Oberfläche beobachtet, bis hin zu Assmanns Aspirations-Psychrometer, das die Verdunstungskühlung feuchter Thermometer nutzt, werden die theoretischen Grundlagen und praktischen Anwendungen detailliert erläutert. Verfolgen Sie die sorgfältige Durchführung der Experimente, von der akribischen Messwerterfassung bis zur präzisen Auswertung. Enthüllen Sie die Herausforderungen und potenziellen Fehlerquellen, die bei solchen Messungen auftreten können, und lernen Sie, wie systematische und zufällige Fehler analysiert und minimiert werden können. Anhand detaillierter Fehlerrechnungen, die sowohl das Taupunkthygrometer als auch das Aspirations-Psychrometer umfassen, wird die Genauigkeit der erhaltenen Ergebnisse kritisch bewertet. Erfahren Sie, wie Sie die Vertrauensbereiche berechnen, partielle Ableitungen anwenden und relative Fehler bestimmen, um die Qualität Ihrer Messungen zu verbessern. Egal, ob Sie Student, Wissenschaftler oder einfach nur neugierig auf die Geheimnisse der Atmosphäre sind, dieser Bericht bietet Ihnen ein umfassendes Verständnis der Hygrometrie und ihrer Bedeutung für unser tägliches Leben. Entdecken Sie, wie diese Messungen in Bereichen wie Meteorologie, Klimaforschung, industrielle Prozesse und sogar in der Konservierung von Kunstwerken eine entscheidende Rolle spielen. Lassen Sie sich von den Messergebnissen überraschen und hinterfragen Sie die scheinbare Selbstverständlichkeit unserer Umgebungsluft.
Inhaltsverzeichnis
1.Aufgabenstellung
2.Theorie
3. Versuchsdurchführung
4. Messwerte
5. Auswertung
6. Fehlerrechnung
1. Aufgabenbeschreibung
In diesem Versuch soll die relative Luftfeuchte bestimmt werden. Um dies zu erreichen, sind verschiedene Verfahren möglich, die unter dem Namen Hygrometrie zusammengefasst werden. In meinem Praktikum verwendete ich das TaupunktHygrometer und das Aspirations-Psychrometer.
2. Theorie
Taupunkt-Hygrometer nach Lambrecht
Luft die nicht mit Wasserdampf gesättigt ist, ändert ihre absolute Feuchte erst, wenn die Temperatur so weit abgesunken ist, dass absolute und maximale Feuchte gleich ist. Die Temperatur bei der das der Fall ist, nennt man Taupunkt τ . Bei Abkühlung darunter kondensiert der überschüssige Wasserdampf. Dabei wird sich die dichte der feuchten Luft ändern, da die Abkühlung bei konstantem Druck stattfindet. Dann muss wegen :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]die Dichte der Luft größer werden. Da sich die Wasserdampfmenge m D nicht geändert hat ist nach Gleichung :[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten](1)
[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]. Daraus folgt für die gesuchte absolute Luftfeuchte bei der Temperatur t:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wendet man die Zustandsgleichung auf beide Zustände an:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
und setzt die beiden Ausdrücke gleich, so ergibt sich:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(4) in (3) eingesetzt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Diese Gleichung liefert nun den korrigierten Wert für die absolute Luftfeuchte. Kennt man nun den Taupunkt, der im Versuch ermittelt werden soll, so kann man aus Tabellen die relative Luftfeuchte nach (2) und unter Beachtung von (5) errechnen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aspirations-Psychrometer nach Assmann
Dieser Versuch besteht aus zwei nebeneinanderstehenden und übereinstimmenden Thermometern. Das Gefäß des einen Thermometers liegt frei an der Luft, das Gefäß des anderen ist mit einem feuchten Stofftuch umwickelt, dass in ein Wasserbad eingetaucht ist und von einem Gebläse verstärkte Luftzufuhr erhält. Ist die Luft mit Wasserdampf gesättigt, so zeigen beide Thermometer die gleiche Temperatur an. Andernfalls verdunstet Wasser am feuchten Thermometer und es zeigt eine tiefere Temperatur an, weil Energie zum Verdampfen entzogen wird.
Strömt nun das Luftvolumen V am feuchten Thermometer vorüber, so gibt dieses eine Wärmemenge ab und die angezeigte Temperatur sinkt von t auf t’ .Der Dampfdruck des im vorüberströmenden Luftvolumen enthaltenen Wasserdampfes ändert sich durch Wasseraufnahme von pd auf pd ’. Ist σD die Dichte des Wasserdampfes beim Luftdruck p so folgt aus
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wegen m = Vσ mit m = m2 - m1 ist:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die von der Luft aufgenommene Wasserdampfmenge multipliziert man mit der spezifischen Verdampfungswärme und erhält damit die zum Verdunsten benötigte Wärmemenge Q:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ist am befeuchteten Thermometer keine Temperaturänderung mehr feststellbar, so gibt die strömende Luft die Wärmemenge
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aus der Gleichheit der Wärmemengen ergibt sich für den in der Luft herrschenden Partialdruck des Wasserdampfes :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Größen [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]wurden zu einer Konstante k zusammengefasst. Sie hat den Wert [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]. Aus (1) erhält man den Partialdruck des Wasserdampfes pD , aus Tabellen entnimmt man den zur Temperatur gehörigen Sättigungsdruck pS des Wasserdampfes und errechnet die relative Luftfeuchte nach der Gleichung:
[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten](2)
3. Versuchsdurchführung
Taupunkthygrometer
In das Metallgefäß wird Äther eingefüllt und der Temperatursensor des Digitalthermometers wird in den Äther getaucht. Mit Hilfe des Gummigebläses wird die Verdampfung des Äthers beschleunigt. Dadurch kühlen sich der Äther und die polierte Metallfläche ab und bei einer bestimmten Temperatur, dem Taupunkt, kondensiert Wasser an der Metallfläche. Es wird die momentane Temperatur τ1 abgelesen und so lange gewartet bis das Kondensat verschwunden ist. Nun wird die etwas höhere Temperatur τ2 abgelesen. Wiederholt man diesen Ablauf der Messung mehrfach, so unterscheiden sich die Temperaturen τ1 & τ2 nur noch wenig voneinander und es kann der Mittelwert mit :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]gebildet werden.
Aus einer Tabelle entnimmt man den zu τ gehörigen Wert fτ . Nach (2) und unter Beachtung von (5) wird die relative Luftfeuchte errechnet.
Aspirations-Psychrometer
Der grobe Aufbau wurde bereits in der Theorie beschrieben. Nachdem nun der feuchte Lappen am 2. Thermometer ins Wasserbad getaucht ist, kann der Ventilator eingeschaltet werden. Das Thermometer mit dem feuchten Lappen zeigt eine erwartungsgemäß niedrigere Temperatur. Wenn sich die Skale nicht mehr verändert, werden bei beiden Thermometern die Temperaturen t und t’ abgelesen. Aus der Tabelle werden die zu t und t’ gehörigen Werte für ps und pD ’ entnommen. Mit Gleichung (1) errechnet man pD und mit (2) die relative Luftfeuchte.
Versuchsgeräte:
- Taupunkthygrometer komplett
- Äther
- Aspirations-Psychrometer komplett
- Tischventilator
4. Messwerte
Taupunkthygrometer
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aspirations-Psychrometer
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4. Auswertung
Taupunkthygrometer
Aus den Mittelwerten kann nun τ -gesamt berechnet werden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Mit[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]kann nun f berechnet werden.
Der zu τ gehörige Wert fτ wird der Tabelle entnommen.
f = 9,33 mbar
Die relative Luftfeuchte bestimmt sich nun aus
[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]wobei f0 im Bezug zu t (Raumtemp.) steht und ebenfalls der Tabelle entnommen wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dieser Wert weicht stark von dem Realitätswert ab, der bei ca. 56% liegt. Die Gründe sind in der Vielzahl der möglichen Fehlereinflüssen zu finden, da diese sind bei dem Versuch besonders hoch.sind, wie z.B. ungenaues oder zu spätes erkennen des Kondensats (!), schneller Luftmassenaustausch zwischen Versuchsräumen und Fluren oder Beeinflussung der Luftfeuchte durch Atemluft des Praktikanten usw. .
Aspirations-Psychrometer
Mit der bereits hergeleiteten Formel[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]kann man nun den herrschenden Partialdruck des Wasserdampfes errechnen. Der Wert für pD’ kann wieder der Tabelle entnommen werden. Es ergibt sich somit:
pD’= 17,07 mbar
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
pS ist der zu t gehörende Sättigungsdruck und wird ebenfalls der Tabelle entnommen. Es ist nun die Berechnung der relativen Luftfeuchte möglich:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aus der Differenztemperatur t=10 K kann auch mit Hilfe der Psychrometrischen Tabelle die Luftfeuchte entnommen werden. Der dadurch entnommene Wert liegt wie zu erwartend bei 47%.
Jedoch weicht auch die gemessene Luftfeuchte mit diesem Versuch noch grob von der Realitätsluftfeuchte von 56% ab. Auch hier sind die Abweichungen durch komplexe Fehlereinflüsse zu begründen.
4. Fehlerrechnung
Systematische Fehler:
Systematische Fehler des Versuches ergeben sich durch die vorgegebenen Fehler der Thermometer und den Vertrauensbereich (mittlerer Fehler des Mittelwertes) der Taupunkttemperatur:
Digitalthermometer: ∆t = 0,1 K
Hg-Thermometer: ∆t = 1 K
Zufällige Fehler:
Zufällige Fehler treten durch Ableseungenauigkeiten (Paralaxenverschiebung), Temperatureinflüsse, Windzüge oder ähnliches auf. Als den wahren Messwert (hier für ∆τ) nimmt man dann den Mittelwert.
Taupunkthygrometer
Um eine korrekte Fehlerrechnung durchzuführen muss der Vertrauensbereich von τ bestimmt werden und dann als fester Fehler in das totale Differential mit eingesetzt werden.
Der Vertrauensbereich bestimmt sich folgendermaßen: Zuerst wird der Mittelwert von τ nach folgender Formel bestimmt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Daraus ergibt sich als Mittelwert : ∆τ = 5.9 K
Danach muss der Absolutfehler bestimmt werden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Es ergibt sich: s = 1,065 K
Der Vertrauensbereich kann somit ermittelt werden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Es folgt nun als Fehler der Messreihe:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der physikalische Fehler kann nun ermittelt werden:
Die partiellen Ableitungen der Formel zur Berechnung der absoluten Luftfeuchte
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
ergeben das totale Differential mit den partiellen Ableitungen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das totale Diff. ist bereits durch f dividiert worden, so dass nun gleich der Relativfehler errechnet wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Daraus folgt nun der Absolutfehler:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Rechnet man nun diesen Wert auf die relative Luftfeuchte um, so ergibt sich als Endergebnis:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aspirations-Psychrometer
Man verfährt nach dem ähnlichen Prinzip wie bei dem Taupunkthygrometer:
Die Formel[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] muss nach t und t’ partiell differenziert werden und dann durch pD dividiert werden, um den relativen Fehler zu berechnen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Endergebnis lautet also :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Auf die relative Luftfeuchte übertragen ergibt sich:
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es handelt sich um einen Laborbericht über die Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit.
Was sind die Hauptthemen des Dokuments?
Die Hauptthemen sind Hygrometrie, Taupunkt-Hygrometrie, Aspirations-Psychrometrie und Fehlerrechnung.
Welche Messmethoden werden im Bericht verwendet?
Im Bericht werden das Taupunkt-Hygrometer nach Lambrecht und das Aspirations-Psychrometer nach Assmann verwendet.
Was ist die Aufgabenstellung des Versuchs?
Die Aufgabenstellung ist die Bestimmung der relativen Luftfeuchte mit verschiedenen Verfahren, insbesondere mit dem Taupunkt-Hygrometer und dem Aspirations-Psychrometer.
Welche theoretischen Grundlagen werden erläutert?
Es werden die theoretischen Grundlagen der Taupunkt-Hygrometrie und der Aspirations-Psychrometrie erläutert, einschließlich der relevanten Formeln und physikalischen Zusammenhänge.
Wie wird die Versuchsdurchführung beschrieben?
Die Versuchsdurchführung für beide Methoden wird detailliert beschrieben, einschließlich der verwendeten Geräte und der einzelnen Schritte zur Messung der Temperatur und zur Bestimmung der relativen Luftfeuchte.
Welche Messwerte werden erfasst?
Es werden Messwerte für beide Methoden erfasst und in Tabellen dargestellt. Diese umfassen Temperaturmessungen, Taupunkttemperaturen und die entsprechenden Werte aus Tabellen zur Berechnung der relativen Luftfeuchte.
Wie erfolgt die Auswertung der Messwerte?
Die Auswertung der Messwerte umfasst die Berechnung von Mittelwerten, die Verwendung von Tabellenwerten und die Anwendung der relevanten Formeln zur Bestimmung der absoluten und relativen Luftfeuchte. Es werden auch die Abweichungen von den Realitätswerten diskutiert.
Wie wird die Fehlerrechnung durchgeführt?
Die Fehlerrechnung umfasst die Berücksichtigung systematischer und zufälliger Fehler. Es werden die Fehlerquellen analysiert und die Vertrauensbereiche der Messwerte bestimmt. Zudem werden die partiellen Ableitungen der Formeln berechnet, um den relativen und absoluten Fehler zu ermitteln.
Welche Versuchsgeräte werden verwendet?
Die verwendeten Versuchsgeräte sind ein Taupunkthygrometer komplett, Äther, ein Aspirations-Psychrometer komplett und ein Tischventilator.
Welche Formeln werden verwendet?
Im Bericht werden eine Vielzahl von Formeln verwendet, insbesondere zur Berechnung der absoluten und relativen Luftfeuchte, des Partialdrucks des Wasserdampfes und zur Fehlerrechnung. Die wichtigsten Formeln sind im Text enthalten und werden erläutert.
- Quote paper
- Carsten Ross (Author), 2002, Praktikumsbericht Luftfeuchtigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107028