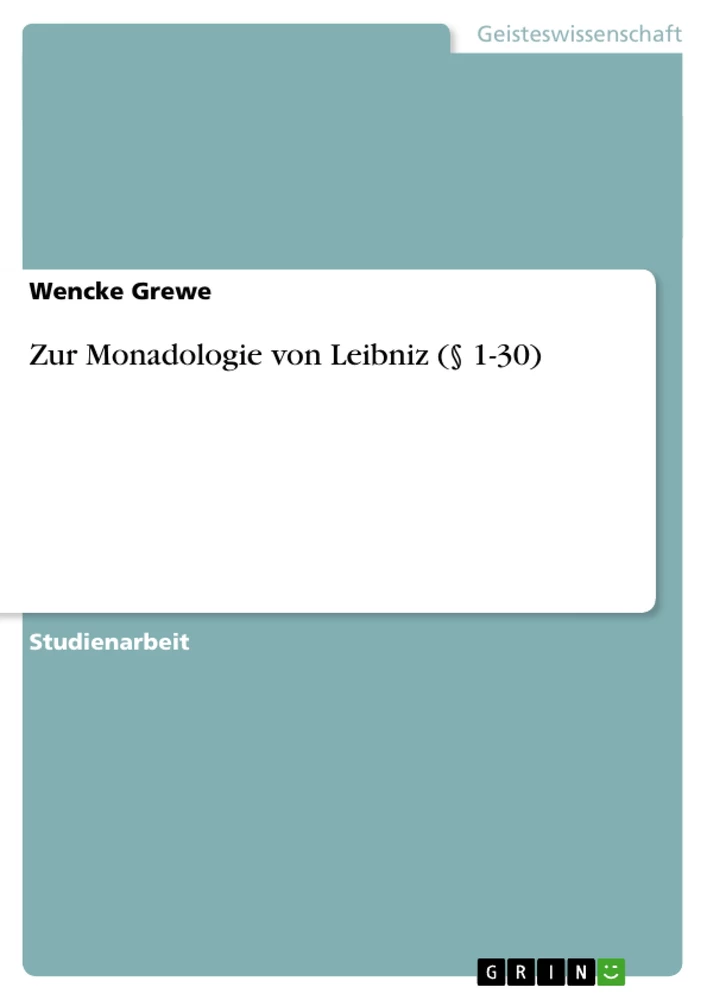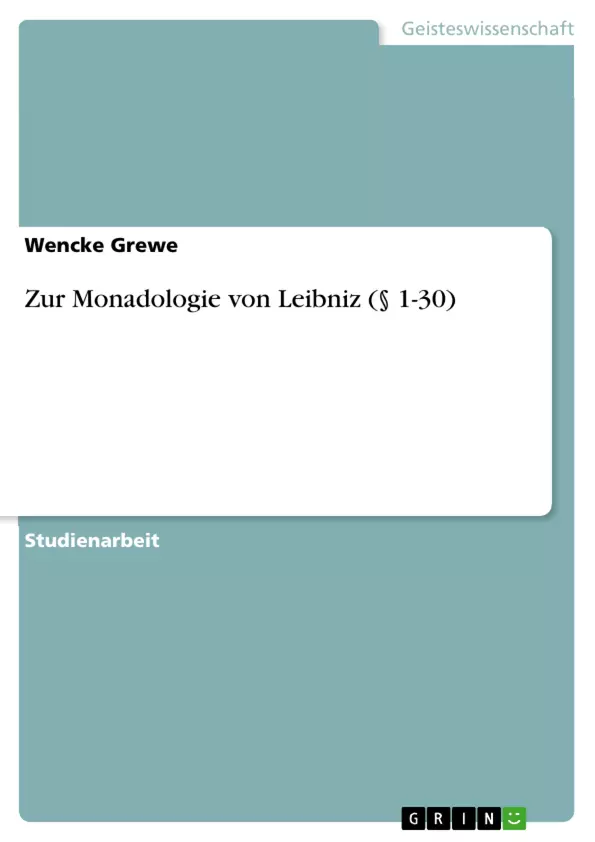Was wäre, wenn die Welt, wie wir sie kennen, auf winzigen, unteilbaren Einheiten basieren würde, die jede für sich ein Spiegel des Universums sind? Gottfried Wilhelm Leibniz entführt uns in seiner "Monadologie" in eine faszinierende Welt der Monaden, jener elementaren Bausteine der Realität, die mehr sind als nur physikalische Partikel – sie sind geistige Kraftzentren. Diese Schrift, posthum veröffentlicht, enthüllt Leibniz' revolutionäre Substanztheorie, in der jede Monade, ein "wahrer Atom der Natur", eine einzigartige Perspektive auf das Ganze einnimmt. Leibniz' Monadenlehre ist nicht nur eine philosophische Abhandlung über die Beschaffenheit der Realität, sondern auch eine tiefgründige Auseinandersetzung mit Fragen der Individualität, der Wahrnehmung und der Rolle Gottes. Erleben Sie, wie Leibniz die Unterscheidung zwischen Mensch und Tier anhand der Konzepte von Perzeption und Apperzeption erläutert und die Vernunft als das entscheidende Merkmal des menschlichen Geistes herausstellt. Tauchen Sie ein in die Welt der einfachen Substanzen, die sich durch innere Prinzipien verändern und in einer hierarchischen Ordnung von Gott bis zur schlafenden Monade angeordnet sind. Entdecken Sie die Bedeutung des "Satzes des Widerspruchs" und des "Satzes des zureichenden Grundes" für unser Verständnis der Welt und der göttlichen Ordnung. Lassen Sie sich von Leibniz' visionärer Philosophie inspirieren und hinterfragen Sie Ihre eigene Vorstellung von Realität, Individualität und dem Wesen des Seins. Die Monadologie ist ein Schlüsselwerk der Philosophie, das bis heute nichts von seiner Aktualität und Sprengkraft verloren hat und den Leser dazu anregt, die Welt mit neuen Augen zu sehen. Leibniz' Monaden sind ein faszinierender Einblick in die Welt der kleinsten Einheiten des Seins, ein Denkanstoß für Philosophen, Wissenschaftler und alle, die sich für die großen Fragen der Existenz interessieren.
Gliederung
1. Monade
1.1. Monadologie
1.2. Wie sind die Monaden bei Leibniz dargestellt?
2. Zusammenfassung
1. Monade
Monade = griech. monas (Eins, Einheit), Bezug zu monos (allein) sowie meinein (bleiben, bestehen), d. h. eine für sich seiende von anderem abgesetzte Einheit; bei Leibniz auch einfache Substanz genannt.
1.1. Monadologie
Die Monadologie, die ihren Namen erst nach Leibniz´ Tod in einer deutschen Übersetzung von Heinrich Köhler erhielt, ist eine Substanztheorie, deren Gegenstand die letzten Elemente der Wirklichkeit sind. Da Leibniz die Monadenlehre nie veröffentlichte, wurde sie erstmals zusammenhängend in einer systematischen Darstellung in neunzig Paragraphen 1720 in Umlauf gebracht.
1.2. Wie sind die Monaden bei Leibniz dargestellt?
Die Monaden sind die ,,wahrhaften Atomi der Natur" oder die ,,Elemente derer Dinge" (§ 3). Es ist hier auffällig, dass der Begriff ,,Atom" Verwendung findet. Dieser ist jedoch nicht in einer materialistischen Weise gemeint, sonder ist vielmehr synonym mit den Begriffen Substanz, Element und Monade zu verstehen. Das Charakteristikum der Unteilbarkeit ist dabei von entscheidender Bedeutung, denn eine Monade ist einfach, d.h. sie hat keine Teile. Alle zusammengesetzten Dinge bestehen aus diesen einfachen Substanzen (§ 1). Leibniz geht davon aus, dass diese unteilbare Substanz weder Ausdehnung, noch Gestalt oder irgendeine andere Möglichkeit der Teilbarkeit besitzt (§ 3). Diese Einsicht wurde auf der Grundlage der Mathematik gewonnen, denn alles, was Ausdehnung besitzt, muss ins Unendliche teilbar sein, da es sich im Kontinuum des Raumes ausdehnt. Trotzdem gibt es neben den einfachen Substanzen die Aggregate, die nichts anderes als die Anhäufung der einfachen Substanzen sind (§ 2). Es ist eine Notwendigkeit, dass sich das Einfache anhäuft und etwas Zusammengesetztes bildet , da ansonsten ein Widerspruch zur erfahrbaren Realität gegeben wäre. Es wird aber an dieser Stelle deutlich, dass das Zusammengesetzte anders entsteht und vergeht als das Einfache. Aggregate entstehen und vergehen auf natürlichem Wege, das heißt sie setzen sich aus Teilen zusammen und vergehen in diese. Die Monaden als wahre, letzte Teile jedoch können nicht in Teile zerfallen (§ 4) oder sich aus Teilen zusammensetzen (§ 5). So ist es nur möglich, dass die Monaden mit einem Schlage entstehen oder vergehen können (§ 6). Nun ist es an solch einem Punkt dem menschlichen Verstand unverständlich, wie etwas aus nichts entstehen kann oder wie etwas zu nichts werden kann, ebenso wie es dem Menschen nicht vorstellbar ist, wie die Welt an sich aus dem Nichts entstehen könnte oder zu Nichts vergehen könnte. Leibniz schreibt über die Monaden, ,,sie können nicht entstehen als durch die Schöpfung und nicht untergehen als durch die völlige Zernichtung" (§ 6). In diesem § 6 gibt es die erste Anspielung auf die Schöpfung, die, wie Leibniz später deutlich macht, nur durch Gott erfolgen kann. Damit ist Gott allein für die Entstehung und die Zerstörung von den einzelnen Monaden verantwortlich.
In § 7 schreibt Leibniz: ,,Die Monaden haben keine Öffnungen, wodurch etwas in dieselben hineintreten oder aus ihnen herausgehen könnte" Das heißt, die Monaden können weder eine Substanz noch eine Bestimmung von außen in sich aufnehmen. Dadurch kann auch niemand Monaden von außen verändern. Die Veränderung der Monaden entsteht nur aus einem inneren Prinzip heraus, weil ja äußerliche Dinge auf das Innere einer Monade keinen Einfluss haben können (§ 11).
Leibniz schreibt weiter, dass dabei jede Monade von jeder anderen verschieden sein muss (§ 9). Auch die Monaden, wie jedes andere erschaffene Wesen, unterliegen Veränderungen (§ 10). Trotzdem sind alle Monaden dem Prinzip nach gleich, d.h. sie unterscheiden sich quantitativ nicht voneinander, denn es sind ja alles einfache Substanzen und als diese dem Prinzip nach gleich. Die Möglichkeit der Unterscheidung bietet sich hingegen auf der Ebene der Qualitäten einer Monade, jedoch wiederum nur graduell, nicht prinzipiell (§ 8). Der graduelle Unterschied in den Qualitäten einer jeden Monade, die sich qualitativ kontinuierlich verändert (quantitative Veränderung ist bei einer einfachen Substanz ja nicht möglich), geht nach Leibniz aus der Vielheit in der Einheit hervor (§ 13). „...und folglich müssen viele Eigenschaften und Relationen in einer Monade vorhanden sein obgleich dieselbe gar keine Teile an sich hat." (§ 13).
Leibniz unterscheidet im § 14 der Monadologie streng zwischen Perzeption und Apperzeption. Perzeption ist zu verstehen als die sinnliche Wahrnehmung bzw. Empfindung und die Apperzeption als Selbstbewusstsein, bewusstes Erfassen von Wahrnehmungs-, Erlebnis- und Denkinhalten oder reflexive Erkenntnis des inneren Zustands. Dabei spricht Leibniz einer jeden Monade Perzeptionen zu (§ 21), die sich jedoch qualitativ unterscheiden. Das Gemeinsame an der Perzeption einer jeden Monade ist das Begehren in den Monaden, von einer Perzeption zur nächsten unablässig voranzuschreiten. Dieses Begehren wird auch „appetition oder die Begierde“ (§15) genannt. . Es ist verantwortlich für „die Veränderung oder den Fortgang“ (§15) der Perzeptionen. Der Unterschied zwischen der Perzeption einer jeden Monade zu den Perzeptionen der anderen Monaden liegt in der Perspektive, aus der sie die Wahrnehmung hat. Somit liegt der qualitative Unterschied in der Wahrnehmung darin, dass immer nur aus einer ganz bestimmten Perspektive wahrgenommen werden kann und niemals zwei Wahrnehmungen genau gleich sein können, da ja keine Monade zur gleichen Zeit aus der selben Perspektive wahrnehmen kann wie eine andere Monade. Die Möglichkeit, dass zwei Monaden hintereinander eine identische Wahrnehmung haben, ist ebenso nicht gegeben. Das liegt zum einen daran, dass der Gegenstand der Wahrnehmung zu zwei Zeitpunkten genau der gleiche an derselben Stelle sein müsste. Dies kann er aber schon aufgrund der kontinuierlichen Veränderung einer jeden Monade nicht sein. Zum anderen kann eine Monade nicht zu der ganzen Vorstellung (oder Wahrnehmung) gelangen, sondern nur zu einem Teil der ganzen Vorstellung. Deswegen geht die Monade aufgrund des Begehrens immer nur von einer Vorstellung zur nächsten über (§ 15). Dies wiederholt Leibniz später noch einmal in § 22, wo er schreibt: „Denn eine Perception kann natürlicherweise nur aus einer andern Perception entspringen“.
In § 17 versucht Leibniz den Begriff der Perzeption weiter zu verdeutlichen: Er entwickelt das Bild einer Maschine, die ja auch aus vielen Einzelteilen zusammengesetzt ist. Würde man nun in diese Maschine hineingehen, so würde man zwar die Teile sehen können, aber die Perzeption dieser Maschine, die Empfindungen, die sie hat, könnte man niemals sichtbar machen. Die Perzeption liegt also in der Maschine unsichtbar verborgen, so wie alle „innerlichen Actiones“ (§ 17) in einer Monade verbogen liegen und nicht von außen sichtbar sind.
In § 18 bezeichnet Leibniz die Monaden als Entelechien, die nach Aristoteles die sich im Stoff verwirklichende Form sind. Da es aber nach Leibniz´ Ansicht gar keinen Stoff oder keine Materie gibt, ist der Begriff der Entelechie anders zu verstehen: Die Monaden ,,besitzen eine gewisse Vollkommenheit in sich“ (§ 18), die sie zum Quell ihrer inneren Tätigkeiten macht. So trägt eine jede einfache Substanz ihr Ziel in sich selbst, sie besitzt eine in sich liegende Kraft, die ihre Entwicklung und Vollendung bewirkt, was sich problemlos auf die Eigenschaft der Selbsttätigkeit, die auch der Begriff der Entelechie in sich trägt, beziehen lässt. Diese Selbsttätigkeit der Monaden ruft eine kontinuierliche Veränderung (§ 11) in einer jeden Monade hervor und Leibniz hat sich alle Monaden in einer kontinuierlichen Reihenfolge (Monadenhierarchie), die von Gott bis zur schlafenden Monade reicht, vorgestellt. Darauf soll in dieser Arbeit jedoch nicht im Einzelnen weiter eingegangen werden, da dies zu weit führen würde. Die folgenden Paragraphen erläutern nun die Beschaffenheit der Seele und den Unterschied zwischen Mensch und Tier.
Zunächst einmal ist die Seele auch nur eine einfache Substanz (§16), die dieselben Voraussetzungen erfüllen muss wie eine Monade (Unteilbarkeit, Entstehung und Schöpfung nur durch Gott, Einzigartigkeit...). Trotzdem unterscheidet sich eine Seele von einer Monade: eine Seele besitzt sowohl Perzeption als auch Apperzeption. Eine einzelne Monade hat bloße Perzeption, also nur Empfindungen. Wenn ein Mensch z.B. in Ohnmacht fällt oder sehr tief schläft, nur dann ist die Seele = Monade, denn dann empfindet sie nur, ohne Apperzeption zu haben (§ 20). Außerdem soll eine Seele eine deutliche Perzeption haben „und mit dem Gedächtnis verknüpft“ sein (§19).
Auch Tiere haben nach Leibniz eine Perzeption, da sie in der Lage sind, auf Licht, Geruchsstoffe, Geschmacksstoffe etc. zu reagieren und ihre Empfindungen zu zeigen (§ 24). Das vorhandene Gedächtnis der Seelen führt dazu, dass sie z.B. über den Erfolg von Dingen nachdenken können; ähnlich wie die Vernunft (§ 25). Trotzdem muss nun deutlich zwischen Gedächtnis und Vernunft unterschieden werden. Durch das Gedächtnis kann sich die Seele Dinge vorstellen bzw. einbilden. Auch dies kann eine Empfindung/Perzeption hervorrufen. Auch Tiere sind in der Lage, sich an Vorkommnisse in ihrem Leben zu erinnern (Leibniz bringt an dieser Stelle das Beispiel von einem Hund, der wegläuft, wenn er den Stock sieht, mit dem er geschlagen wurde). (§25)
Somit haben Tiere zwar ein Gedächtnis aber noch lange keine Vernunft (§ 25). Dies ist der entscheidende Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Der Mensch ist in der Lage, vernünftig zu handeln. Solange er dies jedoch nicht tut und nur seinen Perzeptionen folgt, unterschiedet er sich in keiner Weise von einem ohne Vernunft lebenden Tier (§27).
Leibniz hält es für sehr wichtig, dass der Mensch erkennt, dass er „Vernunft und Wissenschaften“ hat (§28). Diese Erkenntnis führt dazu, dass der Mensch sich vom Tier unterscheidet. Durch diese Vernunft kommt der Mensch erst zur Apperzeption. Er wird in die Lage versetzt, über sein Ich selbst, sein Handeln und Gott genauer nachzudenken. Dadurch wird seine Seele erst zu einer vernünftigen Seele, die Leibniz auch „Geist“ nennt (§28). Erst in diesem Zusammenhang benutzt Leibniz das Wort „Nachdenken“ (§ 29). Der Mensch ist fähig über sein Handeln nachzudenken, es zu reflektieren und dadurch vernünftige Entscheidungen zu treffen.
Leibniz weist dieser Vernunft zwei Haupt-Wahrheiten zu: Die erste Wahrheit findet sich im „Satz des Widerspruchs“ (§ 30). Damit meint er die Fähigkeit des Menschen zwischen wahr und falsch zu unterschieden, wobei er offen lässt, wie sich wahre und falsche Vorstellungen bilden.
Die zweite Wahrheit nennt er den „Satz des zureichenden Grundes“ (§ 31). Der besagt, dass die Menschen allen Begebenheiten einen zureichender Grund zuweisen wollen und nach diesem zureichenden Grund suchen. Wie sich in den folgenden Paragraphen herausstellen wird, liegt nach Leibniz dieser zureichende Grund in Gott.
2. Zusammenfassung
In seiner Lehre von den Monaden hat Gottfried Wilhelm Leibniz seiner Philosophie eine knappe und prägnante Gestalt gegeben. Als Monaden bezeichnet er einfache, unteilbare Entitäten, die nicht ausgedehnt sind, sondern vielmehr als geistige Prinzipien wirken. Da die Körper, in denen sie wirken, bloße Erscheinungen sind, ist alles, was ist, Monade. Die Individualität des einzelnen erhält damit eine noch nie da gewesene Stellung: Die einzelnen Monaden entwickeln sich aus sich selbst, sind mit sich allein gelassen; zugleich spiegelt jede von ihnen in eigener Weise das Ganze. Die Möglichkeit der Koexistenz garantiert Gott, die höchste Monade.
Außerdem gelingt es Leibniz, die Seele und den Unterschied zwischen Gott, den Menschen und Tieren anhand seiner Monadenhierarchie plausibel zu erläutern. Aber es wäre zum Beispiel nötig, Pflanzen und Gegenstände in diese Hierarchie einzufügen. Inwiefern eine solche Hierarchie insgesamt aber durchhaltbar ist, stellt sich für mich als fraglich dar. Es wäre mir nicht ganz verständlich, warum selbst das kleinste Tier, nehmen wir nur eine Milbe an, innerhalb der oben genannten Kategorien eine höhere Stellung haben sollte als beispielsweise eine Eiche, die ein wesentlich komplexeres, zumindest aber größeres Wesen ist. Die Zuordnung in Kategorien von Monaden müsste also meines Erachtens nach weiter differenziert werden, um eine Abstufung innerhalb der Tier- und Pflanzenwelt möglich zu machen.
Textgrundlage:
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Monade nach Leibniz?
Eine Monade ist, abgeleitet vom griechischen Wort monas (Eins, Einheit), eine für sich stehende, von anderem abgesetzte Einheit. Leibniz nennt sie auch einfache Substanz.
Was ist die Monadologie?
Die Monadologie ist eine Substanztheorie, die sich mit den letzten Elementen der Wirklichkeit befasst. Sie wurde erst nach Leibniz' Tod in einer deutschen Übersetzung von Heinrich Köhler unter diesem Namen bekannt.
Wie beschreibt Leibniz die Monaden?
Leibniz bezeichnet die Monaden als die "wahrhaften Atomi der Natur" oder die "Elemente derer Dinge". Sie sind unteilbar, einfach und haben keine Teile. Sie besitzen weder Ausdehnung noch Gestalt oder andere teilbare Eigenschaften.
Wie entstehen und vergehen Monaden?
Monaden können nicht aus Teilen zusammengesetzt oder in Teile zerfallen. Sie entstehen und vergehen durch Schöpfung bzw. Zernichtung, die nur durch Gott erfolgen kann.
Können Monaden von außen beeinflusst werden?
Nein, Monaden haben keine Öffnungen, durch die etwas eintreten oder austreten könnte. Veränderungen entstehen nur durch ein inneres Prinzip.
Sind alle Monaden gleich?
Alle Monaden sind dem Prinzip nach gleich, d.h. sie unterscheiden sich quantitativ nicht voneinander. Unterschiede ergeben sich jedoch in den Qualitäten, die sich graduell unterscheiden.
Was ist der Unterschied zwischen Perzeption und Apperzeption?
Perzeption ist die sinnliche Wahrnehmung oder Empfindung, während Apperzeption das Selbstbewusstsein oder die bewusste Erfassung von Wahrnehmungsinhalten ist. Jede Monade hat Perzeption, aber nur Seelen (und insbesondere Menschen) haben Apperzeption.
Was ist das Begehren (Appetition) der Monaden?
Das Begehren ist das innere Bestreben der Monaden, von einer Perzeption zur nächsten voranzuschreiten. Es ist verantwortlich für die Veränderung und den Fortgang der Perzeptionen.
Was ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier laut Leibniz?
Der wesentliche Unterschied liegt in der Vernunft. Menschen sind in der Lage, vernünftig zu handeln, über ihr Handeln nachzudenken und bewusste Entscheidungen zu treffen, während Tiere dies nicht können, obwohl sie Gedächtnis und Perzeption besitzen.
Welche zwei Haupt-Wahrheiten weist Leibniz der Vernunft zu?
Leibniz weist der Vernunft den "Satz des Widerspruchs" (die Fähigkeit, zwischen wahr und falsch zu unterscheiden) und den "Satz des zureichenden Grundes" (die Suche nach einem Grund für alle Begebenheiten) zu.
Was ist die Monadenhierarchie?
Leibniz stellt sich alle Monaden in einer kontinuierlichen Reihenfolge (Monadenhierarchie) vor, die von Gott bis zur schlafenden Monade reicht.
Wie verhält sich die Seele zur Monade?
Die Seele ist auch eine einfache Substanz, also eine Monade. Sie unterscheidet sich von einer gewöhnlichen Monade durch die Fähigkeit zur Apperzeption. In einem Zustand der Ohnmacht oder im tiefen Schlaf ist die Seele nur eine Monade mit bloßen Perzeptionen.
- Quote paper
- Wencke Grewe (Author), 2002, Zur Monadologie von Leibniz (§ 1-30), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107189