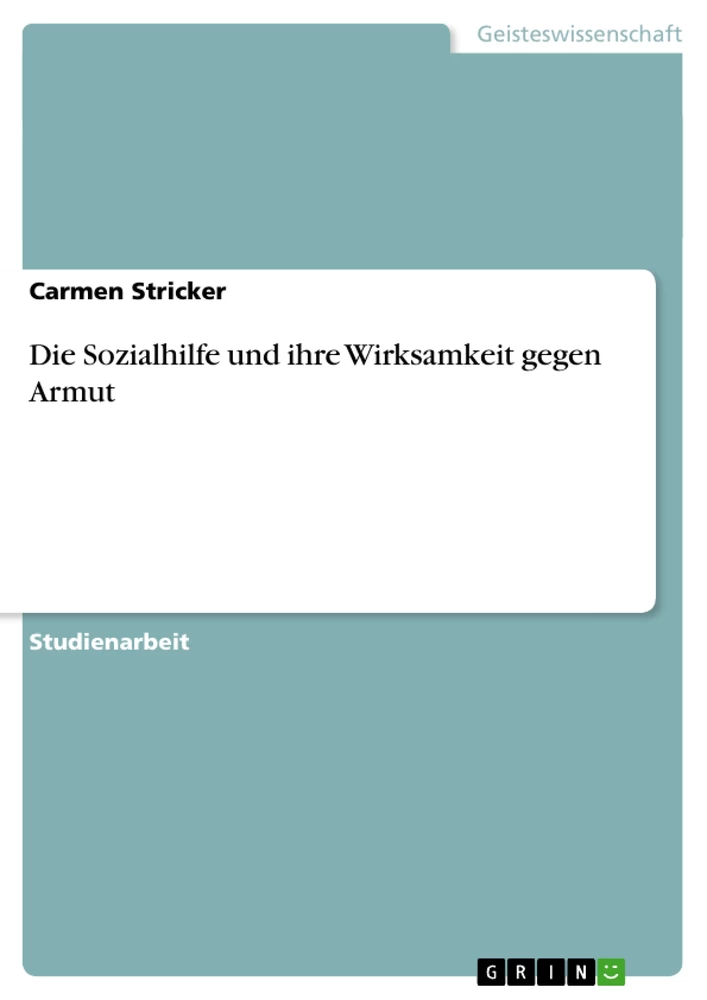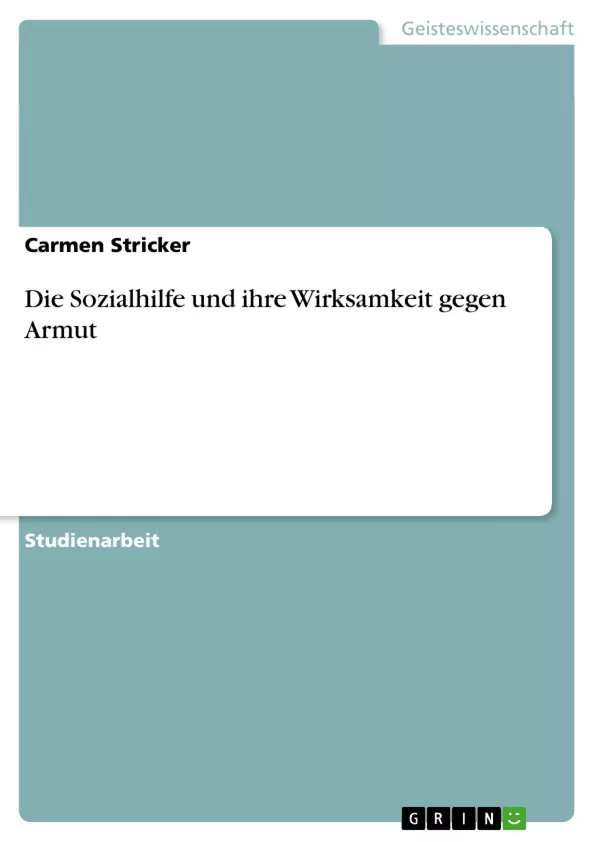Gliederung
1. Einleitung
2. Historische Entwicklung und Bedeutung von Armut
2.1 Resümee
3. Das soziale Sicherungssystem -
Das Haus der sozialen Sicherung
3.1 Das Dach - Das Versorgungs- und Ausgleichsprinzip
3.2 Das Fundament - Das Fürsorgeprinzip
3.3 Die fünf Säulen - Das Versicherungsprinzip
3.4 Resümee
4. Die Sozialhilfe als Beispiel von sozialer Sicherung
4.1 Hintergrund
4.2 rechtliche Grundlagen
4.3 Der Sozialhilfesatz
4.4 Analyse der sozialpolitisch relevanten Paragraphen
4.5 Praxis der Sozialhilfe
5. Frauen und Armut
6. Resümee
Literaturliste:
1. Einleitung
Die Bundesrepublik Deutschland bezeichnet sich als sozialen Bundesstaat, doch gerade im Grundgesetz kommt der Begriff „Sozialstaat“ nicht vor, geschweige denn, dass das Wort „sozial“ genauer definiert wird (Bellermann 2001 / S. 9). Jeder Bedürftige hat nach dem BSHG einen Rechtsanspruch auf Hilfe, was den Grundsatz nahe legt, dass Sozialpolitik soziale Notlagen lindern und/oder beseiti- gen soll (Schmidt 1998 / S.13, Bellermann 2001 / S. 25). Trotzdem gibt es viele Familien, Alleinerziehende, Rentner/innen und Obdachlose, die unterhalb des Sozialhilfeniveaus leben. Die Dunkelziffer der Armut ist hoch, so dass sich die Frage stellt ob unser soziales Sicherungssystem vielleicht doch eher entgegen ih- ren eigenen Anspruch, Not zu verhindern, soziale Notlagen systematisch zulässt (Wagner 1991 / S. 57).
Um die zutreffende Wirkungsperspektive dieser zwei Aussagen hinsichtlich unserer sozialen Sicherung zu finden und zu erläutern, wird hier die Entwicklung des bundesdeutschen Sozialstaates im Hinblick auf die Umgehensweise mit Armut, damals wie heute, beschrieben, unsere heutige soziale Sicherung mit Hilfe des Bildes des „Hauses der sozialen Sicherung“ dargestellt, um dann anschließend anhand des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) einen genaueren Einblick in ein Teilgebiet unserer sozialen Sicherung zu verschaffen. Am Ende geht diese Arbeit noch näher auf die starke Gefährdung der Frauen in unserer Gesellschaft in Armut zu verfallen ein und legt die jeweiligen Gründe dafür dar.
2. Historische Entwicklung und Bedeutung von Armut
Im Mittelalter galt noch ein ganz anderes Verständnis von Armut. Sie wurde am Mangel an Dingen festgemacht. Armut war keine Schande und konnte in jedem Stand vorkommen. Natürlich sah die Armut eines Fürsten anders aus als die eines Bettlers, doch sie gehörte zu der Gesellschaft und wurde auch innerhalb des Stan- des ausgeglichen. So gab es auch die Bettler als regulärer Teil eines jeden Stan- des. Dieser „Bodensatz“ der Stände war damals kein geächteter, sondern im Ge- genteil ein Heiliger. Es stand allerdings nicht das Helfen als Ideal im Vorder- grund, sondern der Anlass zur gottgefälligen Mildtätigkeit, der das Seelenheil sichern sollte. Die milden Gaben, die aus der Abgabe von verderblichen Natura- lien bestanden, waren Spenden zu bestimmten Feiertagen und nicht an Bedürftig- keiten gebunden. Die Ursachen der Notlagen waren ohne Belang; insgesamt er- forderte die Situation somit keine von „oben“ organisierte Armenpolitik (Wagner 1991 / S. 37-38).
Im 15/16. Jahrhundert veränderte sich die Gesellschaft allerdings ganz entscheidend, was ein neues Verständnis von Armut zur Folge hatte. Verantwortlich hierfür war die Etablierung der Geldwirtschaft, die immer höher werdenden Pachten, die Landflucht und Verstädterung, die spätere Aufhebung der Ständegesellschaft und der immer wichtiger werdende Handel.
Durch das Aufkommen der Geldwirtschaft wurde der Tauschhandel abgelöst. Die Bauern mussten jetzt ihre Abgaben in Form von Geld leisten. Die Pachten wurden immer höher, da durch sie die Kriegführung der Fürsten finanziert wurde, die oft umliegenden Ländereien erobern wollten. Die verschuldeten Bauern konnten so hohe Abgaben einfach nicht leisten und arbeiten letztendlich nur noch im Fron- dienst und bekamen nur Kost und Logie für Schwerstarbeit, eigenes Vermögen zu erwirtschaften war somit unmöglich.
Es begann die Landflucht und die Städte wuchsen mehr und mehr und sahen sich so mit einer nicht zu bewältigenden Armut konfrontiert (Wagner 1991 / S. 38). Ein weiterer wichtiger Punkt war der immer bedeutender werdende Handel. Das Bürgertum wurde immer reicher, so dass es letztendlich mächtiger wurde als die Fürsten. Im 14. Jahrhundert wurde Arbeit noch als notwendiges Übel angesehen, doch jetzt entstand ein ganz neues Verständnis von Arbeit. Man konnte durch seiner Hände Arbeit reich werden, so dass sich der Grundsatz, „Arbeit adelt“ durchsetze. Im gleichen Zug veränderte sich aber auch die Meinung von Armut, denn wenn man durch Arbeit reich werden konnte, dann war man auch selbst schuld an seiner Notlage. Armut war nun eine Schande und wurde mit Faulheit gleichgesetzt. Darüber hinaus zerfiel, durch die gefestigte Stellung des Bürger- tums, die Selbstorganisation der Ständegesellschaft und wurde zu einer festgefüg- ten Hierarchie, in der kein Auf- und Abstieg mehr möglich war und die Solidarität innerhalb der Stände in bezug auf die Armut ebenfalls aufhob. Die Armen bzw. Bettler waren jetzt nicht mehr der Bodensatz ihres Standes, sondern bildeten ihren eigenen Stand, der letzte Rest, das Niedrigste innerhalb der Ständehierarchie. Um die Armut in den Städten kontrollieren zu können (etwa 20% der städtischen Bevölkerung lebten in absoluter und 60% in relativer Armut), führten die Städte Bettelbehörden ein, so dass es von da an ein amtliches Kriterium für Bedürftig- keit gab (Wagner 1991 / S. 39). Nur „eigene“ Arme bekamen das Bettelzeichen und ortsfremde Bettler mussten die Stadt verlassen, es entstand eine erste Eintei- lung in gute und böse Bettler. So wurden Bettelknechte eingesetzt, die die Armen verfolgten, kontrollierten, sie kennzeichneten, demütigten und letztendlich bei fehlerhaften Verhalten aus den Städten verwiesen.
Mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert verschlimmerte sich die Si- tuation für die Armen dramatisch. Durch die expandierende Landflucht gab es immer mehr Lohnarbeiter, die nur tageweise beschäftigt wurden und zu diesem ständigen Kampf um Arbeit, kam eine nur kärgliche Bezahlung hinzu. Mit den Städten wuchs die Armut und wurde zum Phänomen und somit auch zu einem gewaltigen Problem der Städte. Dies zog eine entscheidende Wende der Sozialpo- litik nach sich. Armut war jetzt nicht nur eine Schande und mit Faulheit gleichge- setzt, sondern wurde auch mit Strafe bekämpft. Nun war nicht mehr der Entzug der Unterstützung die Strafe, sondern die Unterstützung selbst wurde zur Qual für die Armen. Die Bettler verloren ihre Bürgerrechte, durften nicht heiraten, reisen, wählen und für kein öffentliches Amt kandidieren, sie waren vogelfrei und man konnte mit ihnen nach Willkür verfahren. Ab Mitte des 17. Jahrhunderts schaffte man Armenhäuser, dies war die schlimmste Strafe, denn hier wurden die Armen eingesperrt und kaserniert, und zur Zwangsarbeit genötigt. Darüber hinaus verän- derte sich der Armutsbegriff insofern, dass nicht der Mangel an Mitteln, Hunger und Not die Kriterien der Armut waren, sondern die Gewährung der Unterstüt- zung zum Beweis von Armut wurde (kopernikanische Wende des Armutsbegriffs) (Wagner 1991 / S. 43-45).
Ende des 19. Jahrhundert verabschiedete Bismarck die ersten Sozialgesetze, die hiermit den Anfang der staatlichen sozialen Sicherung bildeten. Auf der bis- marckschen Sozialgesetzgebung (GKV 1883, GUV 1884, Invaliditäts- und Al- tersversicherung 1889) beruht in den Grundzügen das Sozialversicherungssystem der Bundesrepublik Deutschland. Wichtig ist hier allerdings, dass die Intentionen des Staates damals in erster Linie politisch und nicht sozialpolitisch waren. Die wirtschaftspolitische Intension zeigt sich dadurch, dass nur bestimmte, für den Export zuständige Industriezweige - und darüber hinaus nur ein ausgesuchter Teil der Arbeiterschaft, versichert wurde. Die neue Kranken- und Invaliditätsversiche- rung galt nämlich nur den qualifizierten männlichen Arbeitern, die bereits in ge- hobenen Positionen tätig und länger als eine Woche beschäftigt wurden. Die Ta- gelöhner, die mit achtzig Prozent die Mehrzahl der Arbeiterschaft bildeten, wur- den von dieser neuen Versicherung nicht erfasst. Es ging hier also nicht um Für- sorge oder Nächstenliebe, sondern um eine Privilegierung bereits Privilegierter (Bellermann 2001 / S. 45-46).
Kurz vor der Einführung der Krankenversicherung trat das Sozialistengesetz (1879-1890) in Kraft. Hiernach wurde jede Aktivität der Sozialisten verboten, was mit einer Wegsperrung von über 1500 aktiver Sozialisten einher ging. Es wurden Gewerkschaftskassen beschlagnahmt und den Sozialisten alle finanziellen Mittel genommen. Sie mussten letztendlich in den Untergrund gehen und bauten dort ein großes Netz von Vereinen auf.
Der Ausdruck „Zuckerbrot und Peitsche“ ist für die Gesetzgebung Bismarcks nicht ganz stimmig: Denn das Zuckerbrot war keines, weil es nicht für alle Armen, sondern, wie schon erwähnt, nur für eine Minderheit galt, Tagelöhner, Frauen, Kinder und Alte waren völlig ausgeschlossen. Die Peitsche, also das Sozialistengesetz, vertrieb die Sozialisten auch keineswegs, da sie sich in den Untergrund absetzten und so für die Polizei ungreifbar wurden.
Letztendlich fand durch die bismarckschen Sozialgesetzte eine Umverteilung der einzelnen Schichten statt. Durch den Versicherungszwang, also die Verstaatli- chung der gewerkschaftlichen Organisationen, wurde nur ein kleiner Teil der Ar- men begrifflich aus der Armut herausgehoben. Aus dem breiten Armutsbegriff entwickelte sich somit das Netz der sozialen Versicherung, was zur Folge hatte, dass nur noch ein kleiner Teil, nämlich diejenigen die Unterstützung nach dem Fürsorgerecht erhielten als die wirklich Armen galten (Wagner 1991 / S. 53).
Erst in der Weimarer Republik (1918-1933) fand eine wirklich effektive Verbes- serung für die Arbeiter statt, wie beispielsweise die Gewährung von Koalitions- und Tarifvertragsfreiheit, die Einführung von geregelten Arbeitszeiten (Einfüh- rung des acht Stunden Tages), gesetzliche Verankerung des Mitbestimmungs- rechts der Lohnabhängigen, Verbesserung der Rentenleistungen für Bergleute und ihre Hinterbliebenen, die Verabschiedung des Arbeitsvermittlungs- und Arbeitslo- sengesetzes, Vereinheitlichung und Verrechtlichung der Armenhilfe und die Ein- beziehung Nichterwerbstätiger in die Sozialpolitik (Bellermann 2001, S. 46-47). Leider wurden diese Neuregelungen in der Wirtschafts-, Gesellschafts- und Staatskrise der scheiternden Weimarerrepublik und des beginnenden Nationalso- zialismus (1930-1935) wieder aufgehoben. (Bellermann 2001, S. 17-19).
Die neugegründete Bundesrepublik Deutschland (1949) unternahm den Versuch die schon vorher vorhandenen Sozialgesetze wieder herzustellen und zu verbes- sern. Dieser scheiterte allerdings an den unterschiedlichen Positionen der Parteien, so dass in den Grundzügen an der Weimarer und Bismarckschen Sozialgesetzge- bung festgehalten wurde.
2.1 Resümee
Die Situation der Armen hat sich seit den Mittelalter nicht verbessert. Das Ver- ständnis von Armut hat sich sogar sehr zum negativen gewandelt, so dass Armut letztendlich immer mit eigener Schuld und Schande in Verbindung gebracht wird. Keine Epoche verfolgte das Ziel Armut zu vermindern oder zu beseitigen. Die ersten Maßnahmen gegen Armut (Bettelbehörden und Bettelverordnungen), aber auch die folgenden waren immer nur Reaktionen auf die jeweiligen Probleme, die durch die immer größer werdende Armut entstanden. Im Laufe der Zeit wurden immer mehr Personengruppen aus der allgemeinen Armut heraus gehoben: Den Anfang bildeten hier die ersten Unterstützungskassen der Gesellen, die Weiterfüh- rung war hier das staatlich organisierte Versicherungssystem Bismarcks, woraus sich letztendlich im Laufe der Entwicklung, nach dem Prinzip des umgestülpten Netzes, unser soziales Sicherungssystem gebildet hat.
Die Intention zielte nie darauf ab den Armen wirklich zu helfen und ihre Lebenslage zu verbessern, sondern es ging einzig und allein darum, über Macht innerhalb der Gesellschaft verfügen zu können und diese zukünftig zu sichern. Sozialpolitik wurde also immer aus politischen Gründen betrieben.
3. Das soziale Sicherungssystem - Das Haus der sozialen Sicherung
Die Bundesrepublik Deutschland entstand 1949. Das Bundessozialhilfegesetz entstand erst 1961. Um die Leistungen des sozialen Sicherungssystems zu be- schreiben benutz man häufig das Bild des „Hauses der sozialen Sicherung“, was den Grundsatz soziale Sicherung soll soziale Notlagen lindern und oder beseitigen (Bellermann 2001 / S. 25, Schmidt 1998 / S. 13) umfasst. Das Haus der sozialen Sicherung besteht aus drei Prinzipien: dem Versorgungsprinzip, dem Versiche- rungsprinzip und dem Fürsorgeprinzip, was im Folgenden erläutert wird. Es dient dazu einen Überblick der Leistungssituation Bedürftiger in der BRD zu erhalten.
3.1 Das Dach - Das Versorgungs- und Ausgleichsprinzip
Die Sozialleistungen nach dem Versorgungs- und Ausgleichsprinzip bestehen aus dem sozialen Ausgleich bzw. der sozialen Förderung, der sozialen Entschädigung und der sozialen Versorgung. Sie werden steuerfinanziert und sind damit beitragsunabhängige Leistungen.
Unter sozialem Ausgleich fallen die Leistungen und Förderungen des Staates, die soziale Benachteiligung ausgleichen sollen (Kindergeld, Wohngeld, Bafög). Die soziale Entschädigung umfasst die Leistungen, die bei Benachteiligung oder Versehrtheit im nachhinein gezahlt werden (Kriegsversehrtheit). Die soziale Versorgung betrifft, im Sinne einer bedarfsdeckenden Leistung, ausschließlich Beamte, die so gegen Risiken der Dienstunfähigkeit, im Falle eines Dienstunfalls oder altersbedingter Beeinträchtigungen geschützt werden.
Die Leistungen werden nach Lebenslagen und nicht nach Notlagen ausbezahlt, dass heißt, dass der Staat bestimmte Lebenslagen und Gruppen als unterstützenswert und schutzwürdig definiert (Bellermann 2001 / S. 71).
Die Assoziation die man mit den Begriffen Versorgung oder Ausgleich zieht, also dass der Empfänger mit den Geldleistungen seinen Bedarf decken kann und inso- fern versorgt wird, geht an der Wirklichkeit vorbei. Letztendlich können nämlich viele Personen diese Leistungen beanspruchen, so dass der Betrag für den Einzel- nen sehr gering ausfällt. Aus diesem Grund spricht man hier auch von dem Gieß- kannenprinzip (auch Millionäre erhalten Kindergeld). In einer wirklichen Notlage sind diese Leistungen daher eher ein „Tropfen auf dem heißen Stein“.
Generell unterliegen die Leistungen keiner Bedarfprüfung und werden auf Antrag hin sofort gewährt, aber auch hier gibt es aufgrund von Einsparungen Ausnahmen, das Wohngeld zum Beispiel unterliegt immer einer Bedarfsprüfung. Etwa 7% des Sozialbudgets wird jährlich für die Leistungen nach dem Versorgungs- und Ausgleichsprinzip ausgegeben (Bellermann 2001 / S. 72); die Träger sind staatliche und öffentlich- rechtliche.
3.2 Das Fundament - Das Fürsorgeprinzip
Die Leistungen nach dem Fürsorgeprinzip sind die Sozialhilfe und die Kinder- und Jugendhilfe (nach dem BSHG und KJHG). Sie wenden sich, im Unterschied zu den Versorgungsleistungen, der gesamten Lebenslage der Leistungsempfänger zu. Die Leistungen werden steuerfinanziert und können in Form von Geldleistun- gen, Sachleistungen oder Dienstleistungen erfolgen. Es sind keine Vorleistungen des Betroffenen erforderlich, darüber hinaus müssen die Leistungen sogar von den Trägern (Jugendamt, Sozialamt oder freie Träger) gewährleiste werden, wenn jemand der Hilfe bedürftig ist. Die Fürsorge wird als die letzte Maßnahme, die erst dann greift, wenn der Einzelne sich nicht mehr selbst helfen kann, er keine Hilfe von Angehörigen bekommt und andere Sozialleistungen nicht mehr reichen, um ein menschwürdiges Dasein führen zu können, bezeichnet. Man spricht daher auch vom Subsidiaritätsprinzip bzw. Nachrangprinzip; dafür gibt es allerdings eine genaue Bedürftigkeitsprüfung.
Nach dem Fürsorgeprinzip werden ungefähr 10% des Sozialbudgets verteilt. Die Träger sind staatliche oder private Träger (Bellermann 2001 / S. 72f)
3.3 Die fünf Säulen - Das Versicherungsprinzip
Die Sozialversicherungen nehmen den größten Teil (ca. 85%) des Sozialbudgets ein. Hierbei handelt es sich um die Leistungen der gesetzlichen Kranken-, Ren- ten-, Unfall-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung. Die Träger sind öffentlich- rechtliche.
Die Versicherungsleistungen sind mit Erwerbstätigkeit verbunden und werden beitragsfinanziert und sind grundsätzlich Folge einer öffentlich-rechtlichen Zwangsversicherung. Nach dem Versicherungsprinzip schließen sich Personen mit gleichen oder verwandten Risiken zusammen und zahlen in einem kollektiven Fond Beiträge ein. Die Ausnahme bilden hier im besonders starkem Maße die Renten- und Arbeitslosenversicherung. Da die Risiken nicht mehr alleine durch Beitragszahlungen gedeckt werden können, erhalten sie im Vergleich zu den anderen Versicherungen relativ hohe Zuschüsse vom Bund.
Bei Bedürftigkeit, wie beispielsweise im Krankheitsfalle, erhält der Versicherte aus diesem, von ihm mitfinanzierten Fond Leistungen, die ihn in dieser Lebenslage unterstützen sollen.
Insgesamt sind die Beiträge risikounabhängig bzw. abhängig vom Einkommen des Versicherten. Hier gilt das Äquivalenzprinzip: wer mehr verdient muss auch höhere Beiträge bezahlen, hat aber auch höhere Leistungsansprüche, zumindest bei Geldleistungen. Versichert sind alle nichtbeamteten Personen, die in einem nichtselbstständigen Arbeitsverhältnis stehen und mit ihrem Einkommen über der Geringverdienergrenze liegen (325 €). Die Ausnahme bildet hier die Arbeitslo- senversicherung, bei der man mehr als 325 € verdienen - allerdings nicht mehr als 15 Stunden in der Woche beschäftigt sein darf. Neu ist, dass der Arbeitgeber, wenn er Geringverdiener beschäftigt, 22% an Beiträgen in die Rentenversicherung und Pflegeversicherung einzahlen muss (Bellermann 2001 / S. 68ff) Bei der Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung gibt es eine Beitrag- bemessungsgrenze, die bei 4500 € liegt. Bei einem höheren Bruttoeinkommen werden die Abgaben an dieser Grenze festgemacht. Die Leistungen werden eben- falls nach dem Äquivalenzprinzip vergeben. Hier gilt das Prinzip der Vorleistung, man muss also für einen gewissen Zeitraum Beiträge eingezahlt haben, um An- spruch auf Leistungen zu haben. Die Höhe bzw. die Dauer der Zahlung sind eben- falls von Höhe und Dauer der Einzahlung abhängig, was man Anwartschaftszeit nennt. Um Leitungen zu erhalten muss ein entsprechender Antrag gestellt werden, eine Bedarfprüfung ist aufgrund der Anwartschaftszeiten nicht gegeben (Beller- mann 2001 / S. 69).
Bei der Krankenversicherung gilt das Bedarfsprinzip, was bedeutet, dass alle ge- sundheitlichen Leistungen, die zur Gesundung erforderlich sind bei Bedarf ge- währleistet werden. Darüber hinaus hat der Versicherte Anspruch auf Lohnfort- zahlung im Krankheitsfalle, die vom Arbeitgeber bis zu sechs Wochen gezahlt werden muss. Nach diesen sechs Wochen zahlt die Krankenkasse Krankengeld, was ebenfalls nach dem Äquivalenzprinzip gezahlt wird und zwischen 70% (bei hohem Verdienst) und 90% (bei niedrigem Verdienst) des letzten Nettoeinkom- mens liegt. Hierbei ist nicht die Einzahlungsdauer, sondern nur die Beitragshöhe entscheidend für die Höhe des Krankengeldes. Bei der Krankenversicherung gibt es außerdem eine Versicherungspflichtgrenze, die bei 3425 € liegt. Wer einen höheren Bruttolohn als 3425 € hat kann sich entscheiden, ob er entweder in der gesetzlichen Krankenkasse bleiben möchte oder ihr eine private Krankenversiche- rung vorzieht. Bleibt man gesetzlich krankenversichert, wird nicht das gesamte Einkommen, sondern nur das bis zur Versicherungspflichtgrenze zur Versiche- rungsabgabe herangezogen. Der große Unterschied von privaten und gesetzlichen Krankenversicherungen ist der, dass bei der gesetzlichen Krankenversicherung die Beiträge abhängig vom Verdienst des Versicherten sind, wohingegen bei der pri- vaten Krankenversicherung das Risiko (Krankheit, Alter) die Höhe der Beiträge bestimmt. Darüber hinaus bekommen bei der gesetzlichen Krankenversicherung alle Versicherten, trotz unterschiedlicher Beiträge, die gleichen Leistungen. Kin- der und nicht verdienende Ehepartner werden automatisch mitversichert. Das So- ziale an der gesetzlichen Sozialversicherung ist, wie am Beispiel der Krankenver- sicherung zu sehen, der Umverteilungseffekt zugunsten von Familienmitglieder, Einkommensschwacher oder alter Menschen und anderer mehr vom Risiko be- troffenen Personen. Damit die Umverteilung nicht zu große Ausmaße nimmt, gibt es die Beitragsbemessungsgrenze, sowie die Versicherungspflichtgrenze (Beller- mann 2001 / S. 69ff).
Die Pflegeversicherung folgt der Krankenversicherung im wesentlichen. Wer krankenversichert ist ist automatisch auch pflegeversichert. Pflegeversichert ist man also, wenn man die Geringverdienergrenze überschreitet und unterhalb der Versicherungspflichtgrenze liegt. Die Beiträge sind äquivalent zum Verdienst, man muss allerdings 5 Jahre eingezahlt haben, um einen Anspruch auf Leistungen zu haben. Es gibt drei Stufen der Pflegebedürftigkeit, welche die Leistungsverga- be je nach Schwere der Pflegebedürftigkeit einteilt. Nach dem Pflegeversiche- rungsgesetz (SGB XI) wird immer nur ein bestimmter Betrag gewährleistet. Die gestuften und bedarfsorientierten Leistungen decken in meisten Fällen nur einen Teil des Bedarfes, so dass viele Betroffene letztendlich Fälle für das Sozialamt werden.
Die Beitragssätze werden bei allen Versicherungen paritätisch von Arbeitnehmer und Arbeitgeber bezahlt. Die Ausnahme bildet hier die Unfallversicherung, bei der die Beitragszahlung nur beim Arbeitgeber liegt. Die Beitragssätze liegen bei der Krankenversicherung bei 12,5 - 14%, bei der Rentenversicherung bei 19,1%, bei der Pflegeversicherung bei 1,7% (Kompensationsregelung, Streichung des Buß- und Bettag in allen Bundesländern außer Sachsen), bei der Unfallversicherung bei 1 - 1,5% (was vom Berufsrisiko abhängig ist), und bei der Arbeitslosenversicherung bei 6,5% des Bruttolohns des Versicherten.
Die Träger sind öffentlich- rechtliche (Bellermann 2001 / S. 80).
3.4 Resümee
Aufgrund der Veränderung der Morbiditätsstruktur, der Überalterung, der Kosten- explosion aufgrund der Markabhängigkeit, schwankender Preise in der Pharmain- dustrie und dem Gesundheitswesen, sowie der kaum vorhandenen Kontrolle bei der Vergabe von Gesundheitsleistungen und der immer größer werdenden Zahl der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger (was auch darauf zurückzuführen ist, dass viele Arbeitslose durch das Versicherungsnetz fallen und so zu Sozialhilfe- empfängern werden) ergeben sich immer mehr Probleme in unserem Sozialversi- cherungssystem, die teilweise allein durch Beiträge nicht mehr finanziert werden können. Die Ausgleichsleistungen sind so gering, dass sie als wirkliche Hilfe in Notlagen nicht angesehen werden können. Im Fall der Fürsorge reagiert unser soziales Sicherungssystem gerade in Notlagen erst dann, wenn „das Kind schon in den Brunnen gefallen ist“. Es werden also fast ausschließlich Symptome bzw. Auswirkungen bekämpft, wobei die präventiven Maßnahmen und Ursachenbekämpfung mehr als unzureichend sind.
Das Bild „des Hauses der sozialen Sicherung“ suggeriert Sicherheit, was auch die Aussagen von M. G. Schmidt und M. Bellermann: „Soziale Sicherung soll sozia- le Notlagen lindern und oder beseitigen.“, unterstreicht. Letztendlich ist meiner Meinung nach allerdings das Bild des umgestülpten Netzes von Wolf Wagner, sowie seine Aussage, dass soziale Sicherung soziale Notlagen systematisch zu- lässt, eher zutreffend für das soziale Sicherungssystem der BRD, was ich im Fol- genden am dem Beispiel der Analyse des BSHG eingehender verdeutlichen möch- te.
4. Die Sozialhilfe als Beispiel von sozialer Sicherung
Am 01.06.1962 trat das BSHG in Kraft und löste die Verordnungsregeln zum Für- sorgewesen aus dem Jahre 1924 ab. Die Sozialhilfe gehört neben der Kinder- und Jugendhilfe zu den Fürsorgeleistungen, die im „Haus der sozialen Sicherung“ als Fundament - also als die letzte haltgebende Stufe dargestellt wird. Träger der So- zialhilfe sind örtliche und überörtliche Institutionen. Die einzelnen Vorrausset- zungen für die Gewährung von Sozialhilfe sind im Bundessozialhilfegesetz gere- gelt. Im Folgenden werden die sozialpolitisch relevanten Paragraphen im Hinblick darauf untersucht, ob das BSHG Armut beseitigen kann (Bellermann/Schmidt), oder systematisch zulassen will (Wagner).
4.1 Hintergrund
Nach dem Grundgesetz ist die Bundesrepublik Deutschland ein sozialer Bundes- staat (Art. 20 Abs. 1) und ein sozialer Rechtsstaat (Art. 28 Abs. 1). Der Begriff Sozialstaat wird nicht genau beschrieben, was sozial an unserem Sozialstaat ist wird nicht genau definiert, was auf historisch-politische Gründe zurückzuführen ist: Bei der Schaffung des Grundgesetzes 1949 war die Stimmverteilung im par- lamentarischen Rat zwischen den großen Parteien, SPD und CDU/CSU, nahezu gleich. Da sich die Parteien über ein Staatsmodell nicht einigen konnten, beließen sie die Formulierungen, was unter einen Sozialstaat zu verstehen ist, sehr allge- mein. Es ist auch auf Unstimmigkeiten zwischen den Parteien zurückzuführen, dass das Grundgesetz ursprünglich als eine Art erste Fassung angesehen wurde, welche später durch eine Überarbeitung des Grundgesetzes und dann auch durch eine „Verfassung“ genannte Fassung abgelöst werden sollte. Zu dieser Überarbei- tung kam es allerdings nach der Wiedervereinigung 1990 nicht.
Beide Parteien hofften damals die ersten Bundestagswahlen am 14.08.1949 zu gewinnen und so ihr Sozialstaatsmodell durchsetzen zu können. Bei denen dahin- terstehenden Verständnissen beider Parteien handelt es sich einmal um das Frei- heitsparadigma (CDU/CSU) und zum anderen um das Gleichheitsparadigma (SPD).
Man könnte beide Grundpositionen kritisch betrachtet auch so zusammen fassen, dass die am Freiheitsparadigma orientierte Sozialpolitik erst dann eingreift, wenn „das Kind schon in den Brunnen gefallen ist,“ und eine am Gleichheitsparadigma orientierte Sozialpolitik, „das Kind erst gar nicht reinfallen lässt“. Die CDU/CSU gewannen 1949 die Wahlen und wurden erst 1969 durch die sozial- liberale Koalition abgelöst, so dass sie ihr Verständnis verwirklichen und verankern konnten. In der Folge ist unser Sozialpolitisches System so angelegt, erst bei schon eingetretenen oder bestehenden Notlage im nachhinein einzugreifen und zu helfen. Somit treffen und beseitigen die meisten Maßnahmen auch nicht die dahinterstehenden Probleme, also den Kern, die Ursachen der Notlagen.
4.2 rechtliche Grundlagen
Durch die Artikel 1, 20a des Grundgesetzes und §9 des SGBI hat der Staat die Aufgabe, Menschen, die in Not geraten und kein menschenwürdiges Leben mehr führen können, aus dieser Not herauszuhelfen. Seit dem Inkrafttreten des Bundes- sozialhilfegesetzes (BSHG) gibt es eine Rechtgrundlage für die Sozialhilfe. Somit hat jeder Bedürftige ein Recht auf Hilfe in Not, was bei Verweigerung auch ein- klagbar ist.
Das BSHG unterscheidet zwei Arten von Hilfen einmal die Hilfe zum Lebensun- terhalt (HLU) und zum anderen die Hilfe in besonderen Lebenslagen (HbL) (§1 BSHG).
4.3 Der Sozialhilfesatz
Jeder der seinen Lebensunterhalt nicht aus eigener Kraft, eigenen Mitteln oder mit Hilfe anderer bestreiten kann, hat einen Anspruch auf die Hilfe zum Lebensunter- halt. Die Hilfe zum Lebensunterhalt umfasst die Leistungen, die ein Hilfeempfänger braucht um seinen täglichen Bedarf abzudecken (Ernährung, Kleidung, Unterkunft einschließlich Heizkosten). Da es Kosten gibt die, in der Regel bei jeder Person entstehen, wurden Regelsätze festgesetzt, die in den verschiedenen Bundesländern geringfügig unterschiedlich ausfallen.
Die Höhe der Regelsätze sind innerhalb der Hausgemeinschaft unterschiedlich hoch. Der Regelsatz des Haushaltsvorstandes, der sogenannte Eckregelsatz um- fasst die allgemeinen Kosten der Haushaltsführung, er beträgt zur Zeit in Nord- rhein-Westfalen 286,83€. Die übrigen Haushaltsangehörigen bekommen dement- sprechend weniger, da die allgemeinen laufenden Kosten durch den Eckregelsatz abgedeckt werden sollen. Insgesamt soll der Regelsatz das abdecken, was mindes- tens zum Leben benötigt wird.
Zu den Regelsätzen gehören außerdem Mehrbedarfszuschläge, zur Deckung des im Einzelfall bestehenden besonderen Bedarfs. Der Gesetzgeber hat für bestimmte Gruppen von Hilfeempfängern einen generellen Mehrbedarfszuschlag festgelegt. Dieser generelle Mehrbedarf gilt für:
a) Personen, die das 65 Lebensjahr vollendet haben und einen Schwerbehin- dertenausweis (Merkzeichen G) haben,
b) Erwerbsunfähige unter 65 Jahren mit einem Schwerbehindertenausweis (Merkzeichen G),
c) Werdende Mütter ab der 12. Schwangerschaftswoche,
d) Alleinerziehende mit zwei minderjährigen Kindern oder einem Kind, was das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
e) Behinderte nach Vollendung des 15. Lebensjahr in Schul-, Aus- oder Fort- bildung,
f) Personen, die auf eine bestimmte kostenaufwendige Ernährung angewie- sen sind (Diabetiker).
Ansonsten übernimmt das Sozialamt außerdem eine angemessene Warmmiete. Die Angemessenheit der Warmmiete setzt sich aus der Quadratmeterzahl, der an- gemessenen Heizkosten und dem generellen Mietpreis der Wohngegend zusam- men. Bei der Quadratmeterzahl ist entscheidend wie viele Personen in der Woh- nung leben (45-54qm pro Person und für jede weitere 15qm), bei den Heizkosten werden die Quadrat- und Kubikmeterzahl der Wohnung, die Anzahl der Außen- wände sowie die Lage der Wohnung, also ob sie im Erdgeschoss oder in einer der höheren Etagen liegt, miteinbezogen.
Darüber hinaus gibt es für die Sozialhilfeempfänger eventuelle einmalige Beihilfen, wie Kleidergeld (immer jeweils nach 6 Monaten), Übernahme der Kosten für Möbel und Schulbeihilfen etc..
Die Krankenversicherungskosten werden ebenfalls vom Sozialamt übernommen, bei privaten Krankenversicherungen werden nur dann die Kosten übernommen, wenn die Beträge nicht wesentlich höher sind als bei einer gesetzlichen Kranken- kasse.
Kurz zusammengefasst setzt sich der Sozialhilfesatz aus dem Regelsatz, eventuellen Mehrbedarf, den eventuellen einmaligen Beihilfen, der angemessenen Warmmiete sowie den Krankenversicherungskosten zusammen. Wichtig ist allerdings, dass alle zusätzlichen Einkünfte, wie eigenes Einkommen, Rente, Vermögen, Kindergeld etc., vom Sozialhilfesatz abgezogen werden.
Neben der Hilfe zum Lebensunterhalt gibt es die Hilfe in besonderen Lebenslagen. Sie wird bei einer Reihe von außergewöhnlichen Notlagen gewährt und umfasst beispielsweise die Hilfe zur Familienplanung, Eingliederungshilfe für Behinderte und die Krankenhilfe (§§ 11, 12, 13 BSHG).
4.4 Analyse der sozialpolitisch relevanten Paragraphen
4.4.1 §1 Inhalt und Aufgabe der Sozialhilfe
Im ersten Paragraphen des Bundessozialhilfegesetzes werden zwei Hilfen ganz besonders erwähnt, einmal die Hilfe zum Lebensunterhalt und zum anderen die Hilfe in besonderen Lebenslagen, die oben schon weiter ausgeführt wurden, was darauf schließen lässt, dass es sich hier um eine dichotome Gesellschaft handelt, in der ein Oben und ein Unten (die Hilfebedürftigen) existiert. Besonders interessant ist allerdings die Gewährung dieser Hilfen bzw. das Ge- währungskriterium. Gewährt werden diese Hilfen nämlich erst bei tatsächlicher Bedürftigkeit, also wenn der Betroffene unter die Grenze „menschenwürdiges Leben“ fällt, wobei Menschenwürde in diesem Fall nicht genau definiert wird. Darüber hinaus heißt es nicht, dass ein menschenwürdiges Leben sichergestellt, sondern dass ein Leben „ermöglicht“ werden soll, was der Würde des Menschens entspricht (BSHG §1 Abs. 2). Die Hilfe stellt somit eine Art Hilfestellung dar, die den Bedürftigen bis exakt zu der Grenze „menschenwürdiges Leben“ bringen soll, er ab dann wieder völlig auf sich allein gestellt ist - und somit auch verantwortlich dafür ist, ob er auf dieser Grenze bleib, auf- oder wieder absteigt. Nach dem §1 des BSHG`s wird somit ein menschenunwürdiges Leben erst zuge- lassen. Die Bedürftigen bekommen eine Minimalhilfe, die sie wieder in den Kreis der menschwürdig lebenden Menschen aufnimmt, sie sich dann allerdings aktiv beteiligen müssen um nicht erneut abzurutschen. Die Kräfte die nach unten ziehen werden nicht bekämpft. Die Ursachen bleiben unberücksichtigt, es gibt keine Prä- vention.
4.4.1.1 §2 Nachrang der Sozialhilfe
Der §2 beschreibt die Ausschlusskriterien, also wer kein Recht auf Sozialhilfe hat. Hierunter fallen Personen die sich selbst helfen können oder Hilfe von Angehörigen oder Trägern bekommen, die ausreichend ist, um ein menschenwürdiges Leben zu führen. Verpflichtungen anderer der Person gegenüber werden nicht berührt und dürfen auch nicht aus dem Grund versagt werden, um hierdurch einen Anspruch auf Sozialhilfe zu erwirken.
Um diesen Anspruch auf Sozialhilfe zu haben muss man eine Art „Dreischritt“ von Hilfemöglichkeiten durchlaufen. In der Unterstützung und Hilfestellung gibt es demnach eine Rangfolge nach dem Nachrangigkeitsprinzip: der erste Schritt ist die Eigenhilfe, also dass man als aller erstes alleine versucht selbst aus der schwierigen Situation heraus zu kommen. Gelingt dies nicht sind Verwandte auf grader Linie (also Kinder und Eltern) dem Bedürftigen gegenüber unterhalts- pflichtig. Verwandte zweiten Grades sind nur vermindert unterhaltspflichtig und spielen in der Praxis fast keine Rolle (nur bei vermögenden Verwandten). Darüber hinaus sind natürlich Ehepartner und Partner eheähnlicher Lebensgemeinschaften einander unterhaltspflichtig, interessant ist bei dieser Regelung, dass für eheähnli- che Lebensgemeinschaften zwar Pflichten entstehen, daraus aber keine Rechte geltend gemacht werden können.
Der §2 des deutschen BSHG`s ist besonders, da er der einzige Paragraph ist, der gesetzlich festlegt, wer wann keine Hilfe bekommt. Diese Negativformulierung: „Sozialhilfe erhält nicht, wer...,“ (BSHG §2) zeigt die typische Vorgehensweise des BSHG´s. Die ersten zwei Paragraphen beschreiben demnach keinerlei An- sprüche des Bedürftigen, sondern basieren auf den Grundsätzen des amtlichen Misstrauens, der Erniedrigung und der tendenziellen Abwehr von Ansprüchen: Das Sozialamt bringt den Bedürftigen in eine paradoxe Situation. Er geht in einer hilfebedürftigen Lebenssituation zum Sozialamt, um Hilfe zu bekommen, die er und Dritte nicht mehr leisten können. Er hat also eingesehen, dass es für ihn zur Zeit keinen Ausweg gibt und er sich nicht mehr selbst helfen kann. Statt Hilfe, prägen Misstrauen und Entmündigung als erstes das Bild. Das amtliche Misstauen äußert sich insofern, dass der „vermeindlich“ Bedürftige diese Bedürftigkeit zu aller erst nachweisen muss, um überhaupt einen Anspruch zu erwirken. Dadurch wird ihm durch das Sozialamt eine Unterstellung auf zwei Ebenen entgegenge- bracht: nämlich entweder ein Versager (da es ihm nicht gelungen ist, sich selbst zu helfen), oder ein Betrüger zu sein, der möglicher Weise nur vortäuscht bedürf- tig zu sein. Darüber hinaus wird er entmündigt, da nur das Sozialamt genau fest- stellen kann, ob er in der Lage ist sich selbst zuhelfen, Hilfe anderer in Anspruch nehmen kann oder tatsächlich nach den Kriterien des Sozialamtes bedürftig ist. Diese negative Herangehensweise zeigt die tendenzielle Abwehr seitens des Ge- setzes auf.
Die Gefahr dieses Nachrangigkeitsgrundsatzes besteht darin, dass dieser in eine Abschiebe- und Weiterweisungspraxis verkehrt werden kann, um so die Gewährung von Sozialhilfe ausschließen bzw. die Leistungsvergabe so niedrig wie möglich halten zu können.
4.4.2 §3 Besonderheiten des Einzelfalles
Nach dem §3 richtet sich Art, Form und Maß der Sozialhilfe „nach den Besonderheiten des Einzelfalles“. Hier handelt es sich um die Person des Hilfeempfängers, die Art seines Bedarfes und den örtlichen Verhältnissen“ (BSHG §3). Dieser Grundsatz der Individualisierung ist ebenfalls ein, für Sozialhilfe charakteristischer Leitgedanke, welcher sich auf drei Ebenen entfaltet:
a) Individualisierung bei der Feststellung einer Notlage - der Sozialhilfeträger muss feststellen, inwieweit und aus welchen Gründen dem Bedürftigen Mittel und Kräfte fehlen, aus eigener Kraft die Notsituation zu überwinden.
b) Individualisierung der Hilfeleistung - eine individuelle Notlage erfordert auch eine individuell gestaltete Hilfeleistung.
c) Individualität der Sozialhilfe - jeder Hilfebedürftige hat einen individuellen und nicht mit anderen Personen zu vergleichenden Hilfeanspruch. Es wird also nicht von einer Personengruppe, sondern von jedem einzelnen Hilfebedürftigen ausgegangen.
Der Grundsatz der individuellen Sozialhilfeleistung findet vor allem bei dem Er- messenspielraum des Sachbearbeiters bei Art, Form und Maß des Einzelfalles und bei den Soll- und Kannleistungen seinen Anwendungsbereich. Um eine willkürli- che Leistungsvergabe auszuschließen, gibt es im §4 des BSHG`s allerdings die rechtliche Bestimmung, dass der Sachbearbeiter nach „pflichtgemäßem Ermes- sen“ den Fall beurteilen muss. Falls ein Antrag abgewiesen wurde und der An- tragsteller meint, dass ihm Willkür widerfahren ist, kann er von seinem Wider- spruchsrecht Gebrauch machen.
Der Individualisierungsgrundsatz setzt voraus, dass eine allumfassende Analyse der Notsituation des Einzelnen gemacht wird. Für den Bedürftigen bedeutet dies, dass ihm nach dem vorherigen Misstrauen und der tendenziellen Abwehr von An- sprüchen nun eine absolute Verkehrung der Verhaltensweise des Sozialamtes entgegen gebracht wird. Man könnte auch sagen, dass die Herangehensweise des Sozialamtes von der Abwehr in den Röntgenblick geht. Diese extreme Durchleuchtung des Einzelfalles und das plötzliche gesteigerte Interesse an dem Klienten und seiner Notsituation, kann dem Hilfebedürftigen, wie eine Art Aushorchung vorkommen. Durch das vorherige Misstrauen und der Abwehr von Ansprüchen ist die Vertrauensbasis erschüttert. Der Hilfebedürftige fühlt sich sehr wahrscheinlich ausgeliefert und ist verunsichert.
4.4.3 Die Arbeitskraft §§ 18, 19, 20 und 25
Nach dem §18 Abs. 1 des BSHG`s ist jeder Sozialhilfeempfänger verpflichtet seine Arbeitskraft zur Beschaffung des Lebensunterhalts (BSHG §18) einzuset- zen. Des weiteren heißt es in Abs. 2, dass darauf hinzuwirken ist, dass sich der Bedürftige, um Arbeit bemüht. Das „Hinzuwirken“ ist demnach eine gesetzlich verankerte Verpflichtung seitens des Sozialamtes, das Bemühen um - und eventu- elle Finden vom Arbeit zu dokumentieren. Der Hilfeempfänger ist außerdem ver- pflichtet jede zumutbare Arbeit anzunehmen. Als unzumutbar gilt hier:
a.) wenn die Arbeit ihn geistig oder körperlich überfordert (Unterforderung ist kein Kriterium)
b.) wenn dem Hilfeempfänger die künftige Ausübung seiner bisherigen Tätig- keit wesentlich erschwert werden würde.
c.) wenn die Arbeit die geordnete Erziehung seines bis zu drei Jahre alten Kindes gefährdet würde, oder
d.) wenn ein wichtiger Grund der Arbeit entgegensteht.
Hier wird deutlich, dass das Sozialamt darauf abzielt, dass der Hilfeempfänger wieder unabhängig von der Sozialhilfe leben kann, indem er seinen Lebensunter- halt selbst durch den Einsatz seiner Arbeitskraft bestreitet. Daraus kann man ab- leiten, dass das in §1 erwähnte menschenwürdige Leben, dann erreicht wird, wenn man durch Arbeit für sich selbst und seine Angehörigen aufkommen kann. Arbeit dient hier also zur Sicherstellung des Lebensunterhalt. Insgesamt geht das BSHG davon aus das es in Deutschland genügend Arbeitsplätze gibt und für Hilfeemp- fänger, „die keine Arbeit finden können“ (§19 Abs. 1 BSHG) sollen Arbeitsgele- genheiten geschaffen werden. Für diese Tätigkeiten können sie das übliche Ar- beitsentgelt oder zuzüglich der Hilfe zum Lebensunterhalt eine angemessene Mehraufwandsentschädigung erhalten. Besonders hervorgehoben wird hier die gemeinnützige und zusätzliche Arbeit. Zusätzliche und gemeinnützige Arbeit ist weder eigennützig, existenzsichernd, noch sonst eine in diesem Umfang oder zu diesem Zeitpunkt dringend erforderliche Arbeit, was für den Hilfeempfänger ver- mutlich nicht sonderlich motivierend ist. Sie gilt eher zur Eingliederung in das Arbeitsleben, zur Arbeitsgewöhnung, soll extrafunktionale Fähigkeiten vermitteln und so den Hilfebedürftigen auf die Übernahme einer regulären und existenzsi- chernden Erwerbstätigkeit vorbereiten. Durch den § 20 erhält das Sozialamt die Legitimation, den Hilfeempfänger auf seine Bereitschaft hin zu überprüfen, was eindeutig eine Entmündigung von erwachsenen Menschen darstellt. Darüber hin- aus wird ihm damit unterstellt, „sich drücken“ zu wollen.
Bei Weigerung dem §§ 18, 19, und 20 nachzukommen folgen Sanktionen bzw. Kürzungen der Leistungen in einer ersten Stufe um 25% des Regelsatzes mit einer anschließenden Belehrung und bei weiterer Weigerung bis zum völligen Entzug der Sozialhilfe. Das Sozialamt arbeitet also bei Weigerung mit pädagogischen Maßnahmen sowie der Entmündigung und Erniedrigung des Empfängers. In dem Fall einer Sperrzeit vom Arbeitsamt, hat der Betroffenen auch beim Sozialamt seinen Rechtanspruch auf Sozialhilfe verloren und bekommt nur noch 75% des Regelsatzes. Diese 75% des Regelsatzes wird als das für das Leben Unerlässliche bezeichnet. Ein menschenwürdiges Leben ist somit nicht mehr gegeben. Das Individualisierungsprinzip wird hier (wie schon in §3) insofern deutlich, dass der Hilfeempfänger selbst für seine Situation verantwortlich gemacht wird. Die Kürzungen werden vom Gesetzgeber vorgeschrieben.
4.5 Praxis der Sozialhilfe
Seit dem Inkrafttreten des BSHG`s gibt es einen Rechtsanspruch auf Sozialhilfe, was den Grundsatz nahe legt, dass Menschen die in Not geraten Hilfe bekommen. Die optimistische Erwartung in der BRD für alle sozialen Risiken abgesichert zu sein, steht allerdings im offensichtlichen Widerspruch zur Rechtswirklichkeit (was ja schon die Analyse der sozialpolitisch relevanten Paragraphen gezeigt hat). Ein ganz erheblicher Teil (fast die Hälfte) der Hilfebedürftigen, die einen An- spruch auf Sozialhilfe haben realisieren ihn nicht. Wichtig ist hier, dass es nicht allein um Unwissenheit bzw. um ein selbstverschuldetes Fehlverhalten der Be- dürftigen, sondern um ein methodisches Vorgehen der öffentlichen Sozialverwal- tung geht, die den gesetzlichen Bestimmungen des BSHG`s folgt, sie genauer gesagt ausführt, was im Folgenden dargestellt wird.
Ein repräsentatives Forschungsergebnis von Franz-Xaver Kaufmann aus dem Jahre 1979, mit dem Titel: „Bürgernähe in der Sozialpolitik“, ging folgenden Fragen nach: ob die Leistungen überhaupt bei den Bedürftigen ankommen, und vor allem was die Sachbearbeiter in den Sozialämtern über die Effektivität der Sozialhilfe und ihrer Arbeit denken. Die Befragung der Sachbearbeiter verlief anonym, um ein möglichst unverfälschtes und ehrliches Bild über die Meinung der im Sozialamt tätigen Sozialarbeiter zu bekommen.
Unter anderem kam man zu dem Ergebnis, dass nur 10% der Sachbearbeiter der Meinung waren, dass die Hilfesuchenden im Kontakt mit dem Sozialamt, die ih- nen zustehenden Leistungen erhalten. Wichtig ist hierbei allerdings, dass die Per- spektive von 90% der Sachbearbeiter dahingehend war, dass die meisten Hilfe- empfänger phlegmatisch in der Sozialhilfe verharren wollen, ihre selbstständige Motivation nicht ausreichen vorhanden wäre und sie somit zuviel an Leistungen erhalten würden.
Eine andere Untersuchung des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Ge- sundheit von 1985 unter dem Titel: „Bürgernähe in der Sozialhilfeverwaltung“, beschäftigte sich mit dem Einfluss des Klientenverhaltens auf die Höhe der Leis- tung im Erstgespräch. Hier kam man zu dem Ergebnis, dass Bedürftige, die ihre Situation und ihre Ansprüche sachlich direkt ausdrücken konnten deutlich bevor- zugt wurden; anschließend folgte die persönlich direkte, dann kam die sachlich direkte Initiative. Am wenigsten bekamen die Bedürftigen, die ihre Notlage per- sönlich indirekt darstellten, was bei einer Notlage wohl die häufigste Form der Darstellung sein wird. Darüber hinaus werden statistisch gesehen die meisten Per- sonen mit höheren Schulabschluss oder gar Hochschulabschluss nicht zu Sozial- hilfeempfängern, betroffen sind vorwiegend Personen ohne oder mit niedrigen Schulabschluss bzw. Personen ohne erlernten Ausbildungsberuf. Die Bewilligung bzw. Höhe der Leistungen an sprachlichen Fähigkeiten festzumachen geht folg- lich an dem Großteil des Klientels vorbei, und ist letztendlich wieder eine Privilegierung bereits Privilegierter.
Darüber hinaus gibt es viele Hindernisse sobald der Bedürftige das Sozialamt betritt:
Als erstes muss er sich über die Öffnungszeiten informiert haben, die teilweise sehr unregelmäßig oder nur vormittags sind. Dann muss er anhand von Tafeln herausfinden, welcher Sachbearbeiter für ihn zuständig ist. Ist er der deutschen Sprache nicht mächtig stellt sich dieses schon als erstes großes Problem dar; um weiterzukommen muss er sich durchfragen. Ist er letztendlich an der richtigen Tür angekommen, ist der Sachbearbeiter häufig „zur Zeit nicht anzutreffen“ und er wird zu einer anderen Tür verwiesen. Lange Wartezeiten auf stickigen Gängen und Fluren sind nicht selten. Die kurze und oft mangelnde Beratung der Sachbe- arbeiter wird seitens der Sozialämter auf die hohe Belastung der Sachbearbeiter zurückgeführt, und hat damit zu tun, dass das Niveau der Ausgaben der Kommune so gering, wie möglich gehalten werden soll. Für den Klienten ist das eine mehr als unbefriedigende Situation, die seinen Anforderungen nicht gerecht werden kann, da er zu wenig Information über seine Ansprüche und den Hilfemöglichkei- ten erhält. Das Antragverfahren und die hiermit verbundene Bedürftigkeitsprü- fung bringen eine immens hohe Mitwirkungspflicht der Hilfesuchenden mit sich. Damit es zu einer Bearbeitung des Antrages kommt müssen zuvor bestimmte Un- terlagen des Hilfebedürftigen (Personalausweis, Mietvertrag, Kontoauszüge, Lohnbescheinigungen etc.) vorliegen. Für den Betroffenen stellt dies meist eine zeitaufwändige und zermürbende Sucherei und Lauferei dar. Danach muss seitens des Bedürftigen eine ausführliche Begründung des Antrages abgegeben werden. Er muss also sein individuelles Versagen schriftlich dokumentieren. Zum Schluss muss er außerdem, noch unterschreiben, dass er darauf hingewiesen wurde, dass wissentlich falsche Angaben oder absichtliches Verschweigen von Tatsachen ei- nen Betrug im Sinne des §1263 STGB darstellen und strafrechtlich verfolgt wer- den. Die Intensität des Antragverfahren, also die Aufdeckung und Darlegung aller persönlichen Verhältnisse und Lebensumstände, stellen den Bedürftigen vor die Wahl sich dem Röntgenblick zu unterwerfen oder auf die Hilfe zu verzichten. Entscheidet er sich für letzteres hat auch der letzte Filter seine Wirkung getan.
Die Praxis der Sozialhilfe folgt dem gesetzlich verankerten Grundsatz und stellt somit, mit ihren systematisch eingesetzten Barrieren und Filtern der Sozialverwal- tung, die Ausführung der tendenziellen Abwehr von Ansprüchen dar. Die Aus- wirkungen auf das Klientenverhalten sind nicht verwunderlich: die meisten sind verunsichert, ergreifen wenig Initiative, wissen nichts von ihren Ansprüchen, ha- ben keinerlei Erwartungen und geben sich ganz in die Hände der Sachbearbeiter, was letztendlich eine Form des Sichauslieferns und Ausgeliefertseins darstellt.
5. Frauen und Armut
In der Bundesrepublik Deutschland erhalten etwa 3,5% der Bevölkerung Sozial- hilfe. Der Frauenanteil der Sozihilfeempfänger lag in den letzten Jahren bei unge- fähr 56% (http://www.dbb.de/aktuell/frauen_im_dbb_0901.htm am 13.04.02). Die Gefährdung von Frauen in Armut zu verfallen ist nach wie vor höher als bei Männern. Dies gilt vor allem für bestimmte Gruppen von Frauen, wie Alleinerziehende, Rentnerrinnen und Witwen.
Etwa 20% der Alleinerziehenden beziehen Sozialhilfe, wobei hier vor allem jün- gere, allein erziehende Mütter mit Kindern unter 6 Jahren betroffen sind (http://www.dbb.de/aktuell/frauen_im_dbb_0901.hzm am 13.04.02). Alleinerzie- hende Mütter bilden in der Sozialstatistik eine große Gruppe, so dass auch immer mehr Kinder in die Statistik kommen (13,6% der Kinder unter 15 Jahren leben in der BRD in Armut). Die meisten Sozialhilfeempfänger sind Kurzbezieher von etwa einem Jahr. Alleinerziehende Frauen beziehen durchschnittlich 23 Monate lang Sozialhilfe. Die Gründe hierfür liegen wahrscheinlich in der Kinderbetreuung und Kinderfinanzierung, die einmal natürlich viel Zeit in Anspruch nimmt, aber auch sehr kostenaufwendig ist. Darüber hinaus sind die Väter zwar unterhalts- pflichtig, die Unterhaltszahlungen erfolgen allerdings meist gar nicht oder in un- zureichender Höhe, so dass die Mütter häufig alleine für die finanzielle Sicherung der Familie verantwortlich sind (http://www.vamv-bundesverband.de am 13.04.2002).
Frauen sind für die unbezahlte oder auch reproduktive Arbeit in unserer Gesell- schaft verantwortlich, worin auch hauptsächlich die Gründe ihres hohen Armutsri- sikos liegen. Neben der weitgehend rechtlichen Gleichstellung der Frau, haben Frauen zwar auch die gleichen Bildungschancen wie die Männer, die revolutionä- re Angleichung auf dem Arbeitsmarkt blieb bislang allerdings aus. Frauen beklei- den schlechter bezahlte Stellen und sind kaum in Männerberufen wiederzufinden. Je wichtiger eine Position, je mächtiger eine Gruppe ist, desto weniger Frauen sind vorzufinden (Beck 1986 / S. 61-69). Darüber hinaus ist das Angebot an Kin- derbetreuung, aber auch die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt so unzureichend, dass es für beide Elternteile unmöglich ist, jeweils eine volle Beschäftigung nach- gehen - oder beide eine 3/4-Stelle annehmen könnten. Hausarbeit und Kinder- betreuung ist nach wie vor Frauensache, Karriere muss entweder zusätzlich ge- macht werden und so irgendwie miteinander verbunden werden, oder sie bleibt auf der Strecke, was letztendlich bei den meisten Frauen der Fall ist.
Wohingegen die Arbeitslosigkeit eher ein Verarmungsgrund von Männern dar- stellt, liegen die Ursachen für Frauen in Armut zu verfallen woanders. Durch die Lohnarbeitszentrierung unseres sozialen Sicherungssystems ergibt sich eine man- gelnde Absicherung von Haus-, Pflege- und Erziehungsarbeit, woraus sich man- gelnde Versicherungs- und Versorgungsansprüche ergeben (Kulwik, Sauer 1996 / S. 206-207). Entfällt die Rolle des Partners, der für die finanzielle Absicherung verantwortlich ist, reicht die eigene Absicherung der Frau nicht mehr aus, so dass viele Frauen nach einer Trennung oder nach dem Tode ihres Lebenspartners in Armut verfallen. Dies betrifft beispielsweise auch viele Witwen, die lediglich 60% der Rente ihres verstorbenen Mannes beziehen, welche dann häufig unterhalb des Sozialhilfeniveaus ausfällt.
6. Resümee
Jeder Bedürftige hat nach dem BSHG der Bundesrepublik Deutschland zwar ein Recht auf Sozialhilfe, aber dennoch stellt die Sozialhilfe kein Fundament bzw. die letzte haltgebende Sicherheit des sozialen Sicherungssystems dar. Stattdessen werden auch hier, wie es Wolf Wagner formuliert, Notlagen systematisch zuge- lassen. Das BSHG ist ein reaktives Gesetz, was bedeutet, dass es erst dann in Kraft tritt, wenn eine Notlage bereits besteht. Hier liegt auch die Ursache dafür, dass Sozialhilfeempfänger, wie es ebenfalls Wolf Wagner sagt, Dauerklienten des Sozialstaates werden. Die Entstehung und Entwicklung der Notlage interessiert nicht, es gibt keine präventiven Maßnahmen. Die Wirkungsperspektive des BSHG`s zielt einzig und allein darauf ab die Bedürftigen so schnell wie möglich aus ihrer Notsituation herauszuhelfen, um so ihre Arbeitskraft und somit die Ei- genhilfe bzw. Selbstständigkeit wiederherzustellen. Der Klient durchlebt beim Sozialamt ein Wechselbad der Gefühle, in dem er anfangs die Abwehr von An- sprüchen dann allerdings ein gesteigertes Interesse an allen Bereichen seines Le- ben seitens des Sozialamtes erlebt, bei dem er all seine persönlichen Verhältnisse offen legen muss. Er ist verpflichtet seine Arbeitskraft in jedem Fall zur Verfü- gung zustellen, selbst wenn es sich um noch so sinnlose Tätigkeiten handelt, die einzig und allein dafür geschaffen wurden, dass er das Arbeiten nicht verlernt. Das Sozialamt arbeitet mit erzieherischen und belehrenden Maßnahmen und setzt bei nicht Befolgung das Druckmittel, der Streichung von Leistung ein. Gefühle von Verunsicherung und Demütigung seitens des Klientens können mögliche Fol- gen dieser Vorgehensweise darstellen. Hier wird sich bei dem Klienten sicherlich nicht selten die Frage stellen, welche Lebenssituation jetzt tatsächlich lebensun- würdiger war, die vor oder nach dem Besuch im Sozialamt?! Nach Wolf Wagner ist dies, nämlich die Angst vor der Armut zu schüren gerade, dass was schon seit Ende des Mittelalters die gebräuchliche Taktik seitens des Staates war Armut zu beseitigen, die Kosten so gering wie möglich zu halten und die Armen so an den untersten Rand der Gesellschaft zu platzieren. Die gesetzlich verankerte tenden- zielle Abwehr von Ansprüchen, die mangelnde Aufklärung, aber auch die Praxis der Sozialhilfe im Sozialamt sind die Gründe für die Hohe Dunkelziffer der An- spruchsberechtigten (etwa 48 %), die ihre Ansprüche entweder aus Unwissenheit, Angst oder Stolz nie geltend machen würden. Darüber hinaus sind die Regelsätze verhältnismäßig niedrig, so dass zwar die unmittelbar zum Leben notwendigen Dinge, wie Lebensmittel, Wohnung und Kleidung gewährleistet sind, allerdings eine Teilnahme am kulturellen Leben der Gesellschaft einfach nicht möglich ist, was somit auch eine Isolation und Ausgrenzung für die Sozialhilfeempfänger dar- stellt.
Darüber hinaus werden die besonderen Gründe der Frauen Sozialhilfe in Anspruch nehmen zu müssen (die Kindererziehung und -betreuung, Hausarbeit etc.) bzw. die unzureichende Absicherung dieser Tätigkeiten in keinster Weise von unserem Sozialensicherungssystem berücksichtigt; obwohl sie durch die Kindererziehung maßgeblich am Erhalt des Systems beteiligt sind.
Je länger und öfter ein Bedürftiger von Sozialhilfe abhängig ist, desto schwieriger wird es für ihn wieder herauszugelangen. Dies betrifft vor allem Langzeitarbeitslose, alte Menschen, Menschen mit niedriger Schulbildung, Behinderte etc.. Wolf Wagner spricht hier von einem umgestülpten Netz, was nicht durchhängt, sondern steil bergab geht. Rutscht man aus bestimmten Gründen ab, so muss man sich schnell festhalten, ist man nämlich erst einmal unten angekommen ist das Netz zu straff gespannt, dass man sehr schwer wieder heraufklettern kann und stattdessen oft im „Sand der Arena“ liegen bleibt (Wagner 1991 / S. 54).
Wolf Dieter Narr sagt hierzu: „Der Sozialstaat ist auch in seiner besten Form nicht das Netz, das alles umfasst, sondern ein unbestimmtes Gefüge, das zwar im Zentrum die Leute auffängt, aber je weiter man nach außen geht, um so eher lässt es sie durchfallen“ (Narr 1999 / S. 8).
Literaturliste:
Beck, Ulrich: Risikogesellschaft, Auf dem Weg in eine andere Moderne. Surkamp, Frankfurt am Main 1986
Bellermann, Martin: Sozialpolitik, Eine Einführung für soziale Berufe. Lambertus, Freiburg in Breisgau 2001
http://www.dbb.de/aktuell/frauen_im_dbb_0901.hzm am 13.04.02
http://www.Vamv-bundesverband.de/PDFs/5PresseOnline310801.PDF am 13.04.2002
Kulwik, Teresa; Sauer, Birgit: Der halbierte Staat. Grundlage feministischer Politikwissenschaft. 1996
Narr, Wolf-Dieter: Zukunft des Sozialstaates - als Zukunft einer Illusion?. AGSpak-Bücher, Neu-Ulm 1999
Stascheit, Ulrich: Gesetze für Sozialberufe, Die Gesetzessammlung für Studium und Praxis. Fachhochschulverlag, Frankfurt am Main 2001
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Textes?
Dieser Text behandelt umfassend das Thema Armut in Deutschland, wobei historische Entwicklungen, das soziale Sicherungssystem, die Sozialhilfe (BSHG) und die besondere Gefährdung von Frauen in Armut analysiert werden.
Was sind die Hauptpunkte der historischen Entwicklung von Armut, die in diesem Text behandelt werden?
Der Text beschreibt, wie sich das Verständnis von Armut vom Mittelalter, in dem sie als Teil der Gesellschaft akzeptiert und durch Mildtätigkeit gemildert wurde, hin zur Industrialisierung wandelte. Mit der Industrialisierung wurde Armut zunehmend als Schande betrachtet und mit Strafe belegt. Die bismarckschen Sozialgesetze und die Weimarer Republik brachten zwar Verbesserungen, die jedoch durch Krisen und den Nationalsozialismus wieder aufgehoben wurden.
Wie wird das soziale Sicherungssystem in Deutschland im Text dargestellt?
Das soziale Sicherungssystem wird mit dem Bild des "Hauses der sozialen Sicherung" beschrieben, das aus drei Prinzipien besteht: dem Versorgungs- und Ausgleichsprinzip (Dach), dem Fürsorgeprinzip (Fundament) und dem Versicherungsprinzip (fünf Säulen). Jedes Prinzip wird hinsichtlich seiner Funktionsweise und Leistungen erläutert.
Was ist die Sozialhilfe (BSHG) und wie funktioniert sie laut Text?
Die Sozialhilfe, geregelt durch das Bundessozialhilfegesetz (BSHG), gehört zum Fürsorgeprinzip und soll Menschen in Notlagen helfen. Der Text analysiert die sozialpolitisch relevanten Paragraphen des BSHG, um zu beurteilen, ob es Armut beseitigt oder systematisch zulässt. Es werden die Hilfen zum Lebensunterhalt (HLU) und die Hilfen in besonderen Lebenslagen (HbL) erläutert.
Wie hoch ist der Sozialhilfesatz und was beinhaltet er?
Der Sozialhilfesatz setzt sich zusammen aus dem Regelsatz, eventuellen Mehrbedarfszuschlägen, einmaligen Beihilfen, der angemessenen Warmmiete sowie den Krankenversicherungskosten. Er soll den täglichen Bedarf eines Hilfeempfängers abdecken (Ernährung, Kleidung, Unterkunft einschließlich Heizkosten).
Welche Kritik wird am BSHG geübt?
Der Text kritisiert das BSHG dafür, dass es erst bei tatsächlicher Bedürftigkeit eingreift, also wenn Menschen unter die Grenze "menschenwürdiges Leben" fallen. Es wird bemängelt, dass die Ursachen der Notlagen nicht bekämpft werden und es an Prävention mangelt. Außerdem wird das Misstrauen gegenüber Hilfesuchenden und die tendenzielle Abwehr von Ansprüchen kritisiert.
Was wird über die Praxis der Sozialhilfe gesagt?
Die Praxis der Sozialhilfe wird als systematisch mit Barrieren und Filtern versehen dargestellt, was zu einer tendenziellen Abwehr von Ansprüchen führt. Dies resultiert in Verunsicherung, mangelnder Initiative und Unkenntnis der Ansprüche bei den Hilfesuchenden.
Warum sind Frauen besonders von Armut bedroht?
Frauen sind besonders gefährdet, in Armut zu geraten, vor allem Alleinerziehende, Rentnerinnen und Witwen. Die Gründe liegen in der unbezahlten oder reproduktiven Arbeit, schlechter bezahlten Stellen, mangelnder Kinderbetreuung und der Lohnarbeitszentrierung des sozialen Sicherungssystems, was zu mangelnden Versicherungs- und Versorgungsansprüchen führt.
Welche Schlussfolgerung wird im Resümee gezogen?
Die Sozialhilfe wird nicht als Fundament des sozialen Sicherungssystems betrachtet, sondern es werden Notlagen systematisch zugelassen. Das BSHG wird als reaktives Gesetz kritisiert, das erst bei bestehender Notlage eingreift und keine präventiven Maßnahmen ergreift. Frauen werden besonders benachteiligt, da ihre besonderen Lebensumstände nicht berücksichtigt werden.
- Quote paper
- Carmen Stricker (Author), 2003, Die Sozialhilfe und ihre Wirksamkeit gegen Armut, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107229