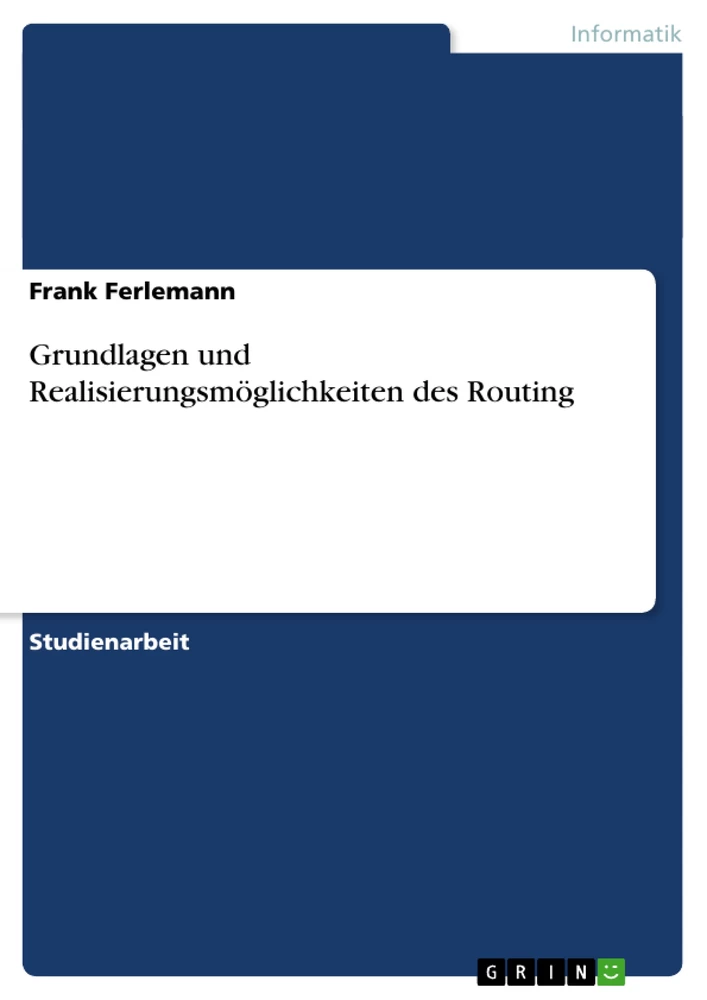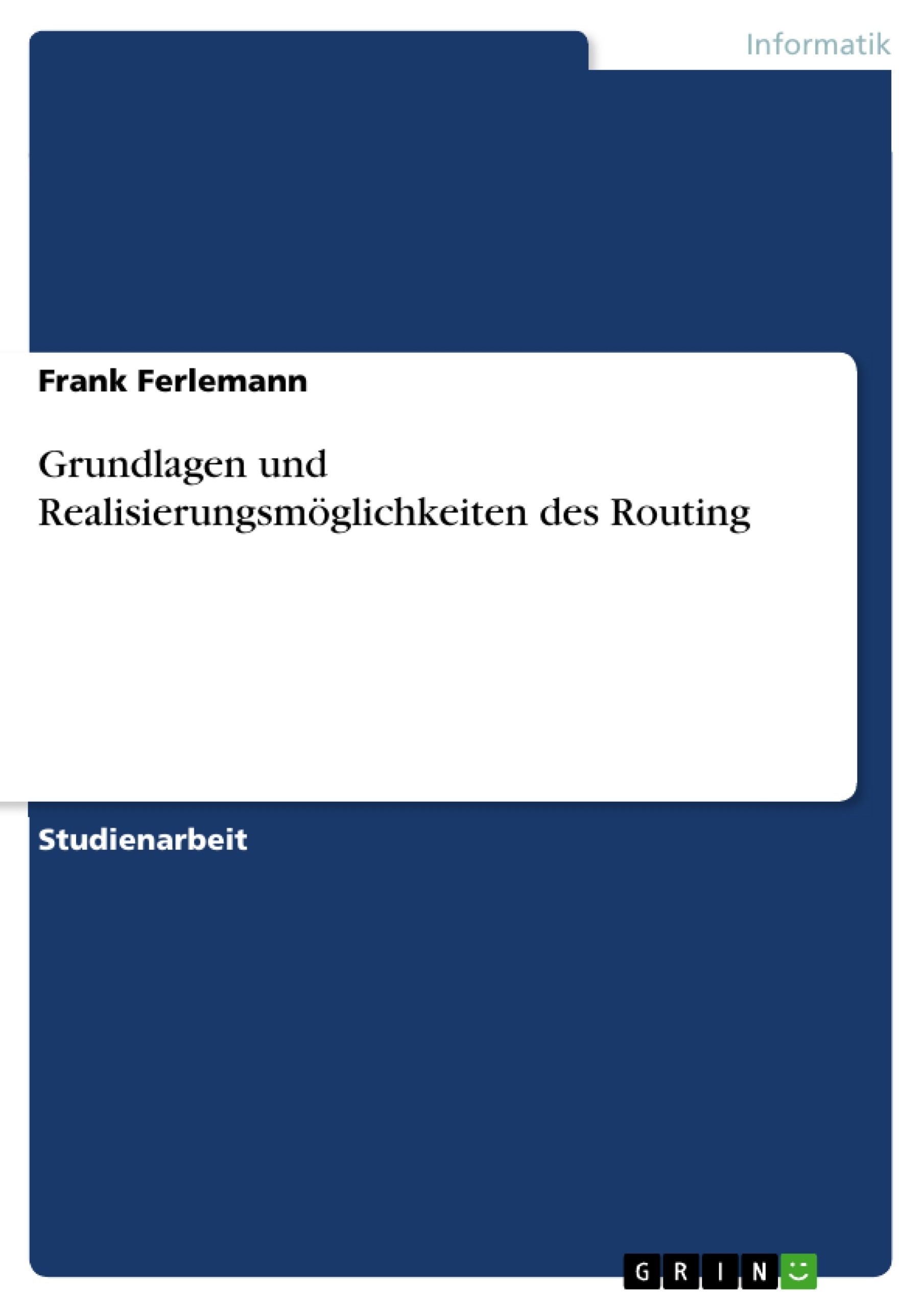Stellen Sie sich vor, Ihr digitales Universum ist ein riesiges, komplexes Labyrinth aus Netzwerken. Wie finden Ihre Daten den Weg von A nach B, und wer weist ihnen die Richtung? Dieses Buch enthüllt die faszinierende Welt des Routings, die unsichtbare Infrastruktur, die das moderne Internet und lokale Netzwerke am Laufen hält. Tauchen Sie ein in die Grundlagen des Routings und entdecken Sie, wie Router – die Verkehrspolizisten des Internets – Datenpakete intelligent durch verbundene Netzwerke leiten. Von der Konzeption und Funktionsweise von Routern, über Routing-Tabellen und statisches vs. dynamisches Routing, bis hin zu den verschiedenen Routing-Protokollen wie IGRP, RIP, OSPF, BGP und NLSP, bietet dieses Buch einen umfassenden Überblick. Erfahren Sie, wie Hardware- und Software-Router funktionieren, und gewinnen Sie Einblicke in die Konfiguration von Routern unter verschiedenen Betriebssystemen wie MS Windows und Linux. Egal, ob Sie ein Netzwerkadministrator, ein IT-Student oder einfach nur neugierig auf die Technologie hinter den Kulissen sind, dieses Buch bietet Ihnen das nötige Wissen, um die Grundlagen des Netzwerk-Routings zu verstehen. Entdecken Sie die Geheimnisse der Datenübertragung, die Algorithmen der Wegfindung und die Protokolle, die das reibungslose Funktionieren unserer digitalen Welt ermöglichen. Dieses Buch ist Ihr Schlüssel zum Verständnis der Routing-Technologie, einem unverzichtbaren Baustein der modernen Kommunikation. Verstehen Sie die Optimierung von Netzwerkpfaden, die Vermeidung von Engpässen und die Sicherstellung einer effizienten Datenübertragung. Werden Sie zum Experten für Netzwerktechnologien und meistern Sie die Herausforderungen der modernen Netzwerkadministration. Lernen Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Routing-Protokollen kennen und erfahren Sie, wann welches Protokoll am besten geeignet ist. Ein unverzichtbarer Leitfaden für jeden, der sich mit Netzwerken und Datenkommunikation auseinandersetzt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Was ist Routing?
3. Arbeitsweise von Routern
3.1. Routingtabellen
3.2. statisches Routing
3.3. dynamisches Routing
3.4. Routing Protokolle
3.4.1. IGRP
3.4.2. RIP
3.4.3. OSPF
3.4.4. BGP
3.4.5. NLSP
4. Hardware Router
5. Software Router
5.1. MS Windows 98 SE / ME
5.2. Windows NT / 2000
5.3. Linux
5.3.1 Konfiguration des Routers
5.3.2 Konfiguration der Windows Clients
6. Fazit
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einführung
In der Hausarbeit wird das Thema Router betrachtet. Es sollen unter anderem die Fragen beantwortet werden, wofür Routing benötigt wird und wie Router arbeiten. Abschließend soll auf die Realisierungsmögl ichkeiten von Routern eingegangen werden. Dabei soll grundsätzlich die Möglichkeit eines Hardwarerouters und eines Softwarerouters ergründet werden. Insbesondere soll das Linux Projekt „One Disk Router“ vorgestellt werden.
2. Was ist Routing?
Routing ist die Wegfindung zwischen Netzwerken 1. Daten, die zwischen zwei Netzwerken ausgetauscht werden sollen, werden von Routern auf einen „optimalen“ Weg zum Empfänger gelenkt. Der optimale Weg muss hierbei nicht unbedingt der Schnellste oder Kürzeste sein. Es kann auch der kostengünstigste Weg vom Router gewählt werden. Dies ist abhängig von der Routerkonfiguration.
Die Installation eines Routers wird erst dann erforderlich, wenn Stationen in unterschiedlichen Netzwerken oder Subnetzen miteinander kommunizieren soll en.2
Ein Router sammelt während seines Betriebs ständig Informationen über den Zustand des Netzwerkes. Diese Fähigkeit ermöglicht dem Router die Wegfindung dem Netzwerkzustand anpassen. Bei Ausfall einer Route wird der Router die Pakete auf einem alternativem Weg zur Empfängerstation senden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1 geroutetes Computernetz
In obiger Abbildung soll zur Verdeutlichung ein erstes Beispiel für eine Netzkonfiguration dienen. Im Beispiel sind drei Class C Netze abgebildet. Der Rechner 1 besitzt die IP - Adresse 193.122.1.1 und gehört somit zum Netz 193.12.1.0. Mit dem Netz sind im Beispiel Router 1 und Router 3 verbunden. Router 1 verbindet das Netz 193.12.1.0 mit dem Netz 193.12.2.0 und Router 3 verbindet das Netz 193.12.1.0 mit dem Netz 193.12.3.0. Das Netz 193.12.2.0 ist wiederum durch Router 2 mit dem Netz 193.12.3.0 verbunden Im Netz 193.12.3.0 befindet sich der Rechner 2 mit der IP-Adresse 193.12.3.1.
Geht man nun von einer Kommunikation zwischen den beiden Rechnern aus, können die Datenpakete über zwei mögliche Wege zu ihrem Ziel gesendet werden. Die Pakete können über Router 1 und Router 2 oder alternativ über den Router 3 zwischen den Netzen transportiert werden.
3. Arbeitsweise von Routern
Router arbeiten auf der Ebene 3 des ISO/OSI -Referenzmodell. Router können nur in Netzwerken mit rout baren Protokollen wie z. B. TCP/IP eingesetzt werden. Die Wegfindung der Datenpakete in einem Netzwerk vom Sender zum Empfänger wird durch Routing Tabellen, die in den Routern gebildet werden, festgelegt. Ein Router besitzt mehrere Verbindungen zu untersch iedlichen Netzwerken. Diese Verbindungen werden Netzanschlüsse oder Ports genannt. Jeder Netzanschluss bzw. Port besitzt bei Verwendung des TCP/IP Protokolls jeweils eine eigene IP -Adresse. Das empfangene Datenpaket wird vom Router auf die Empfangsadresse geprüft. Aus der Empfangsadresse und mit Hilfe der Routingtabellen kann der Router das Paket in das richtige Netz oder zum nächsten Router (next hop), der auf dem Weg zum Zielnetz steht, schicken. Dies geschieht dadurch, dass das Datenpaket vom Empfangspor t an den entsprechende Sendeport des Routers weitergeleitet wird.
3.1. Routingtabellen
Zur Weiterleitung der Datenpakete zwischen Netzen müssen die Router Regeln befolgen, die in Routingtabellen hinterlegt sind. Die Routingtabelle enthält zu jedem Ziel -Netz (oder Zielrechner) das zugehörige Routerinterface (Port), über welches das Paket weiterzuschicken ist.3
Zu unserem obigen Beispiel sollen nun die entsprechenden (vereinfachten) Routingtabellen dargestellt werden. Routingtabellen können zusätzlich für die Berechnung des optimalen Weges weitere Parameter enthalten. Zu diesen Parametern gehören unter anderem der nächste Hop, die Anzahl der Hops, Bandbreite, Auslastung, Delay (Verzögerung), Verfügbarkeit und administrative Kosten. 4
Router 1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Router 2
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die obigen Routingtabellen geben dem jeweiligen Router Auskunft welche Zieladresse mit welchem Interface des Router verbunden ist.
Die Routingtabellen sind um einen weiteren Eintrag für dem Router unbekannte Netzwerke zu ergänzen. Beim sogenannten Default Routing werden Pakete an für den Router unbe kannte Netze an einen Router weitergeleitet, der in der Routingtabelle als Default-Router eingetragen ist.
In unserem Beispiel wäre der Default -Router in der Routingtabelle des Routers 1 der Router 2 und entsprechend der Router 1 in der Routingtabelle des Routers 2. So könnten dann auch Pakete zwischen Rechner 1 und Rechner 2 über die Strecke Router 1 und Router 2 ausgetauscht werden.
3.2. statisches Routing
Beim statischen Routing werden die Routingtabellen manuell im Router angelegt. 5 Der Administrator pflegt die Routen selber. Diese Vorgehensweise wird heutzutage nur selten angewendet. Es ist bei sich ständig verändernden Netzen wie z.B. dem Internet aufgrund des hohen Administrationsaufwand nicht möglich. Auch in Firmennetzen finden ständige Veränderungsprozesse statt, die zur Anpassung der Routingtabellen führen können.
Desweiteren können eventuelle Ausfälle von Netzbestandteile nicht durch eine kurzfristige alternative automatischen Routenfindung kompensiert werden.
3.3. dynamisches Routing
Beim dynamischen Rou ting werden die Routingtabellen automatisch vom Router nach bestimmten Algorithmen selbst gebildet und aktualisiert. Die Router tauschen dazu
Informationen über spezielle Routing -Protokolle aus. Diese liefern Informationen zu unterschiedlichen Netzwerkpara metern, wie Übertragungsdauer, Last und Bandbreite. Der Weg eines Paketes ist beim dynamischen Router nicht festgelegt. Er kann sich abhängig vom Netzzustand und den davon abhängigen Router Informationen ändern. Der Vorteil der Selbstverwaltung der Router wird mit einem Overhead neben dem normalen Datenverkehr erkauft. Unter Overhead versteht man hier den Datenaustausch zwischen den Routern, der für den Informationsaustausch über den Netzzustand benötigt wird. Er beeinträchtigt die tatsächliche Bandbreite d es Netzes für die eigentlichen Nutzdaten.
3.4. Routing Protokolle
Häufig eingesetzte Routing Protokolle sind das IGRP (Interior Gateway Routing Protocol), das RIP (Router Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), BGP (Boarder Gateway Protocol) und das NLSP (NetWare Link Services Protocol).
3.4.1. IGRP
Das Interior Gateway Routing Protocol (IGRP) wurde Mitte der 1980er Jahre von Cisco Systems Inc. Für das Routing innerhalb eines autonomen System entwickelt. 6 Das IGRP beruht auf dem Distance Vector Verfah ren, das Router auffordert ihre Routingtabellen in regelmäßigen Abständen an benachbarte Router zu versenden. Dadurch können Router Distanzen zu sämtlichen Knoten innerhalb des Netzwerkes berechnen.
3.4.2. RIP
Das klassische Routing–Protokoll für den Ip-Bereich ist RIP, wobei RIP als Abkürzung für Routing Information Protocol steht. 7 RIP verschickt Routing -Update-Nachrichten in regelmäßigen Abständen und wenn die Netzwerk -Topologie sich ändert. Die maximale Anzahl von Hops (Rechnerknoten) ist auf 15 beschränkt. E in Zielnetzwerk, das mehr als 15 Hops entfernt ist, gilt als unerreichbar. Der maximale Durchmesser eines RIP - Netzwerkes ist damit auf kleiner 16 Hops festgelegt.
[...]
1 Vgl. Carsten Harnisch, Netzwerktechnik, bhv Verlag Kaarst, S. 201.
2 Vgl. Prof. Jürgen Plate, Grundlagen Computernetze, http://www.netzmafia.de/, 01.04.2002.
3 Vgl. Uwe Hübner, http://iuk.in-chemnitz.de/iuk-demo/kap2/inetrout.htm, 24.03.2002.
4 Vgl. Frank Uhlig, http://www.frankuhlig.de/, was_ist_routing.pdf, S. 45.
5 Vgl. Frank Uhlig, http://www.frankuhlig.de/, was_ist_routing.pdf, S.20.
6 Vgl. Handbuch Netzwerktechnologien, Markt & Technik Verlag, S. 705 f..
Häufig gestellte Fragen
Was ist Routing?
Routing ist die Wegfindung zwischen Netzwerken. Router lenken Daten, die zwischen Netzwerken ausgetauscht werden sollen, auf einen optimalen Weg zum Empfänger. Der optimale Weg ist nicht zwingend der schnellste oder kürzeste, sondern kann auch der kostengünstigste sein, abhängig von der Routerkonfiguration.
Wann ist die Installation eines Routers erforderlich?
Ein Router wird benötigt, wenn Stationen in unterschiedlichen Netzwerken oder Subnetzen miteinander kommunizieren sollen.
Wie arbeiten Router?
Router arbeiten auf Ebene 3 des ISO/OSI-Referenzmodells und können nur in Netzwerken mit routbaren Protokollen wie TCP/IP eingesetzt werden. Sie nutzen Routingtabellen, um den Weg der Datenpakete zu bestimmen. Router besitzen mehrere Netzwerkverbindungen (Ports) mit jeweils eigenen IP-Adressen. Das empfangene Datenpaket wird geprüft und anhand der Zieladresse und der Routingtabellen an das richtige Netz oder den nächsten Router (Next Hop) weitergeleitet.
Was sind Routingtabellen?
Routingtabellen enthalten Regeln für die Weiterleitung von Datenpaketen zwischen Netzen. Sie ordnen jedem Zielnetz (oder Zielrechner) das zugehörige Routerinterface (Port) zu, über welches das Paket weiterzuschicken ist. Zusätzlich können sie Parameter wie Next Hop, Anzahl der Hops, Bandbreite, Auslastung, Delay und administrative Kosten enthalten.
Was ist Default Routing?
Beim Default Routing werden Pakete an für den Router unbekannte Netze an einen Router weitergeleitet, der in der Routingtabelle als Default-Router eingetragen ist.
Was ist statisches Routing?
Beim statischen Routing werden die Routingtabellen manuell im Router angelegt und vom Administrator gepflegt. Diese Methode wird heutzutage selten verwendet.
Was ist dynamisches Routing?
Beim dynamischen Routing werden die Routingtabellen automatisch vom Router nach bestimmten Algorithmen selbst gebildet und aktualisiert. Router tauschen Informationen über spezielle Routing-Protokolle aus.
Welche Routing Protokolle gibt es?
Häufig eingesetzte Routing Protokolle sind IGRP (Interior Gateway Routing Protocol), RIP (Router Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), BGP (Boarder Gateway Protocol) und NLSP (NetWare Link Services Protocol).
Was ist IGRP?
IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) wurde von Cisco Systems Inc. für das Routing innerhalb eines autonomen Systems entwickelt und basiert auf dem Distance Vector Verfahren.
Was ist RIP?
RIP (Routing Information Protocol) ist ein klassisches Routing Protokoll für den IP Bereich. Es verschickt Routing Update Nachrichten in regelmäßigen Abständen und bei Änderungen der Netzwerk Topologie. Die maximale Anzahl von Hops ist auf 15 beschränkt.
- Quote paper
- Frank Ferlemann (Author), 2002, Grundlagen und Realisierungsmöglichkeiten des Routing, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107252