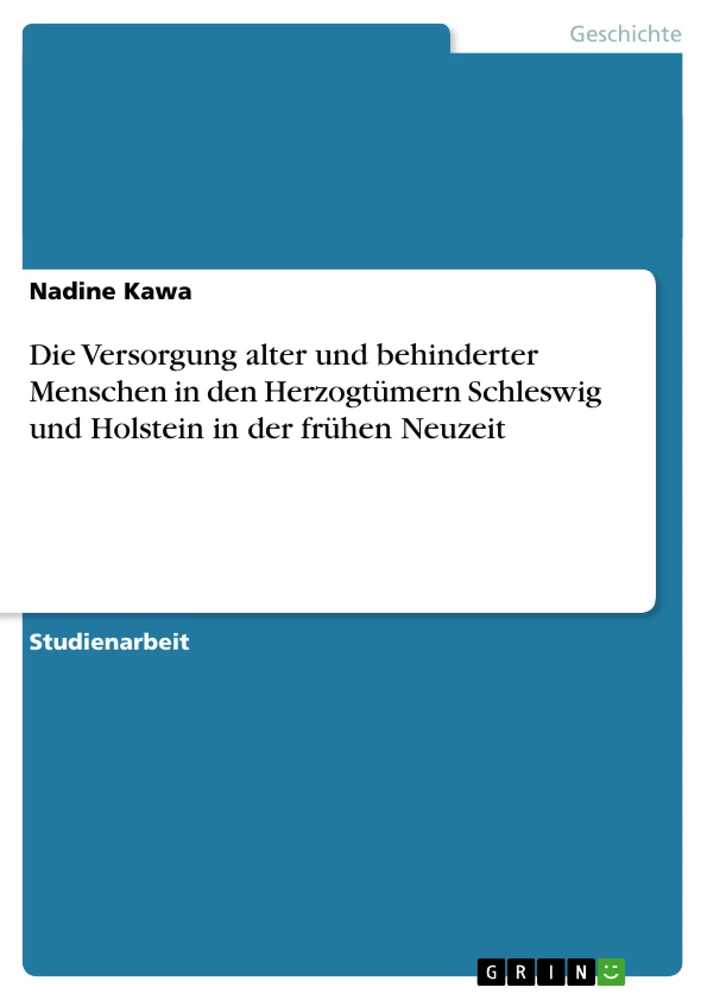War die Sorge um alte und behinderte Menschen in Schleswig-Holstein der Frühen Neuzeit wirklich so düster, wie oft angenommen? Entdecken Sie in dieser fesselnden Analyse eine überraschende Neubewertung der familiären und gesellschaftlichen Verantwortung zwischen 1500 und 1800. Jenseits romantischer Verklärungen enthüllt diese Studie die komplexen Realitäten des bäuerlichen Altenteils, die oft prekäre Lage behinderter Menschen und die sich wandelnden Vorstellungen von Alter und Behinderung im Spannungsfeld von Tradition, Armenfürsorge und beginnender Staatlichkeit. Tauchen Sie ein in die Lebenswelten vergangener Generationen, erforschen Sie die Bedeutung von Familie, Hof und Gemeinde für die Versorgung hilfsbedürftiger Mitglieder und hinterfragen Sie gängige Narrative über eine vermeintlich bessere Vergangenheit. Anhand von historischen Quellen, Fallbeispielen und einer differenzierten Betrachtung der sozialen, wirtschaftlichen und religiösen Rahmenbedingungen zeichnet dieses Buch ein facettenreiches Bild der Fürsorge in einer Zeit des Umbruchs. Es beleuchtet die Rolle von Altenteilsverträgen, die Wahrnehmung von Behinderung als Strafe oder Schicksalsschlag und die Anfänge einer organisierten Armenhilfe. Dabei werden nicht nur die Schattenseiten wie Vernachlässigung und Stigmatisierung thematisiert, sondern auch die kreativen Lösungsansätze und Formen der Solidarität, die in einer Zeit ohne moderne Sozialsysteme entwickelt wurden. Diese tiefgründige Analyse der Altersversorgung und Behindertenhilfe in Schleswig-Holstein bietet neue Perspektiven auf die Geschichte der Fürsorge und regt zur Reflexion über gegenwärtige Herausforderungen im Umgang mit Alter, Krankheit und Behinderung an. Ein unverzichtbares Werk für alle, die sich für Regionalgeschichte, Sozialgeschichte und die Geschichte der Menschlichkeit interessieren. Erfahren Sie mehr über die Lebensbedingungen in den Herzogtümern Schleswig und Holstein, die Bedeutung des bäuerlichen Altenteils als private Altersvorsorge, die Rolle der Kirche und des Staates bei der Armenfürsorge, die soziale Integration oder Ausgrenzung behinderter Menschen und die Vorstellungen von Krankheit, Alter und Tod in der Frühen Neuzeit.
Inhaltsverzeichnis
Literaturliste
Abbildungen
Fragestellung:
Definition „Frühe Neuzeit“
Definition „Alter“ und „Behinderung“
Abgrenzungen der Herzogtümer Schleswig und Holstein
Versorgung alter und behinderter Menschen in den Herzogtümern Schleswig und Holstein von 1500 bis 1800
Das bäuerliche Altenteil
Was ist das bäuerliche Altenteil?
Wer konnte Altenteile für sich in Anspruch nehmen?
Wie wurde es geregelt?
Wie wurden der alte Bauer und seine Frau versorgt?
Wie wurde die Pflege im Alter geregelt?
Wie wurden Menschen ohne Altenteile versorgt
Die Versorgung behinderte r Menschen
Wie wurden Behinderte wahrgenommen?
Pflege in der Familie
Hat sich die familiäre Versorgung während der Industrialisierung verändert? .
Literaturliste
Czerannowski, Barbara
Das bäuerliche Altenteil in Holstein, Lauenburg und Angeln 1650-1850, Wachholtz Verlag, 1988 .6, 8, 9, 10, 11, 12
Degn, Christian
Schleswig-Holstein eine Landesgeschcihte, WachholtzVerlag, Neumünster, 1994 8
Erichsen, Ernst
Das Bettel- und Armenwesen in Schleswig-Holstein während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ZSHG Bd.79, 1955, S. 217-256 13, 14
Fandrey, Walter
„Krüppel, Idioten, Irre, Zur Sozialgeschichte behinderter Menschen in Deutschland“ Siberburg-Verlag, Stuttgart 1990 5, 7, 13, 14, 15, 16, 17
Fuchs, Werner/Klima, Rolf u.a. Hrsg “Lexikon zur Soziologie“ Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen, 1978, 2.Auflage 5
Lotz-Heumann, Ute HU Berlin, Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit, http//www.geschichte.hu-berlin.de/bereiche/fnz/profil.htm 5
Stolberg, Michael
"Ihr Herz bleibt kalt bey den Leiden ihrer Angehörigen"- Historische Aspekte des Umgangs mit alten Kranken und Pflegebedürftigen. In: Blätter der Wohlfahrtspflege 1/88 12, 18
Abbildungen
Abbildung 1: Karte der Herzogtümer Schleswig und Holstein
Einleitung
Fragestellung:
War die Einstellung zur familiären Versorgung alter, kranker oder behinderter Verwandten in der Frühen Neuzeit eine andere als heute?
Oft wird angenommen, dass während der Industrialisierung und durch die Entstehung des Sozialsystem das Bewußtsein für hilfsbedürftige Verwandte sorgen zu müssen nachgelassen hat. Ich werde dies in der folgenden Hausarbeit überprüfen, indem ich darstelle wie alte oder nicht arbeitsfähige Menschen in der Frühen Neuzeit in Schleswig-Holstein versorgt wurden. Danach werde ich einen Vergleich mit den heutigen Versorgungsstrukturen und Einstellungen ziehen um meine Fragestellung zu beantworten.
Zunächst möchte ich jedoch die zentralen Begriffe meiner Hausarbeit definieren.
Definition „ Frühe Neuzeit “
„Als "Frühe Neuzeit" bezeichnet man die Epoche zwischen 1500 und 1800. Sie stellt sich als eine "Übergangsphase" zwischen dem Mittelalter und der so genannten späten Neuzeit, dem 19. und 20. Jahrhundert, dar. Klassische Abgrenzungsmerkmale der Frühen Neuzeit vom Mittelalter sind Renaissance und Humanismus, die Reformation und das Zeitalter der Entdeckungen. Die Frühe Neuzeit hat zudem deutlich andere Quellen hervorgebracht als das Mittelalter: Akten (statt Urkunden) auf Grund der rapide zunehmenden Verschriftlichung der Verwaltung und gedruckte Schriften auf Grund der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern durch Gutenberg. Als Epochenabgrenzung zur späten Neuzeit gelten die politischen Revolutionen des späten 18. Jahrhunderts (Amerika, Frankreich), die demographische und die industrielle Revolution. Gleichzeitig "verschwimmen" jedoch immer wieder die Epochengrenzen zum Mittelalter und zur späten Neuzeit. So konstatiert man beispielsweise eine Spätmittelalter und Frühe Neuzeit umfassende "Zeit der Reformen" (vor allem in der französischen und amerikanischen Forschung) und eine "Sattelzeit" (Koselleck) zwischen 1750 und 1850. Die Frühe Neuzeit hat sich jedoch innerhalb der Geschichtswissenschaft als eigenständige Epoche etabliert, weil sie auf vielen gesellschaftlichen Ebenen den entscheidenden Umbruch zur Moderne markiert: die Epoche der europäischen Konfessionalisierung, die Herausbildung des modernen Staates, die Protoindustrialisierung.“1
Betrachtet man die Versorgung alter und behinderter Menschen läßt sich 1500 als Anfang der Frühen Neuzeit ungefähr bestätigen. Waren im Mittelalter behinderte Menschen keine ungewöhnliche Erscheinung und deren Unterstützung eine Pflicht für jeden gottesfürchtigen Menschen, so wurden in Spätmittelalter Ende des 15. Anfang des 16. Jahrhunderts Almosen und die Bedürftigkeit Behinderter in Frage gestellt. Im christlich geprägten Mittelalter wurden „Irre“ und „Blinde“ als besonders religiös erleuchtet angesehen und man glaubte sich durch ihre Unterstützung von seinen Sünden befreien zu können und somit in den Himmel zu kommen. Doch änderte sich diese Einstellung im15. und 16. Jahrhundert: Reichtum verdankte man göttlicher Gunst und die Behinderung war die Bestrafung von Sünden. Außerdem glaubte man, dass Behinderungen und Verstümmelungen von Armen nur vorgetäuscht wurden, da das Betteln in den Städten verboten wurde und nur Behinderten, die ihren eigenen Unterhalt nicht selbst erarbeiten konnten gestattet war.2 Auch 1800 als obere Grenze kann in diesem Fall bestätigt werden. Anfang des 19. Jahrhunderts wird versucht in das unstrukturierte Sozialsystem Ordnung durch gesetzliche Grundlagen zu bringen. Wie beispielsweise die Armutsverordnung vom 23.12.1808.
Definition „ Alter “ und „ Behinderung “
Das Alter hat viele Dimensionen. Als biologisches Altern bezeichnet man die Zunahme an Lebensjahren und die damit verbundenen biologischen Veränderungen. Das soziale Alter sind „im Unterschied zu dem nach Lebensjahren gemessenen Alter die gesellschaftlich bestimmten Definitionen des Altseins: Die Altersbegriffe Kind, Jugendlicher, Erwachsener, Greis sind in Abhängigkeit von durchschnittlicher Lebensdauer, Wirtschaftsformen und Wertvorstellungen in verschiedenen Gesellschaften auf verschiedene Abschnitte des Alters nach Jahren bezogen.“3
In der industriellen Gesellschaft wird das Alter nicht als lebenslanger Prozeß, sondern als die Lebensphase des „Alters“ nach dem Ausstieg aus der Erwerbslosigkeit oder das Ende des erwerbsfähigen Alters, verstanden. Dafür läßt sich heutzutage die Grenze 65 Jahre beim Eintritt in das Rentenalter ziehen. „Eine so starre und gesetzlich fixierte Altersgrenze hat es in vorindustrieller Zeit jedoch nicht gegeben, da in einer hauptsächlich agrarisch orientierten Gesellschaft vor allem die Familie und der Bauernhof die Organisationsform der Arbeit bildeten. Die Einheit von Produktion und Konsumtion am Bauernhof begünstigte, ja forderte oft geradezu die Beteiligung aller am Hofe lebenden Menschen am Arbeitsprozeß (...) So konnten die „Alten“ der Agrargesellschaft zunächst nicht die völlige Freistellung von Arbeit für sich beanspruchen bzw. praktizieren, wie dies heute für die Industriegesellschaft gilt.“4 Die Altersgrenze unterlag also den verschieden Gegebenheiten auf dem Hof. Auch waren die durchschnittliche Lebenserwartung mit 30 Jahren wesentlicher niedriger hatte. Allerdings muß man hier beachten, dass ein großer Teil schon im ersten Lebensjahr starb. Wer also älter als ein Jahr wurde, hatte gute Chancen älter zu werden. Mit 50 galt man jedoch schon als Greis.
Da jedoch nicht nur das Alter sonder auch Behinderungen einen Menschen von der Erwerbstätigkeit ausschließen und damit hilfsbedürftig machen, möchte ich auch auf behinderte Menschen eingehen.
Nach der heutigen Sozialgesetzgebung wird Behinderung wie folgt definiert:
„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und dadurch ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.“5 Diese Definition läßt sich in einer historische Betrachtung nur bedingt anwenden. Eine Behinderung bedeutete im Mittelalter nicht in dem Maße wie heute die Ausgrenzung aus der Gesellschaft. Ihr Anblick war keine Seltenheit und fast jedem war aus seinem Freundeskreis ein Krüppel, Blinder, Aussätziger, Tauber oder Stummer bekannt. Ein Problem der Definition der Behinderung ist, dass der Schwerpunkt auf schwerer körperlicher Arbeit lag. Das heißt körperliche Behinderungen konnten einen Menschen an der Ausübung einer Arbeit hindern.
Feinmotorische Behinderungen und Lernbehinderungen spielten keine große Rolle, da für das ländliche Leben kaum Schulbildung und Geschicklichkeit gefordert wurden.6 Ich beschränke mich bei meinen Betrachtungen auf Menschen, die durch ihre Behinderung nicht in der Lage sind einer Arbeit nachzukommen und so für sich selbst zu sorgen.
Abgrenzungen der Herzogtümer Schleswig und Holstein
Abbildung 1: Karte der Herzogtümer Schleswig und Holstein7
„Gut 400 Jahre, von 1400 bis 1864, blieben Schleswig und Holstein - als Realunion „Schleswig-Holstein“ - in Personalunion mit dem Königreich Dänemark verbunden, unter Herrschern aus dem Hause Oldenburg. Sie blieben ewich tosamende - aber nicht ungedelt. Vielmehr erfolgte bereits 1490 die erste Teilung, der weitere folgen sollten. Die Landesteilungen sind ein wesentlicher Grund dafür, dass die Geschichte Versorgung Schleswig-Holsteins so kompliziert ist.“8 alter und behinderter Menschen in den Herzogtümern Schleswig und Holstein von 1500 bis 1800
In der vorindustriellen Zeit gab es wenig Regelungen zur Altersversorgung, was auch die Recherche zu dieser Hausarbeit sehr schwierig gestaltet hat. Zum einen gibt es wenig Aufzeichnungen zu diesem Themenkomplex für die frühe Neuzeit und zum anderen speziell für die Herzogtümer Schleswig und Holstein. Ich habe daher zwei Schwerpunkte auf die Altenteilsregelungen in Schleswig und Holstein und auf die Versorgung behinderter Menschen in der Frühen Neuzeit gelegt.
Das bäuerliche Altenteil
Ich möchte zunächst auf die Regelungen des Altenteils eingehen. Dies war eine Form der Altersvorsorge, die im ländlichen Raum praktiziert wurde. Die nachfolgenden Ausführungen lehnen sich an das Buch „Das bäuerliche Altenteil“ von Barbara Czerannowski.
Was ist das bäuerliche Altenteil?
Das Altenteil „ist der landbesitzenden bäuerlichen Schicht zuzuordnen und setzt eine Vererbung inter vivos, d.h. eine Übergabe noch zu Lebzeiten des Bauern oder seiner Witwe an einen Hofnachfolger voraus, die in Holstein im allgemeinen auf der Basis des Anerbenrechts, in Schleswig Näherrecht genannt, vollzogen wurde. Übergab ein alter Bauer seinen Hof an einen Nachfolger - das war in der Regel der Sohn, konnte aber auch der Schwiegersohn oder ein Fremder sein -, dann handelte der abtretende Bauer mit dem neuen Hofwirt die Bedingungen des Altenteils für sich und seine Frau aus. Die vereinbarten Altenteilsleistungen wurden vertraglich niedergelegt und verpflichteten den Übernehmer des Hofes zur Erfüllung der Vertragspunkte bis zum Tod des Bauernpaares.“9
Gründe für die Übergabe des Hofes gab es mehrere. Zum einen sollte der Hof im Familienbesitz bleiben. Zum anderen wollten die Bauern ihren Nachlaß zu Lebzeiten geregelt haben. Selten waren gesundheitliche Gründe ausschlaggebend.
Wer konnte Altenteile für sich in Anspruch nehmen?
Generell war jedem freien Bauern das Recht zu Errichtung eines Altenteils gegeben. Allerdings setzte dies eine gewisse wirtschaftliche Kraft des Hofes voraus. Deshalb konnten nicht alle Bauer Altenteilsverträge abschliessen.10
Wie wurde es geregelt?
Weder für das Anerbenrecht noch für das Altenteil gab einheitliche Regelungen. Vererbt wurde nach dem Jüngstenrecht (Minorat, beispielsweise in Segeberg, Traventhal, Preetzer Probstei), das ungeteilte Erbe wurde vom jüngsten Sohn angetreten, oder nach dem Ältestenrecht (Majorat). Das konnte von Amt zu Amt unterschiedlich gehandhabt werden. Im Kreis Pinneberg wurde beispielsweise zwischen den Söhnen gelost. In manchen Gebieten, allerdings sehr selten wurden auch Töchter in die Erbfolge mit einbezogen. Meist jedoch nur wenn kein männlicher Nachfolger vorhanden war. Dann wurde an den „Tochtermann“, das heißt an den Schwiegersohn vererbt. Ziel des ungeteilten Alleinerbes war es eine Zersplitterung des Hofes zu vermeiden, wie es bei einer Real-Teilung üblich gewesen wäre. Allerdings muß an dieser Stelle klar gemacht werden, dass Altenteilsverträge auch unabhängig vom Anerbenrecht abgeschlossen wurden. Voraussetzung war jedoch eine Hofübergabe zu Lebzeiten.
Wie schon gesagt gab es auch für die Ausgestaltung des Altenteil keine gesetzlichen Regelungen. „In dieser Hinsicht hat kein Gesetz Vorschriften gemacht und wird sie auch nicht machen können, weil es dabei gar zu sehr auf die Art der Ueberlassung einer Landstelle, auf ihre individuelle Beschaffenheit und ihren individuellen Werth ankommt.“11 Wenn es Regelungen gab, dann nur solche, die verhindern sollten, dass Alte auf ihr Altenteil verzichten und so der Armenfürsorge zur Last fallen würden.
Außerdem sollte der Umfang der Altenteile von der Obrigkeit überwacht werden, da sonst die Zahlungsfähigkeit des Hofes gefährdet sein könnte. Allerdings wird die Wirksamkeit solcher Regelungen bezweifelt, da sie keine konkreten Ausgestaltungen enthalten.
Auch für den Zeitpunkt der Übergabe gab es verschiedenen Vorgehensweisen. Es gibt Regelungen, bei den der Hof übergeben wurde als der Sohn oder die Tochter 21, 23, oder 25 Jahre alt waren. Aber auch bei den Eltern gab es Altersgrenzen bei 60 oder 65 Jahren. Dann sollten sie den Hof spätestens an die Nachfolger abgegeben werden. Von der Gesellschaft wurde man schon mit 50 als alt betrachtet, wie dieses Sprichwort, das für das Jahr 1663 belegt werden kann, besagt. „Stille stahn“ steht hier für die Wende im Lebensverlauf.12
Zehen Jahr ein Kind.
Zwanzig Jahr ein Jüngling. Dreißig Jahr ein Mann. Vierzig Jahr wohl gethan. Funfzig Jahr stille stahn. Sechzig Jahr geht ’ s Alter an. Siebenzig Jahr ein Greiß. Achzig Jahr nimmer weiß. Neunzig Jahr der Kinder Spott. Hundert Jahr Gnade Gott
Wie wurden der alte Bauer und seine Frau versorgt?
Die Altenteilsverträge enthielten Zusicherung von Nahrung und Wohnen auf dem Hof in verschiedenen Formen. Wohnen konnten der alte Bauer und seine Frau entweder in extra errichteten Häusern auf dem Hof, einem Teil des Bauernhauses oder in einzelnen Zimmern. Außerdem wurde dem Bauer oft ein Teil des Landes und ein paar Tiere zugeteilt. Das Land wurde vom Hofwirt, dem Käufer, bewirtet. So sollte die Ernährung sicher gestellt werden. Es gab jedoch auch Regelungen, in denen den alten Bauern drei Mahlzeiten angeboten wurden.
Darüber hinaus beinhaltete der Altenteilsvertrag verschiedene Dienstleistungen, wie Fahrten oder Taschengeld. Diese konnten jedoch von Hof zu Hof variieren. Ich möchte hier beispielhaft einen Auszug aus einem Altenteilsvertrag anführen:13 Dieser Vertrag stammt aus Steinrade, einem sog. Lübschen Güter, das sich zwischen 1518 und 1619 im Besitz der Familie v. Lüneburg befand:
„... die beiden Alten sollen im Backhus die Zeit ihres Lebens ihre Behausung haben, und zu deme zwo Stücke Landes hinder dem Hofe, einen Hopfendamm (...), einen Kirschbaum bei erwehntem Hopfendamm und einen Traubepfelbaum hinder dem Wagenschaur, auch ein Wischstücke in der großen Wische, zu ihrer Nothurfft zu gebrauchen haben. Auch sollen die Alten zween Kühe und zwo Schweine ihres Gefallens damit thuende, weg nehmen, und sol endlich Käufer den Mist der von den Alten Gutte kompt, auf die beiden Stücke Landes führen, den Acker pflügen, meyen ( = mähen) und einernten...“
Wie wurde die Pflege im Alter geregelt?
Da es mir in meiner Hausarbeit ins besondere um die Versorgung kranker Menschen und der Pflege alter Menschen geht, möchte ich noch darauf eingehen, wie diese Pflege in den Altenteilsverträgen geregelt wurde. Das dies in Verträgen geregelt wurde, läßt vermuten, dass sonst Pflege im Krankheitsfall nicht selbstverständlich wäre. Das läßt sich auch nsofern bestätigen, als dass sich das gesamte familiäre Leben über den Hof definierte und das vorrangige Interesse bei der Leistungsfähigkeit des Einzelnen lag. Bei der Übergabe des Hofes war der Altenteiler noch in einer starken Position und konnte Bedingungen stellen. Im Krankheitsfall war er zu schwach um sich gegen eine schlechte Behandlung zu wehren. So gibt es beispielsweise folgende Überlieferung aus Südschweden Mitte des 18. Jahrhunderts. „Als die Witwe sehr krank wurde, wollte die Schwiegertochter sie nicht länger bei sich behalten. Sie veranlaßte ihren Mann, die Witwe auf die Straße zu setzen. Das wurde auch getan, und die Witwe starb kurz darauf.“14
„Die ländlichen Ärzte finden um 1800 drastische Worte: ‚Wohltätigkeit, Mitleiden und Teilnahme sind dem Landmann zimmlich unbekannte Dinge. Wenn diese Seite berührt wird, dann ist er geitzig und hartherzig‘, heißt es da, und, so ein anderer Beobachter: ‚Ihr Herz bleibt kalt und unbewegt bey den Leiden ihrer Angehörigen.‘ Am bedauernswürdigsten sei jedoch das Schicksal unheilbar chronisch Kranker, so ein weiter Arzt, denn ‚sie sind ihren Angehörigen zur Last, werden von ihnen schlecht behandelt, schmachten in finstern Kammern, dem Elende und nicht selten dem Hunger überlassen‘15 “16
Dies ist jedoch nur die eine Darstellung des Umgangs mit alten Angehörigen, welche jedoch nicht ausschließlich die Realität charakterisiert, sonder zeigt wogegen sich die Altenteiler zu wehren versuchten. Also wurde in den Altenteilsverträgen festgelegt, daß der Stellbesitzer dem Altenteiler Hege und Pflege zuzukommen hat, oder zumindest „die benöthigten Fuhren zur Kirche, zum Prediger und für den Arzt“17. Die entstandenen Kosten hatte allerdings der alte Bauer zu tragen. Zu dieser Zeit gab es noch keine Krankenkasse, die dies übernommen hätte. (Vgl. Czerannowski, S.138f)
Wie wurden Menschen ohne Altenteile versorgt
Wer keinen eigenen Hof besaß, wo sich ein Altenteil einrichten ließ oder gar leibeigen war, fiel unter die Armenfürsorge. Es gab drei Formen der Armenfürsorge:
- die kirchliche Wohltätigkeit
- die bürgerliche Hilfe mit Legaten und gelegentlichen Hilfen
- und die staatliche Hilfe.18
Dies war jedoch vor der Armenverordnung vom 23.12.1808 sehr unstrukturiert und ungeregelt.
„Armut ist selbstverschuldet - sagen die Wohlhabenden. Im 17. und frühen 18. Jahrhundert schlägt die Obrigkeit eine scharfe Tonart gegenüber den Armen an: Vor allem Faulheit, Trunksucht und schlechte Erziehung verursachten die Armut. Die „liederlichen“ und „muthwilligen“ Bettler wollen in ihrer moralischen Verkommenheit nicht arbeiten, sondern auf Kosten anderer Leute leben.“19 Diese Zitat zeigt deutlich den ideologischen Hintergrund der Armenfürsorge der Frühen Neuzeit. Rechtlich waren die Heimatgemeinden für die Versorgung der Armen zuständig, doch wer wirklich Gelder aus den Armenkassen erhielt, galt als privilegiert und würdig. Denn es gab keinen persönlichen Rechtsanspruch auf Unterstützung. Das Geld der Armenkassen wurde zentral verteilt, wer wieviel bekam lag im Ermessen und in der Willkür der Gemeinde. Auch das Einzahlen in die Armenkassen war nicht verpflichtend. So wurden beispielsweise Bettelumzüge veranstaltet, in denen die Bürger nach Almosen gefragt wurden. Allerdings hatte sich die Einstellung gegenüber irdischen Reichtümern geändert. „Der irdische Reichtum erscheint nicht mehr als Hindernis auf dem Weg zum Himmelreich, sondern im Gegenteil als handfestes Zeichen besonderer Gnade.“20 So wurden Gelder unterschlagen, gar nicht erst gespendet oder Bedürftige bestahlen sich in Armenhäusern gegenseitig. Die Erschütterung durch den dreißigjährigen Krieg am Anfang der Frühen Neuzeit und der Bevölkerungszuwachs durch fortschreitende medizinische und technische Entwicklungen, die zum Sinken der Todesrate und Steigen der Geburtenrate führten, waren Gründe für diese ideologischen Veränderungen. Ohne Unterstützung von Freunden oder Verwandten fiel das Überleben schwer. Dies ist zwar nicht belegt, aber die Schilderungen der Zeit lassen kaum eine andere Deutung zu.
Gegen Ende der Frühen Neuzeit um 1800 gilt Armut jedoch „nicht mehr als ein Übel des einzelnen, vielleicht als eine selbstverschuldete oder gar verdiente Heimsuchung, sondern als Frage der Öffentlichkeit, als Gegenstand des Staates, der darum auch geradezu verpflichtet erscheint zur Abhilfe und nun auch in konsequenter Weiterführung jenes Gedanken ganz einfach durch Gesetz systematisch das Eigentum des Staatsbürgers den Bedürfnissen der Armen entsprechend besteuert und also beschneidet.“21
Die Versorgung behinderter Menschen
Für die Beantwortung meiner Fragestellung möchte ich nun die Lage der behinderten Menschen betrachten. Sie sind ebenfalls auf Hilfe angewiesen und mich interessiert, ob und wo sie diese Hilfe bekamen. Dazu werde ich mich hauptsächlich auf das Buch „Krüppel, Idioten, Irre“ von Walter Fandrey beziehen. Es enthält eine umfangreiche und gut belegte Darstellung der Sozialgeschichte behinderter Menschen in Deutschland. Problematisch ist hier, daß sich dieses Buch nicht speziell auf die Herzogtümer Schleswig und Holstein bezieht. Aber um gesellschaftliche Einflüsse und Entwicklungen darzustellen, finde ich es sehr wertvoll und, möchte es deshalb in meine Hausarbeit einbinden.
Wie wurden Behinderte wahrgenommen?
Der Vater war das Familienoberhaupt. Wenn sich er Kind nach der Geburt von der Hebamme geben ließ war es in die Familie aufgenommen. Ansonsten wurde es fern ab vom elterlichen Haus ausgesetzt. Im Mittelalter wurde die Tötung eines Kindes nur mäßig bestraft. “Die Reichsgerichtsordnung des 16. Jahrhunderts bestimmte ausdrücklich die Todesstrafe für die Tötung eines Kindes, das „leben und glidmaß empfangen hat“.22 Wird ein Kind mißgestaltet geboren , muß man es der Obrigkeit melden. Was dann weiter geschehen soll, sagt das Gesetz nicht.“ Diesen Menschen kamen, „die magisch-religiösen Vorstellungen, welche im Mittelalter einen übergeordneten Sinnzusammenhang der Welt stifteten, in ihren konkreten, personifizierten Gestalten (Gott und Teufel, Heilige, Dämonen, Hexen) entgegen.“23 Die religiös-magische Sicht der Dinge ermöglichte die gesellschaftliche Integration psychisch Kranker, da andersartige Ansichten religiös interpretierbar waren. (Es ist anzunehmen, dass psychisch Kranke nur als besonders religiös wahrgenommen wurden.) Allerdings war dies Abhängig von dem Ausmaß des abweichenden Verhaltens und der gesellschaftlichen Entwicklung. Zu Zeiten großer Toleranz gegenüber ekstatischer Religiosität beispielsweise im 14.Jh. („Geißeln“) war solches Verhalten problemloser, als zu Zeiten der kirchlichen Verfolgung und Unterdrückung durch Hexenprozesse zum Ende des Mittelalters.
Ende des Mittelalters und im 16.Jahrhundert spielte der Teufel eine immer größere Rolle und wurde für alle Schäden verantwortlich gemacht. Martin Luther erklärte dies so: „Die in Theologie unkundigen Ärzte wissen freilich nicht, wie groß die Macht des Teufels ist. Gegen ihre natürliche Erklärung stehen die heutige die heilige Schrift und die Erfahrung, da0 der Teufel die Taubheit, Die Stummheit, die Lahmheit und das Fieber verursache.“ (Paul Schiene?, Geschichte des Taubstummenwesens, Frankfurt/M., 1940, S. 30) So glaubte man auch an das „Wechselbalg“ (norddt. „Kielkropf“): „das ist ein mißgestaltetes, häßliches, zurückgebliebenes Kind mit einem dicken Kopf und häufig einem Kropf“. Böse Wesen sollen das Kind in der Wiege mit dem Wechselbalg vertauscht haben. Es gab verschiedene Rücktauschmethoden, die meistens zum Tod des Kindes führten:
- 1 Jahr mit einer Haselgerte verprügeln
- aus der Wiege in den Mist werfen
- mit einem Besen vor das Haus kehren
selten jedoch:
- besonders gute Pflege
- der Wechselbalg ist ein Glücksbringer, dessen Tod Unglück bedeutet
Begegnungen mit Behinderten Menschen galt als unheilvoll. Ihr „böser Blick“ („übel ougen“) sollte schädigend für Kinder sein und Schwangere sollte sich beim Anblick eines behinderten „versehen“ können und durch das tiefe Erschrecken ein
behindertes Kind zur Welt bringen. Um dies zu verhindern erließ der Nürnberger Stadtrat eine Bettelverordnung in der folgendes angeordnet wurde:
„Es soll jeder Bettler, der eine offene, schlimme Verletzung an seine Gliedern, wovon die schwangeren Frauen durch Hinsehen Schaden erleiden könnten, diese Verletzung verdecken und nicht offen zur Schau stellen, bei Strafe von einem Jahr Stadtverbannung“ (zitiert nach Christoph Sachse, Florian Tennstedt, Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland vom Spätmittelalter bis zum 1.Weltkrieg, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, 1980, S.65)
Erasmus rät in seinem Erziehungsbuch Eltern ihre Kinder nicht mit Körperbehinderten spielen zu lassen, da sich die Körperbehinderung leicht auf gesunde Kinder übertragen kann. (Vgl. Hans Boesch, Kinderleben in der deutschen Vergangenheit, Leipzig 1900, S.51)24
Pflege in der Familie
Im Mittelalter ermöglichte das Zusammenleben in bäuerlichen Wohngemeinschaft die wirtschaftliche und soziale Integration Behinderter. Zu einer Bäuerlichen Wohngemeinschaft gehörten die Kernfamilie, Knechte und Mägde und teilweise auch unverheiratete Verwandte. Sie arbeitet ihren Fähigkeiten entsprechend auf dem Hof mit. Wahrscheinlich lebten, die meisten behinderten in dieser Zeit so. Das Recht legte die Fürsorge auch fest. „Der Sohn verliert sein Erbe, wenn er seinen „unsinnigen“ (geistesschwachen oder geisteskranken) Vater nicht behütet und bewahrt. Zwerge und Krüppel und Toren erhalten kein Erbe und kein Lehen; deren Erbnachfolger soll sie aufnehmen und pflegen.“25 Wenn er schon Grundbesitz hatte, konnte es ihm nicht mehr genommen werden. Allerdings gab es keine eindeutige Rechtsprechung für die Behinderten. Wenn ein Angehöriger genug Macht hatte, konnte er ihm vor Gericht alles Eigentum zugesprochen werden. In dem Fall besaß er kaum noch gesellschaftliche Anerkennung, weil er zu schwach ist. Anders stellt sich die Lage bei psychisch Behinderten dar. Darüber schreibt das Mittelalterliche Recht wenig. „Die „Tobenden“ sollen gebunden werden, damit sie keinen Schaden anrichten können. Dafür sind die Angehörigen oder die Richter verantwortlich“26
Für Bauern, die von Behinderung betroffen werden, konnte es den Ruin bedeuten, wenn sie nicht genug Knechte und Mägde besaßen um den Arbeitsausfall zu kompensieren. Die große Belastung durch Abgaben an den Gutsherren (Drittelabgabe), Zehntabgaben an die Kirche, Vogteilasten (an den Vogt als Träger der Gerichtsgewalt) und landesherrliche Steuern ließ die Bauern am Rande des Existenzminimums leben. Eine Arbeitseinschränkung des Bauers oder der Bäuerin gefährdete die wirtschaftliche Existenz des Hofes. Wohlhabendere Schichten traf eine Behinderung nicht so schwer. Sie konnten sich Hilfsmittel oder Diener leisten um die Einschränkung auszugleichen.
Die Zerstörung und die Armut als Folge des dreißigjährigen Krieges hinterließen jedoch in auch in der familiären Versorgung ihre Spuren. Viele Familien waren die Mitarbeit aller angewiesen, sogar Kinder wurden in die Arbeit mit einbezogen. Hohe Kindersterblichkeit war ein Risiko, dass man in Kauf nahm.
Fortschreitende Technik und Erfindungen verbreiteten die gewerbliche Produktion nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Lande. Da jetzt vom Hof unabhängig produziert werden konnten, zersplitterten allmählich auch die Hofgemeinschaften. Durch Vererbung wurde Land getrennt und Familien die Stabilität genommen, auch weil sie nicht mehr auf interne Arbeitsteilung angewiesen waren. Die Verbindung zu Verwandten und das Gefühl gegenseitiger sozialer Verpflichtungen lies nach. Menschen die auf dem Land keine Möglichkeit mehr sahen, gingen in die Städte. Dort stieg die Bevölkerung. Die Lebensbedingungen verschlechtern sich drastisch: lange Arbeitszeiten unter schlechten Arbeitsbedingungen für zu wenig Geld. Die Folge waren Behinderungen, Mangelerscheinungen, früher Tod. Aufgrund dieser schlechten Lebensbedingungen war es der Masse der Bevölkerung nicht möglich zusätzlich behinderte oder alte Verwandte aufzunehmen. Im Gegenteil, sie waren häufig selber von Krankheit und Behinderung bedroht und kämpften um das eigene Überleben.27
Hat sich die familiäre Versorgung während der Industrialisierung verändert?
Wie in dem Buch von Fandrey beschrieben, waren Behinderte um 1500 gut in ihre Familien integriert, haben Aufgaben übernommen, die ihren Fähigkeiten entsprachen und bekamen Unterstützung durch ihre Angehörigen. Allerdings wurde in dem Aufsatz von Stolberg auch beschrieben, dass nicht alle Angehörigen sich gegenüber kranken, alten Verwandten verpflichtet fühlten. Dort besagt er auch, dass das Idealbild der sicheren Großfamilie, sowieso nicht der historischen Wahrheit entspricht.28 Eine Großfamilie war nicht nur über die direkten Verwandten definiert, sondern zu ihr gehörten auch Knechte, Mägde und Gesinde. Die Familie war Produktionsgemeinschaft und definierte sich über den Hof oder das Haus. An der Namensgebung in Westeuropa ist dies immer noch zu erkennen.
In den Altenteilsverträgen wollten sich die Altenteiler gegenüber ihren Kindern gegen Verwahrlosung absichern. Daraus wird deutlich, dass dies offensichtlich ein mögliches Risiko ist. Wenn es sie je in der Form gegeben hat, läßt sich die Großfamilie als soziales Sicherungsnetz eher dem Mittelalter als der Frühen Neuzeit zuordnen, da der dreißigjährige Krieg und die voranschreitende technische und medizinische Entwicklung verschlechternde Lebensbedingungen zur Folge hatten. Viele Menschen kämpften selber gegen Armut und Krankheit, alte oder behinderte Angehörige zu versorgen lag nicht in ihren Möglichkeiten. Der Technische und medizinische Fortschritt waren Wegbereiter für die Industrialisierung und die veränderte Einstellung gegenüber zu pflegenden Angehörigen die indirekten Folge der daraus resultierenden gesellschaftlichen Veränderungen. Dies wären jedoch nur die kurzfristigen Veränderungen. Wichtig ist jedoch, was sich langfristig verändert hat. Durch die Entwicklung zur Industriegesellschaft war auch die Entwicklung zu einem Wohlfahrtsstaat möglich. Die Sozialgesetzgebung entwickelte sich unter anderem aus den schlechten Lebensbedingungen während der Industrialisierung. Unser heutiges Sozialsystem ist das Ergebnis der Veränderungsprozesse während der Industrialisierung. Zweifelsohne wurde es in den letzten 100 Jahren noch häufig verändert und andere historische Einflüsse, wie das dritte Reich, haben es zusätzlich geprägt. Doch die Gedanken der sozialen Sicherung und Versorgung stammen aus dieser Zeit. Oft herrscht heute das Vorurteil: Alte und behinderte Angehörige werden lieber in Einrichtungen abgeschoben werden, als sich persönlich um sie zu kümmern, und früher war das natürlich besser.
Wie wir jedoch gesehen haben, war die Motivation sich um Familienmitglieder zu kümmern, keineswegs ständig gegeben. Ob und welche dies heute anders ist, müßte man empirisch oder netzwerkanalytisch genauer untersuchen. Was sicher nicht unproblematisch ist, denn schon die demografischen und datentechnischen Grundlagen sind sehr verschieden. Erstens war die Lebenserwartung wesentlich geringer als heute. Zweitens gab es das Alter als Lebensphase nicht so ausgeprägt wie heute. Es würde schwer sein vergleichbare Variablen zu finden. Außerdem habe ich nur ein Teil der Versorgung in der Frühen Neuzeit aufgezeigt. Ich bin nicht auf Pfründkäufe, Absicherung durch Gilden oder Zünfte und sich langsam bildende Institutionen. Das wäre ein weiteres sehr interessantes Thema: zu untersuchen, wie unterscheidet sich die Versorgung und die Struktur der entstehenden Institutionen von heutigen. Ich könnte mir vorstellen, dass man erschreckende Entdeckungen in dieser Beziehung macht.
Als Fazit aus meiner Arbeit möchte ich ziehen, dass wirtschaftliche und soziale Interessen je nach Lebenssituation Erziehung und Sozialisation verschieden stark ausgeprägt sind. Heute, wie auch in der Frühen Neuzeit. Ich denke die Versorgung alter und behinderter Menschen hat sich ohne Frage verändert. Und zwar in Richtung einer größeren sozialen Absicherung und Integration. Ob durch die entstandenen Möglichkeiten die Verpflichtung für Familienmitglieder nachgelassen hat, wage ich zu bezweifeln. Und meine historische Recherche hat auch nichts ergeben, was darauf hin deuten würde, dass dies früher besser gewesen wäre.
[...]
1 Lotz-Heumann Ute
2 Fandrey, Walter S. 40-47
3 Lexikon zur Soziologie S. 33
4 Czerannowski, Barbara S. 24
5 SGB IX, § 2 Abs. 1
6 Fandrey, Walter S.10
7 Degn, Christian S. 86
8 Degn, Christian S. 86 Schleswig-Holsteins
9 Czerannowski, Barbara S.5
10 Czerannowski, Barbara S. 59ff
11 „F. (=Falck?): Einige Bemerkungen zu der von dem Etatsrath und Vicekanzler Scholtz, herausgegeben Schrift über Concursrecht und Concursverfahren. In: Staatsbürgerliches Magazin mit besonderer Rücksicht auf die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg. Hrg. von N.C.F. Cartsens und N. Falck, Bd. 4, 1. Heft, Schleswig 1824, S.268-273; hier S.27“ so zitiert in Czerannowski, Barbara, S.20
12 Czerannowski, Barbara S. 26
13 Czerannowski, Barbara S. 67ff
14 Gaunt, David: Formen der Altersversorgung in Bauernfamilien Nord- und Mitteleuropas. In: Mitterauer/Sieder (Hrg.): Historische Familienforschung. Frankfurt/M. 1982, S.156-191 zitiert in Czerannowski, Barbara, S. 138
15 Staatsarchich Bamberg, K3FIII 1481 (Münchberg, Forchheim); A. F. Marcus: Beyträge zu einer Medizinalverfassung. in Magazin für specielle Therapie, Klinik und Staatsarzneikunde 3 (1806), S. 204-271, hier S. 225
16 Stolberg, Michael S.24
17 Gutsarchiv Rundhof B. VI 27a (6), Wittkiel, 7.10.1803 zitiert in Czerannowski, Barbara, S. 139
18 Erichsen, Ernst S. 218
19 Fandrey, Walter S. 79
20 Fandrey, Walter S.80
21 Erichsen, Ernst S. 255
22 Fandrey, Walter S.10
23 Fandrey, Walter S.13
24 Fandrey, Walter S.20
25 Fandrey, Walter S.15
26 Fandrey, Walter S.16
27 Fandrey, Walter S. 59ff
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes?
Der Text behandelt die Versorgung alter und behinderter Menschen in den Herzogtümern Schleswig und Holstein von 1500 bis 1800, also in der Frühen Neuzeit. Es wird untersucht, wie sich die familiäre Versorgung im Laufe der Zeit verändert hat, insbesondere im Hinblick auf die Industrialisierung.
Was sind die Hauptthemen des Textes?
Die Hauptthemen sind das bäuerliche Altenteil als Form der Altersvorsorge, die Wahrnehmung und Versorgung behinderter Menschen in der Frühen Neuzeit sowie die Veränderungen in der familiären Versorgung durch die Industrialisierung.
Was ist das bäuerliche Altenteil?
Das bäuerliche Altenteil war eine Form der Altersvorsorge im ländlichen Raum, bei der ein Bauer seinen Hof an einen Nachfolger übergab und im Gegenzug Leistungen wie Wohnen, Nahrung und Pflege bis zum Tod erhielt. Die Bedingungen wurden vertraglich festgelegt.
Wer konnte ein Altenteil in Anspruch nehmen?
Grundsätzlich jeder freie Bauer, der über eine gewisse wirtschaftliche Kraft verfügte. Nicht alle Bauernhöfe waren in der Lage, ein Altenteil zu finanzieren.
Wie wurde die Pflege im Alter im Rahmen des Altenteils geregelt?
Die Altenteilsverträge konnten Bestimmungen zur Pflege im Krankheitsfall enthalten. Es wurde festgelegt, dass der Hofbesitzer Hege und Pflege zu leisten hatte oder zumindest die notwendigen Fahrten zum Arzt oder zur Kirche zu gewährleisten hatte. Die Kosten dafür trug jedoch der alte Bauer selbst.
Wie wurden Menschen ohne Altenteil versorgt?
Menschen ohne Altenteil fielen unter die Armenfürsorge, die sich aus kirchlicher Wohltätigkeit, bürgerlicher Hilfe und staatlicher Unterstützung zusammensetzte. Diese war jedoch oft unstrukturiert und ungeregelt.
Wie wurden behinderte Menschen in der Frühen Neuzeit wahrgenommen?
Behinderte Menschen wurden in der Frühen Neuzeit oft mit religiös-magischen Vorstellungen in Verbindung gebracht. Ihre Behinderung wurde teilweise als Strafe Gottes oder Werk des Teufels interpretiert. Die gesellschaftliche Integration hing vom Ausmaß der Behinderung und den jeweiligen gesellschaftlichen Entwicklungen ab.
Wie war die familiäre Versorgung behinderter Menschen organisiert?
In bäuerlichen Wohngemeinschaften ermöglichte das Zusammenleben die wirtschaftliche und soziale Integration Behinderter. Sie arbeiteten ihren Fähigkeiten entsprechend auf dem Hof mit und wurden von ihren Angehörigen versorgt. Rechtlich waren die Familien zur Fürsorge verpflichtet.
Wie veränderte sich die familiäre Versorgung im Laufe der Industrialisierung?
Die Industrialisierung führte zu veränderten Lebensbedingungen, längeren Arbeitszeiten und Armut, wodurch es vielen Familien nicht mehr möglich war, zusätzlich behinderte oder alte Verwandte aufzunehmen. Die Verbindung zu Verwandten und das Gefühl gegenseitiger sozialer Verpflichtungen lies nach. Die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates mit seiner Sozialgesetzgebung entwickelte sich aus den schlechten Lebensbedingungen während der Industrialisierung.
Hat sich die Einstellung zur familiären Versorgung im Vergleich zur heutigen Zeit verändert?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass die Versorgung alter und behinderter Menschen sich ohne Frage verändert hat. Und zwar in Richtung einer größeren sozialen Absicherung und Integration. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Motivation, sich um Familienmitglieder zu kümmern, früher besser gewesen wäre.
- Arbeit zitieren
- Nadine Kawa (Autor:in), 2002, Die Versorgung alter und behinderter Menschen in den Herzogtümern Schleswig und Holstein in der frühen Neuzeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107272