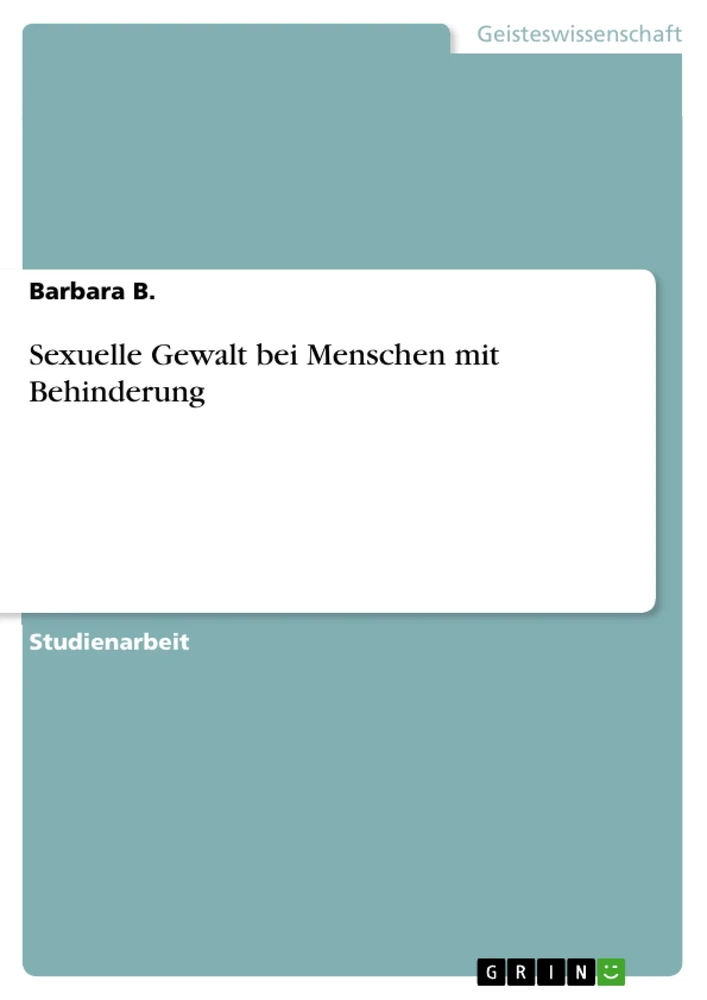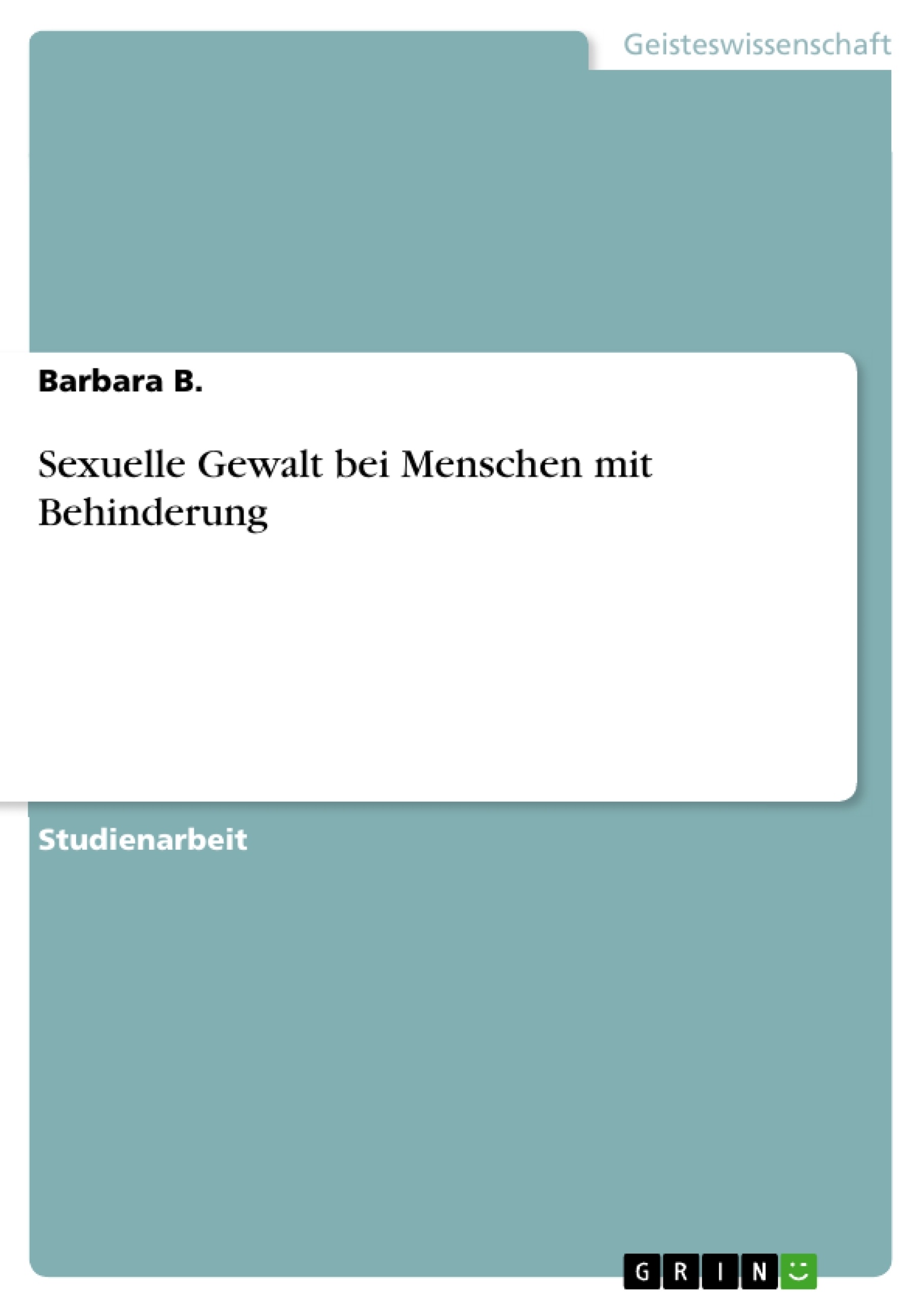Die sexuelle Ausbeutung von Menschen mit Behinderungen war lange Zeit ein Tabuthema, während es im Kontext von Menschen ohne Behinderungen bereits diskutiert wurde. Erst in den 1980er Jahren begannen behinderte Frauen, dieses Thema aufzugreifen. Es dauerte jedoch bis 1992, bis es international Beachtung fand. Seitdem wurden Untersuchungen durchgeführt, die erschreckende Zahlen von Betroffenen offenbarten.
Die sexuelle Gewalt beginnt oft mit dem Verlust der Selbstbestimmung und kann verschiedene Formen annehmen, von unangemessenen Berührungen bis hin zu Vergewaltigung. In Europa gibt es nur wenige Studien zu diesem Thema, aber diejenigen, die durchgeführt wurden, zeigen alarmierende Ergebnisse. In Österreich wurden Studien sowohl mit Frauen als auch mit Männern mit Behinderungen durchgeführt, die aufzeigen, dass sexuelle Gewalt ein weit verbreitetes Problem ist. Die Täter sind oft Personen aus dem Umfeld der Betroffenen, aber auch Fremde. Es ist wichtig, dass dieses Thema weiterhin ernst genommen und untersucht wird, um Betroffenen zu helfen und Präventionsmaßnahmen zu entwickeln.
Sexuelle Gewalt bei Menschen mit Behinderung EINLEITUNG
„ Ich bin M. und in der Schule für Geistigbehinderte. Meine Mutter ist auch geistigbehindert. Mit ihr lebe ich mit meinem Großeltern und Onkels in einer Dreizimmerwohnung. Sehr gut gefällt es mir in der Schule. Da fühle ich mich sicher. Zuhause ist immer Theater. Oft sind viele betrunken, und dann verlangt mein Großvater Sachen von mir, die nicht richtig sind: Zungenküsse und Ausziehen. Er wollte auch schon einmal seinen Penis in mich stecken, aber dann kam meine Großmutter dazu und hat es verhindert. Meine Großmutter hat der Frau vom Jugendamt alles erzählt. Aber sie wollte es gar nicht erst glauben. In der Schule bekomme ich desöfteren einen Wutanfall. Mit den Kindern spiele ich manchmal Zungenküsse und verlieben. Besonders gern gehe ich zum Einzelunterricht. Da darf ich malen und erzählen. “ 1
(Beispiel aus der Praxis von Charlotte Frei - Fachtagung der Bundesvereinigung Lebenshilfe 1995/Deutschland)
Sexuelle Ausbeutung von Menschen mit Behinderung war noch lange ein großes Tabu, als es im Lebenszusammenhang von Menschen (Frauen) ohne Behinderung längst keines mehr war. Zwar haben bereits 1981 behinderte Frauen das Thema auf dem „Krüppel-Tribunal“ in Dortmund aufgegriffen, aber es dauerte 10 Jahre bis es endlich an die Öffentlichkeit gelangte (Zemp, 1991a, 1991b).
Dem anschließend hat die frühe österreichische Bundesministerin für Frauenangelegenheiten das Thema aufgegriffen, indem sie im November 1992 zum ersten internationalen Symposium eingeladen hat.2 Rund 160 Frauen aus neun verschiedenen Ländern kamen und es war erschütternd, wie viele der anwesenden Frauen von sexueller Gewalt betroffen waren.
Dass aber sexuelle Gewalt gegen abhängige Menschen (Kinder, Jugendliche, Behinderte) nicht erst ein Phänomen der letzten Jahrzehnte ist, zeigt ein Blick in die Geschichte. So kann diese Form von Gewalt vom Mittelalter an bis zum 20. Jahrhundert nachgewiesen werden (vgl. Corbin 1997). Weniger bekannt ist die Tatsache, dass Sigmund Freud bereits 1896 in der sogenannten Verführungstheorie die „Hysterie“ seiner Patientinnen als Folge realer sexueller Gewalterfahrung in den Familien gedeutet hat, eine Theorie, die später von Freud revidiert wurde (vgl. Wittrock 1992; Hartwig 1990).
DEFINITION
Sgroi (1982) definiert sexuelle Ausbeutung von Menschen mit Behinderung folgendermaßen:
Sexuelle Ausbeutung von Kindern und/oder physisch und/oder geistig abhängige Menschen durch Erwachsene (oderältere Jugendliche) ist eine sexuelle Handlung des Erwachsenen mit einem abhängigen Menschen, der aufgrund seiner emotionalen, intellektuellen oder physischen Entwicklung nicht in der Lage ist, dieser sexuellen Handlung informiert und frei zuzustimmen. Dabei nützt der Erwachsene, der/die HelferIn die ungleichen Machverhältnisse zwischen sich und der/dem Abhängigen aus, um es/sie/ihn zur Kooperation zuüberreden oder zu zwingen. Zentral ist dabei die Verpflichtung zur Geheimhaltung, die das Kind/die abhängige Person zu Sprachlosigkeit, Wehrlosigkeit und Hilflosigkeit verurteilt.
Nach Fischer (1992) beginnt die sexuelle Gewaltanwendung bereits mit der Verhinderung von Selbstbestimmung; das heißt sie beginnt mit Situationen, in denen Kinder, Jugendliche oder (geistig behinderte) Menschen im Erwachsenenalter gegen ihren Willen getätschelt, geküsst oder gestreichelt werden, in denen sie bei Ignoranz ihres Empfindens (Scham, Abscheu, Erregung o.ä.) am Körper und an den Genitalien betatscht, geküsst o.ä. bis hin zur Verletzung misshandelt werden, in denen sie nicht allein sein dürfen (z.B. im Bad) und ihr „Nein“ missachtet wird. Diesen psychischen Verletzungen muss eine ebensolche Aufmerksamkeit geschenkt werden, wie den schweren körperlichen Übergriffen.
Schwierig ist natürlich die Abgrenzung zum lebensnotwendigen Austausch von Zärtlichkeiten, Körperkontakt und Wärme. „Diese Grenze ist nicht generell zu ziehen, vielmehr muss hier in jedem einzelnem Fall nach dem allgemein akzeptierten Umgangsformen (z.B. nicht Nacktheit) in der Familie, der Intention des Täters und insbesondere nach dem Gefühl des Kindes und seinem Selbstbestimmungsrecht auf (körperliche) Unversehrtheit gefragt werden“ (Wittrock 1992).
Auch Brill (1998) definiert in Ahnlehnung an Wittrock (1992) und beschreibt fünf Elemente, die meist sexuelle Gewalt begleiten:
- Zwischen TäterInnen und Opfern besteht ein strukturell bedingtes Machtverhältnis, d.h. die Machtsituation ist nicht zufällig oder situativ bedingt.
- Sexuelle Gewalt geschieht beabsichtigt und fortschreitend, d.h. sie ist in der Regel kein einmaliges Ereignis.
- Sexuelle Gewalt betrifft alle Altersklassen und soziale Schichten; es handelt sich also um ein ubiquitäres Phänomen.
- Die Opfer werden zu Objekten der TäterInnen, die Handlung hat oft Surrogatcharakter und dient also dem Ersatz.
- Meist geht die Tat einher mit einem Geheimhaltungsverbot von seiten der TäterInnen, wodurch das Opfer zur Sprachlosigkeit verdammt wird.
Diese Elemente sind weitgehend zu finden bei sexueller Gewalt gegen Mädchen und Jungen, die nicht behindert sind. Inwieweit sie sich allerdings noch für Menschen mit Behinderung verschärfen, wird im Laufe dieser Arbeit ersichtlich.
EPIDEMIOLOGIE
In Europa liegen bislang kaum Studien zu sexueller Gewalt an Kindern, Frauen und Männern mit Behinderung vor. In Deutschland wurde an Einrichtungen der Behindertenhilfe eine Befragung durchgeführt, wobei 51,3% der Einrichtungen angaben, dass sie von „Fällen“ von sexueller Gewalt an Menschen mit geistiger Behinderung wüssten. In Österreich wurden in den letzten drei Jahren im Auftrag der ehemaligen Bundesministerin für Frauenangelegenheiten zwei Untersuchungen durchgeführt: 1996 an Frauen und Mädchen mit Behinderung und 1997 an Männern und Jungen mit Behinderung:
In der 1996 durchgeführten Studie (Zemp, Pircher & Neubauer) wurden 130 Frauen, die in institutionellen Einrichtungen leben, d.h. in Wohnheimen, -gruppen, -gemeinschaften oder geschützten Wohnplätzen, befragt. Von den 114 Frauen (nicht alle haben die Frage beantwortet), die verschiedene Behinderungen (Lern- und geistiger, Sinnes- und Mehrfachbehinderung) haben, gaben 62% an, dass sie im Laufe ihres Lebens ein- bis mehrmals sexuell belästigt (unter anderem sexuelle Bemerkungen oder als unangenehm empfundene Berührungen wie Streichen über die Haare oder Wange) worden sind.
Rund 64% der Frauen (116 beantworteten die Frage) gaben an, sexuelle Gewalt ein- oder mehrmals in ihrem Leben erfahren zu haben.
Beinahe jede zweite Frau (44,6%) wurde „gegen ihren Willen oder auf eine ihnen unangenehme Weise“ an ihrer Brust oder ihrem Geschlechtsbereich berührt. 26,2% der Frauen erlebte eine Vergewaltigung oder den Versuch einer Vergewaltigung.
Die TäterInnen sind dabei in erster Linie Männer, die den Frauen bekannt sind (39,4%). Abgesehen von männlichen Heimbewohnern (13,3%) und Pflege- oder Stiefvätern (6,1%) ist beinahe ein Viertel der TäterInnen (23,1%) den Frauen nicht bekannt. Es sind dies Straßenbegegnungen, fremde Männer oder Personen, die für die Frauen entweder gar nicht zuordbar sind, oder sie vom Sehen her kennen, die ihnen aber namentlich nicht bekannt sind. Ein Bespiel hierfür ist eine 43jährige Frau mit Down-Syndrom, die alleine auf einem geschützten Wohnplatz lebt. Der Täter, von dem sie nicht einmal den Vornamen kennt, kommt einmal wöchentlich vorbei, und zwar immer am Mittwoch. Zuerst sitzen sie auf dem Sofa und plaudern, was ihr sehr gut gefalle, weil sie sonst so viel alleine sei. Dann aber käme das „Andere“, was nicht schön sei. Sie zeigte den Untersuchenden wie er sich vor ihr befriedige und sie zum Zuschauen zwinge. Diese Frau wusste außer über den Samenerguß, den sie wöchentlich gezwungenermaßen miterlebt, nichts über Sexualität.
Wir sind also in Bezug auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit geistiger Behinderung auf Schätzungen angewiesen. Strasser-Hui (1992) und Stoppa (1992) vermuten, dass hier die Dunkelziffer (in Relation zur Gesamtzahl der jeweiligen Population) höher ist als bei nicht behinderten Kindern und Jugendlichen.
Auf jeden Fall kann davon ausgegangen werden, dass geistig behinderte Mädchen und Frauen gefährdeter sind als Jungen oder Männer mit geistiger Behinderung.
In einer Studie von Furey (1994) konnte gezeigt werden, dass von 461 untersuchten Fällen an geistig behinderten Menschen in 72% der Fälle Frauen betroffen waren. Dies belegt auch die Statistik von Sinason (1992): Der Anteil von Personen, die von sexueller Gewalt betroffen waren, betrug bei allen in einer psychiatrischen Klinik vorgestellten geistig behinderten Menschen mit psychischen Störungen 70%, davon waren 67% weiblich; von insgesamt 160 vorgestellten geistig behinderten Erwachsenen mit psychischen Problemen waren 69% sexuell misshandelt worden (davon 66% Frauen), von 40 vorgestellten Kindern mit geistiger Behinderung und psychischen Auffälligkeiten waren 75% sexuell misshandelt worden (davon 70% Mädchen).
Wie auch die Ergebnisse der österreichischen Studie zeigen, handelt es sich bei den TäterInnen überwiegend um Männer (ca. 80%), die meistens aus dem sozialen Nahbereich stammen (z. B. Väter, Stiefväter, Onkel, Brüder, Bekannte oder auch Betreuer) und nicht selten als rechtschaffene, angesehene Personen gelten (Furey 1994).
Im Rahmen der Studie von Zemp, Pircher & Schoibl (1997) wurden in verschiedensten Einrichtungen (wie Wohnheimen oder Wohngemeinschaften) 136 Männer mit Behinderung befragt. Wie bei ihrer Untersuchung von Frauen mit Behinderung differenzierten die AutorInnen auch bei der Erhebung bei den Männern zwischen sexueller Belästigung und sexueller Gewalt. Sexuelle Gewalt bezog sich dabei unter anderem auf sexuelle Handlungen wie Streicheln der Geschlechtsteile oder orale und anale Penetration. Die Hälfte der Männer gab an, sexuelle Belästigung und/oder sexuelle Gewalt erlebt zu haben. Dabei führten 39% an, dass sie jemand an „bestimmten Körperstellen wie im Gesicht, an den Haaren oder ‚am Hintern‘“ unangenehm angefasst hatte. 21% der Männer sagten, jemand habe sie an ihrem Penis oder den Hoden berührt.
SITUATION BEHINDERTER MENSCHEN
Die Thematik der sexuellen Gewalt von Menschen mit Behinderung ist durch eine Reihe von Faktoren geprägt.
Dabei spielt insbesondere die gesellschaftliche Vorstellung über die Sexualität von Menschen mit Behinderung eine wesentliche Rolle (Zemp et al., 1997). Nach wie vor wird ihnen Sexualität abgesprochen, sie werden als „geschlechtslose Wesen“ , „Neutren“ betrachtet beziehungsweise hätten sie eine animalische Sexualität, denn sie schmeißen sich jeden an die Brust; das aktive Ausleben von Sexualität wird zum Teil auch heute noch durch institutionelle Rahmenbedingungen aktiv verhindert oder durch das Betreuungspersonal explizit verboten. Dementsprechend erhalten sie oft keine sexuelle Aufklärung und sie wissen kaum etwas über ihren eigenen Körper.
Diesen Aspekt des „Nichtswissens“ über den eigenen Körper und über Sexualität zeigt die Studie von Zemp, Pircher & Neubauer (1996) in einem sehr deutlichem Maße auf:

Aus den gewonnenen Daten lassen sich folgende Tendenzen ablesen:
- Im Schnitt ist der Grad der Aufklärung bei Frauen mit Behinderung gering. 34% wissen nicht Bescheid über sexuelle Funktionen: von 17,6% der Frauen kam entweder keine Antwort oder sie konnten die Frage nicht einordnen. Es ist daher anzunehmen, dass auch ein Teil dieser Frauen keine Sexualaufklärung erhalten hat. Auf diesem Hintergrund kann gesagt werden, dass ungefähr die Hälfte der Frauen nicht aufgeklärt ist. Eine Betreuerin beschreibt diesen Zustand folgendermaßen: „Unsere Damen wissen zwar, dass sie die Tage kriegen, nur warum sie über sie gekommen sind, und dass sie irgendwann einmal nicht mehr kommen, das haben sie noch nicht gehört.“ So können 38,5% der Frauen nicht erklären, warum Frauen die Monatsblutung haben.
- Im Zusammenhang mit der Sexualaufklärung ist den befragten Frauen am ehesten der Unterschied zwischen Mann und Frau bekannt (64,6%).
- Am allerwenigsten Bescheid wissen die Frauen über den Samenerguß, dies sind 46,2%.
- 47,7% der Frauen wissen, wie der Geschlechtsakt verläuft und das daraus ein Kind entstehen kann (51,5%).
- 46,2% der Frauen wissen, was sexuelle Gewalt ist. Angesichts der Tatsache, dass es in Heimen keine unfassende Aufklärung über sexuelle Gewalt gibt, ist dieser Prozentsatz relativ hoch.
- 43,1% der Frauen geben an über Verhütung Bescheid zuwissen. Es ist anzunehmen, dass dies vor allem jene Frauen sind, die selbst verhüten.
In Gesprächen mit dem Personal in den jeweiligen Einrichtungen wurde in dieser Studie deutlich, dass sie sich weitgehend überfordert fühlt, was die Sexualaufklärung von Menschen mit Behinderung anbelangt. Dies ist umso fataler, als viele Frauen Jahrzehnte in Einrichtungen verbringen und diese auf verschiedensten Ebenen Erziehungs-, Aufklärungsund Sozialisierungsfunktionen übernehmen müssten. In den meisten Einrichtungen gibt es keine gezielten Aufklärungsprogramme.
Ein entscheidender Faktor kommt auch der Entwicklung von Kindern mit Behinderung zu. Sie müssen weitaus häufiger als Kinder ohne Behinderung medizinische Untersuchungen und Behandlungen sowie operative Eingriffe über sich ergehen lassen. So notwendig viele dieser Maßnahmen sind, so notwendig ist auch zu hinterfragen, welche Therapie noch zu welcher Entwicklungsförderung beitragen kann. Somit ist Therapieanwendung eine Gradwanderung, denn sie kann auch eine erhöhte Gefährdung der personalen Identität des Kindes sein, wenn diese sich nicht als Subjekt seines Handelns, sondern als Objekt des Handelns anderer begreifen muss (Leyendecker 1979).
Zudem wird im Rahmen dieser Interventionen oftmals ihre Intimsphäre verletzt. Da sie immer wieder erleben müssen, dass etwas mit ihrem Körper nicht stimmt, entwickeln Kinder, die eine Behinderung haben, eher ein negatives Körperschema und Körperbewusstsein. Allzu oft erleben sie zudem das Gefühl: „An mir darf jede und jeder herumfummeln.“ (Zemp et al., 1997) bzw. machen sie von frühester Kindheit an die Erfahrungen, die ihnen vermitteln: „Mit mir ist etwas nicht in Ordnung“.
Hinzu kommt, dass Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft noch immer soziale Ablehnung und Ausgrenzung erfahren. Es fehlt ihnen sozusagen eine gewisse „Positionsmacht“ in unserer Gesellschaft. Menschen mit Behinderung (nicht nur geistig behinderten) wird in der Regel ihre Mündigkeit abgesprochen, d.h. sie sind gesellschaftlich gesehen Unmündige und (Befehls-) EmpfängerInnen. Daher ist es leicht nachzuvollziehen, dass sie auf Grund fehlender Zuneigung, körperlicher Nähe und Zärtlichkeit sexuelle Übergriffe als Form von - wenngleich negativer - Zuwendung ertragen.
Darüber hinaus ist ihr Alltagsleben oftmals durch Fremdbestimmung und Abhängigkeiten geprägt, wie dies im Besonderen in institutionellen Einrichtungen der Fall ist. Sie sind also oft auf Hilfe dritter angewiesen, z.B. bei der Körperpflege, bei der Zubereitung und dem Zu-sich- Nehmen von Nahrung, bei der Fortbewegung im und/oder außer Haus usw.. Ihre Lebenssituation erfährt viele Einschränkungen; vor allem im Heim, in der Sonderschule oder in anderen Institutionen. Zu diesen Einschränkungen gehört auch, dass ein Intimbereich in Heimen - mit ständig wechselnden Betreuungspersonen - nicht so vorhanden ist, wie ihn nichtbehinderte Personen als selbstverständlich erachten und bei sich vorfinden.
Alle diese Faktoren tragen dazu bei, dass sich Menschen mit Behinderung - je nach der Art und Ausprägung ihrer Behinderung - gegen sexuelle Gewalt zumeist nicht ausreichend schützen können.
Zudem haben sie oft nicht die notwendigen Artikulationsmöglichkeiten, um sich über den Missbrauch mitteilen zu können. Der Sprachlosigkeit vieler Betroffener steht die Sprachgewalt der Täter gegenüber. Es gibt Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung nicht über verbale Kommunikation verfügen. Andere sind eben sprachlos, weil sie sexuell nie aufgeklärt wurden und von daher nicht benennen oder verstehen können, was mit ihnen passiert, wenn sie sexuelle Gewalt erfahren. Dem gegenüber steht die Wortgewalt der TäterInnen, die einerseits Geschichten erfinden und zum besten geben können, um Menschen mit Behinderung für die Gewalttat zu gewinnen. Diese haben keine Möglichkeit die Angaben der TäterInnen zu überprüfen.
Nicht zuletzt wird Menschen mit Behinderung meist nicht geglaubt, wenn sie Missbrauchserfahrungen erwähnen. So werden ihre Erzählungen von sexueller Gewalt zumeist als „Fantastereien“ abgewertet oder mit diskriminierenden Bemerkungen wie zum Beispiel: „So eine würde ohnehin keiner nehmen“, kommentiert (Zemp et al., 1997). Sowohl in der pädagogischen wie auch in der juristischen Praxis gelten Aussagen von geistig Behinderten weniger glaubhaft; dies bestätigen US-amerikanische und deutsche Untersuchungen (vgl. Becker 1995); Degener 1994).
Die erweiterte Tabuisierung des Problems „sexueller Missbrauch an Menschen mit Behinderung“ spiegelt sich auch darin wider, dass an dieser Thematik weltweit bislang kaum Interesse bekundet wurde. Sie wird im Gegenteil noch dadurch verschärft, dass immer wieder aufs Neue die Diskussion um die Zwangssterilisation von Frauen und Männern mit Behinderung aufgegriffen wird - ein besonders schwieriges und im Dunkel liegendes Thema.
Das Recht auf eine gute Vorinformation bei der Entscheidung der Frau über ihren eigenen Körper wird gerade bei der Zwangssterilisation von Frauen mit geistiger Behinderung ignoriert. Seit dem Bekanntwerden skandalöser Vorfälle im Sommer 1997 in Schweden, ist die Diskussion auch in Österreich wieder aktuell. Dabei wurden Dunkelziffern bis zu 70% aller geistig behinderten Frauen kolportiert.
Diese Zahlen erscheinen zu hoch, wie die Ergebnisse von Zemp & Pircher (1996) nahe legen. 27% der befragten Frauen gaben in dieser Studie an, vor Erreichen ihrer Großjährigkeit - zumeist auf Wunsch ihrer Eltern - zwangssterilisiert worden zu sein, was von vielen als weitere Gewalterfahrung erlebt wurde.
Zemp & Pircher betonen, dass es bei Sterilisationen nicht um den Schutz und die Bedürfnisse der jeweiligen Frau ginge, sondern vielmehr um den „Schutz für die Täter und die Umgebung“, welche die Folgen einer möglichen Schwangerschaft mitzutragen hätten. Für eine Frau mit Behinderung bedeutet eine Sterilisation allerdings nicht nur einen Eingriff in ihr Frau-Sein und ihre Selbstbestimmung, sondern auch ein erhöhtes Risiko, sexueller Gewalt ausgesetzt zu werden, da durch eine Sterilisation die Möglichkeit einer Schwangerschaft unterbunden und sie selbst damit zum „Freiwild“ gemacht wird.
Eine Neuordnung der gesetzlichen Grundlagen in Österreich ist dringend notwendig (Lebenshilfe 1997). Dabei sind Forderungen zu stellen, die die Sterilisation von Menschen mit geistiger Behinderung erheblich erschweren: Die betroffene Person muss älter sein als 25 Jahre, eine Sterilisation darf ihrem Willen nicht widersprechen, die Sterilisation muss vom Pflegschaftsgericht nach eingehender Prüfung genehmigt werden.
DAS ERLEBEN VON SEXUELLER GEWALT UND DIE FOLGEN
Die Folgen von sexueller Gewalt sind bei Menschen mit einer Behinderung grundsätzlich keine anderen als bei Menschen ohne Behinderung, aber sie verstärken oder erhärten gewisse Folgeerscheinungen, unter denen Menschen mit Behinderung aufgrund der Reaktionen der Umwelt auf die Behinderung eh schon zu leiden haben.
Aus wissenschaftlichen Studien weiß man, dass es eher die Regel ist, dass bei den überlebenden deutliche Erinnerungen an die sexuelle Ausbeutung fehlen. Das hat zur Folge, dass sich Betroffene mit all ihren Problemen, ihrem mangelnden Selbstwertgefühl, ihren Depressionen und Schuldgefühlen nicht als normal empfinden und darunter leiden, anscheinend anders zu sein als die Übrigen, ohne dafür einen Grund zu wissen. Sowohl Professionelle als auch Betroffene selber bringen solche Folgeerscheinungen schnell mit Behinderung in Zusammenhang, weil aufgrund der negativen Definition, denen Menschen mit Behinderung seit ihrer Kindheit ausgeliefert sind (es wird untersucht was sie/er aufgrund der Behinderung nicht kann und darauf wird versucht durch Hilfsmittel oder Therapie diese zu kompensieren), oft - wie schon erwähnt - ein mangelndes Selbstwertgefühl vorhanden ist, die Isolation, in der die Menschen mit Behinderung noch oft leben müssen, Depression begünstigt oder verstärkt usw.
Finkelhor (1985) hat beschrieben, welche Dynamik sich traumatisch auf das Verhalten und die psychische Entwicklung auswirkt.
- Traumatische Sexualisierung
Traumatische Sexualisierung führt beim Kind zu einer Konditionierung: Sexuelle Aktivität wird mit negativen Gefühlserinnerungen gekoppelt. Es werden dem Kind oft falsche sexuelle Normen und Moralvorstellungen vermittelt um sich so dem Kind zugänglicher zu machen (z.B.: „alle Väter, die ihr Kind lieben, tun das“). Dies führt dazu, dass Sexualität und Liebe zunehmend verwechselt werden, so dass eine Aversion gegen Intimität und sexuelle Stimulierung auftreten kann und die eigene sexuelle Identität gebrochen wird. Typische Verhaltensweisen wie zwanghaftes sexuelles Ausagieren, aggressives sexuelles Verhalten, phobisches Vermeiden von Intimsphäre, Orgasmusprobleme und Prostitution (dieser Zusammenhang ist allerdings unklar) können sich ergeben.
Neben körperlichen Verletzungen und Schwangerschaften ist altersunangemessenes Sexualverhalten von Mädchen und Jungen der einzige eindeutige Hinweis auf sexuelle Gewalt. Oft sexualisieren Opfer soziale Beziehungen in der aktiven Wiederholung dessen was sie passiv erlebt haben. Sie drücken zum Beispiel im Spiel mit Puppen, Bloßstellen der Genitalien, distanzlosem Verhalten, Promiskuität usw. das Erlebte aus, was sie selbst nicht in Worte fassen können. Dies ist auch bei geistig behinderten Menschen oft die einzige Möglichkeit die Gewalterfahrung zu verarbeiten, oder oft auch die einzige Ausdrucksmöglichkeit die ihnen zur Verfügung steht.
- Stigmatisierung
Die Stigmatisierung, das Erleben des Gezeichnetsein verstärkt die Geheimhaltung, das Schamgefühl und den Eindruck, selber an allem Schuld zu sein, denn meist macht der Täter das Opfer für die Tat verantwortlich („Du hast es ja gewollt“). Daraus ergeben sich die Gefühle des Ausgestoßenseins, das schlechte Selbstwertgefühl (hier werden durch Reaktionen auf die Behinderung ohnehin schon vorhandenen negative Gefühle massiv verstärkt), Scham und Schuldgefühle. Typische Verhaltensweisen wie Auto-Aggression, Drogen- und Alkohol- oder Medikamentenabhängigkeit helfen Betroffene. [Die Drogen- und Alkoholabhängigkeit wird in den meisten Studien als statistisch signifikant erhöht beschrieben. (vgl. Breuker u. Tödte 1988; Laustroer 1996).] Zu diesem Punkt gehört auch die Selbstverstümmelung: Betroffene wollen über dem Schmerz spüren, dass es sie noch gibt und drücken sich brennende Zigaretten auf der Haut aus, fügen sich Schnitte zu, müssen sich zwanghaft die Haare ausreißen, kauen die Fingernägel usw.. Selbstmord scheint für viele Betroffene erstens der einzig wirkliche Schutz vor den Übergriffen zu sein und zweitens ist er die einzige Lösung, dem Selbsthass, der Scham, der Verzweiflung ein Ende zu setzen.
- Betrug
Das Kind wurde in seinem Vertrauen getäuscht, in seiner Abhängigkeit und Verletzlichkeit ist es manipuliert worden. Statt Schutz zu bekommen wurde es ausgebeutet und verletzt. Dies führt zu Misstrauen, Wut und Feindseligkeit, aber auch zu Depression und Trauer. Im Verhalten äußert sich dies in eine Opferhaltung, in der Menschen mit Behinderung ohnehin schon oft gefangen sind, die die Gefahr einer späteren Wiederholung der sexuellen Gewalt in sich birgt.
- Machtlosigkeit
Da das Kind erlebt hat, dass die Körpergrenzen gegen den eigenen Willen überschritten worden sind, hat sich das Gefühl des Ausgeliefertsein eingeprägt: da sie die wiederholte Erfahrung machen mussten hilflos zu sein,
weil sie der Gewalt kein Ende bereiten können, entwickelt sich die Überzeugung als Mensch keine Wirkung zu haben, keine Einfluss darauf zu haben, was mit ihnen geschieht. Dies ist bei Menschen mit Behinderung wieder eine Verschärfung eines meist schon sehr bekannten Gefühls.
Dieses Gefühl führt zu Angst- und Panikattacken, was sich in Zwängen und Phobien ausdrücken kann, wie zum Beispiel dauerndes oder zu Unzeiten sich waschen, regredieren zu müssen, haben Beziehungsschwierigkeiten bis zu Vereinsamungstendenzen, ein geringes Selbstwertgefühl, leiden an Depression, sind überangepasst oder sehr aggressiv; so gibt es zum Beispiel Kinder, die in der Gruppe ein sicheres Auftreten zeigen, während sie gleichzeitig sehr ängstlich reagieren können im Einzelkontakt, d.h. sie haben Angst, wenn sie mit einem Erwachsenen allein im Raum sind, erneut Gewalt zu erfahren. Im sozialen Verhalten reagieren sexuell ausgebeutete Kinder oft mit übersteigertem Fremdeln oder distanzlosem Verhalten, sie ziehen sich aus den sozialen Kontakten zurück, oder weil sie nie gelernt haben, dass die eigenen Grenzen respektiert wurden, verhalten sie sich distanzlos und überschreiten auch selbst immer Grenzen.
Folgen von sexueller Gewalt zeigen sich oft auf psychosomatischer Ebene wie Einnässen, Einkoten, Unterleibsschmerzen, Schwindelanfälle, Essstörungen (statistisch signifikant in den meisten Studien), Schlafstörungen, Erstickungsanfälle, Würge- und Ekelgefühle, chronische Entzündungen der Harnwege oder Scheide, im Erwachsenenalter oft auch Gewebsveränderungen in Brust, Scheide, Uterus, Klitoris, Hautkrankheiten, Sprachstörungen; viele Überlebende haben Angst, eigene Kinder zu gebären, sie haben Mühe mit der Schwangerschaft, was sich z.B. in wiederholten Spontanaborten ausdrücken kann.
Weil der Mensch ja eine Einheit von Körper, Seele und Geist ist, drücken sich Verletzungen auf der einen Ebene auch auf der anderen aus. Daher ist es nicht verwunderlich dass Menschen die sexuelle Gewalt erfahren haben oft ein negatives Gefühl zu ihren Körper entwickeln. Nicht selten ist er ihnen verhasst, er bedeutet Gefahr, Schmutziges. Der Körper wird mit Gewalt identifiziert und deshalb vernachlässigen sie ihn, malträtieren ihn mit zu viel oder zu wenig essen. Damit drücken sie ihre Wut an sich selbst anstelle ihres Täters. Viele Betroffene sind wahre MeisterInnen in der gefährlichen Lebensstrategie des Abspalten von Empfindungen. Sie „verlassen“ ihren Körper, machen ihn gefühllos und schmerzunempfindlich, der Körper wird als Wegwerfhülle behandelt. Es geht immer darum sich selbst, bzw. die Gefühle möglichst nicht wahrzunehmen, das verletzte Innere zu schützen, abzuspalten, die eigenen Empfindungen auf ein Minimum zu reduzieren oder sich eben „weg“ zu machen, z.B. auch mit Träumen und Phantasien. Es entwickelt sich eine Art äußeres und inneres Leben (multiple Persönlichkeitsspaltungen). Diese Spaltung stellt sich bei vielen als Spaltung zwischen Körper und Empfindungen dar. Das Selbst (Empfindungen) zieht sich so weit zurück, dass die äußerlichen Gewalterfahrungen des fremdgewordenen Körper keine solche Verletzung mehr sein kann. Die Spaltung vermittelt so eine Art Kontrolle über sich selbst, wenn schon die Kontrolle des eigenen Lebens, des eigenen Körpers nicht gelingt. Andere leiden darunter, dass sie nur sadomasochistische Phantasien produzieren können, dass nur Gewalt, bzw. Unterwerfung, Demütigung und Erniedrigung zu sexueller Erregung und Entspannung führen.
Der Studie von Zemp & Pircher (1996) zufolge haben in Fällen von sexueller Gewaltanwendung 54,6% der befragten Frauen körperliche Beschwerden. Zwar konnten die Autorinnen keine statistisch signifikanten Zusammenhänge zwischen der erlebten sexuellen Gewalt und den körperlichen Symptomen feststellen - da aber viele der befragten Frauen jahrelang verschiedenen Gewalterfahrungen ausgesetzt waren, gehen sie jedoch davon aus, dass die genannten Beschwerden als Folgeerscheinungen dieser wiederholten Missbrauchserfahrungen zu betrachten sind. Entsprechend ist es allerdings unmöglich zu bestimmen, welches Symptom auf welche traumatische Erfahrung zurückzuführen ist. Zu den häufigsten Beschwerden der Frauen zählen autoaggressives Verhalten wie das Ausreißen von Haaren, Stechen mit spitzen Gegenständen oder das Ausbrennen von Zigaretten auf dem Körper (35,6% der Frauen), Phobien und Ängste (31,5% der Frauen), Schwindelgefühle und Epilepsie (20,5% der Frauen) sowie Bauch- und Magenschmerzen (19,2% der Frauen).
Ähnlich wie die befragten Frauen zeigen auch die Männer am häufigsten Schwindelanfälle (31%), Phobien und Ängste (17%) sowie autoaggressives Verhalten (10%). Darüber hinaus gaben die befragten Männer häufig sexuelle Probleme (11%) und allgemeine Schmerzen (10%) an.
Ein relativ neu auftauchender Gedanke in der Darstellung sexueller Gewalt gegen behinderte Kinder ist die Vermutung, dass bestimmte Formen oder Manifestationen von Behinderung ihre Ursache in sexuellen Gewalterlebnissen selbst haben könnten. Becker (1995) verweist auf einige US-amerikanische Studien, in denen z.B. psychogene Krampfanfälle, Lernschwierigkeiten und geistige Retardierung genannt werden, wobei bei letzteren allerdings der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung nicht eindeutig geklärt ist. Vereinzelt tauchen auch Beschreibungen auf, die geistige Behinderung als Folge des Gewalttraumas sehen; ähnliches wird auch teilweise bei Autismus vermutet (vgl. Knapp 1993). Aus der Anlaufstelle „Zündfunke“ für Opfer sexueller Gewalt in Hamburg beschreibt Susanne Engel den Fall eines acht jährigen Mädchens die aufgrund sexueller Gewalt zur Sonderschülerin wurde; ihre Sprachstörungen führten sie in die Sprachheilschule. Wenn auch nur in einigen Fällen nachgewiesen ist, dass Behinderung Folge von sexueller Gewalt sein kann, sollte dies jedoch nicht generell ausgeschlossen werden.
Es ist klar, dass all die oben angeführten Symptome auch im Rahmen anderer Krisen oder Krankheitsbilder auftreten können daher sollte man beim diagnostizieren und nachweisen von sexueller Gewalt besonders vorsichtig sein. „Ein Syndrom sexuellen Missbrauchs konnte bislang nicht bestätigt werden“ (Offe u.a. 1992)
INTERVENTION - nach dem Daphne-Programm (2000)
Was tun bei Verdacht von sexueller Gewalt?
Begriffserklärung: Der Begriff „Opfer von sexueller Gewalt“ wird hier gemieden, weil er die Schwäche und Wehrlosigkeit hervorhebt. Deshalb wird der Begriff „Überlebende von sexueller Gewalt bevorzugt, weil er die Stärke und den Lebenswillen der von Gewalt Betroffenen betont.
Es gibt mehrere Aspekte, die bei Verdacht oder Aufdeckung sexueller Gewalt unter anderem dringend berücksichtigt werden sollten:
- Ruhe Bewahren! Voreiliges Handeln kann schaden. In den meisten Fällen ist davon auszugehen, dass die sexuelle Gewalt schon länger ausgeübt wird. Überstürztes Handeln kann der/dem Überlebenden häufig mehr schaden, als dass es ihr/ihm hilft.
- Wenn Verdacht auf sexuelle Gewalt besteht, kann es hilfreich sein, Signale oder auffällige Situationen selbst tagebuchähnlich zu dokumentieren, um sich Klarheit zu verschaffen.
- Der/dem Überlebenden der sexuellen Gewalt gegenüber sollte die Beraterin/Unterstützerin signalisieren: „ Ich glaube Dir. Es ist gut und richtig, dass Du darüber sprichst. “
- Auch bei einem Betroffenen, der nicht verbal (in Sätzen) kommunizieren kann, ist es möglich und nötig, sie/ihn aktiv in den Prozess einzubeziehen.
- Bei Aufdeckung sollte mit der Überlebenden geklärt werden, ob es UnterstützerInnen für sie/ihn gibt.
- Sexuelle Gewalt z.B. in einer Familie oder Wohngruppe sollte nie aufgedeckt werden, ohne vorher die Folgen abzuklären. Wenn die betroffene Person anschließend darauf angewiesen ist, in der Situation der Abhängigkeit zu bleiben, kann dies für sie gravierende Folgen haben.
- Das eigene Handeln der Unterstützerin gegenüber der Betroffenen muss fortwährend transparent gemacht werden. Von Gewalt Betroffene machen immer wieder die Erfahrung, dem Täter hilflos ausgeliefert zu sein, keinen Einfluss auf sein Handeln zu haben. Um so wichtiger ist es, dass sie sicher sein können, dass nichts gegen ihren Willen passiert - und zwar gerade, wenn sie sich Hilfe holen. Sie benötigen Sicherheit und Transparenz. Es ist für eine Unterstützerin einer überlebenden Person zwingend notwendig, mit ihr konkret zu klären, welche Informationen z.B. an das Gericht, aber auch z.B. an Angestellte der Wohngruppe weitergegeben werden sollen. Es gibt für Unterstützerinnen keine Verpflichtung, sexuelle Gewalt anzuzeigen.
- Es ist einer betroffenen Person nicht zwangsläufig zur Anzeige zu raten. Es muss genau geprüft werden, zu welchen Konsequenzen eine Anzeige führt und ob zu erwarten ist, dass die Folgen im Sinne des Betroffenen sind. Eine erstattete Anzeige kann nicht zurückgenommen werden! Es sollte deshalb vorher dringend abgeklärt werden, was der/die Betroffene sich davon erhofft.
Auch wenn die Möglichkeiten der Unterstützerinnen begrenzt sind, ist es für alle Beteiligten immer wichtig, nicht den Mut zu verlieren. Für die von Gewalt Betroffenen sind oft schon ‘kleine Angebote‘ eine große Entlastung.
THERAPIEMÖGLICHKEITEN
Nicht jeder Betroffene mit Gewalterfahrung benötigt eine Therapie. Vielen Betroffenen ist mit regelmäßiger Beratung ebenso geholfen. Das ist individuell und in den einzelnen Lebensphasen verschieden.
Von sexueller Gewalt Betroffene entwickeln Strategien, trotz traumatischen Gewalterlebnisse zu ‘über’-leben.
Sie erarbeiten sich also ihren Weg der Bewältigung und der Heilung. Ihr Wille, mit dieser Erfahrung zu überleben, weckt ihr Potential zur Selbstheilung.
Wenn eine Person mit Behinderung zu der Entscheidung kommt, eine Therapie zu machen, hat sie große Schwierigkeiten, eine geeignete Therapeutin zu finden. Leider gibt es immer noch nicht genügend Therapeutinnen, die sich bereit erklären, mit Betroffenen mit Behinderung zu arbeiten. Dies liegt zum einen an den fehlenden Kenntnissen und der daraus resultierenden Unsicherheit der Therapeutinnen. Hinzu kommen auch hier wieder die üblichen Barrieren wie unzugängliche Therapieräume und fehlende Kommunikationsmöglichkeiten. Gerade für Gehörlose ist dies ein großes Problem; sie bleiben mit ihrer Gewalterfahrung weitestgehend isoliert.
Aiha Zemp beschreibt in ihrem Tagungsbericht vom 18.02.94 in Köln einige wichtige Punkte die in der Therapie mit Menschen mit einer Behinderung zu beachten sind:
- „Du sollst dir kein Bildnis machen“
Welches Menschenbild prägt Menschen die mit behinderte Menschen arbeiten? Ist ein Mensch mit einer Behinderung für sie ein erwachsenes Kind, das sie weiter zu erziehen haben? Oder ist dieser Mensch für sie eine Frau, ein Mann, mit dem Bedürfnis und dem Recht nach Selbstbestimmung, nach gelebter Sexualität? Aiha Zemp:
„ Wenn ich davon ausgehe, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung eine unter anderen möglichen Formen des Menschseins leben und aufgrund ihrer tiefern Intelligenz gewisse Begleitung und Hilfe brauchen, dann ist der Therapieansatz bei sexuell ausgebeuteten Knaben und Mädchen, Frauen und Männer mit einer geistigen Behinderung grundsätzlich kein anderer als der bei Ü berlebenden ohne sichtbare Behinderung. Dies verlangt von mir als Therapeutin nicht nur, um meine eigenen Verletzungen zu wissen, nicht nur die Bereitschaft, mich mit dem schwierigen Thema der sexuellen Gewalt zu stellen, sondern auch einer eigenen Auseinandersetzung mit Behinderung. “
- Therapie liebt Verschüttetes heraus und liebt Heilung hinein
Als Therapeut soll man sich auf die Selbstheilungskräfte des KlientenIn beziehen, d.h. man soll die innere Heilerin oder den inneren Heiler im Betroffen wecken. Aiha Zemp:
„ Es ist unmöglich, Heilung zu „ machen “ . Als Therapeutin kann ich helfen, Blockaden aus dem Weg zu räumen, die eine mögliche Heilung erschweren, denn Heilung ist ein Entwicklungsprozess, bei dem der Weg das Wesentliche ist und nicht irgendein anzupeilendes Ziel. Betroffene sind auf einen Menschen angewiesen, der bereit ist, sich wirklich einzulassen, bedingungslos zu glauben. (...) Es ist dann meine Verantwortung als Therapeutin allein, so bewusst mit den eigenen Emotionen umzugehen, dass ich mich nicht damit in den gefühlsm äß igen Prozess der Klientin, des Klienten einmische und dadurch ihren/seinen Prozess störe. “
- Heilung ist immer der Prozess der Betroffenen selber
„ Auch Opfer mit einer geistigen Behinderung entscheiden sich selber für das Tempo oder für Unterbrechungen. Sie geben deutliche Zeichen, indem sie z.B. während der Therapiestunde dauernd auf die Uhr schauen, das Thema wechseln, wenn es für sie im Augenblick zu viel oder zu schwierig wird oder indem sieüber längere Zeit nicht mehr in die Therapie kommen wollen. Auch das liegt in der Verantwortung der Therapeutin, derartige Zeichen und Signale zu erkennen und als solche zu respektieren, d.h. es muss jeglicher Druck vermieden werden, weil sonst auch in der Therapie wieder Grenzenüberschritten werden. “
Bei diesem Aspekt kommt natürlich das Bild das ich von Menschen mit einer Behinderung habe sehr zum tragen. Der Heilungsprozess bei sexueller Gewalt ist ein oft sehr langer und beschwerlicher Weg. Daher braucht man sehr viel Geduld und zeit, bei Opfern mit einer geistigen Behinderung noch mehr, jedenfalls muss man die Arbeit noch subtiler gestalten. - Was besonders zu beachten ist
In der Therapie kann mit Menschen mit einer Behinderung sehr gut mit Sandkastenspiel oder mit anatomischen Puppen gearbeitet werden. Anhand der Puppen können sie sehr gut zeigen was mit ihnen gemacht wurde, das sie weder richtig verstehen noch in Worte fassen können.
Auch ist es wichtig den Helfer/Innenkreis stark mit einzubeziehen, damit diese im Alltag den therapeutischen Prozess unterstützen können. Ein wesentlicher Teil besteht auch darin den Opfern Gefühle wie Wut und Trauer, aber auch Freude und Lust wieder zu entdecken, denn wie schon erwähnt gehört zur Strategie von Betroffenen, Gefühle abzuspalten und zu verdrängen. Oft begegnen sie hier zum ersten mal die Gefühle von Wut und Trauer über ihre Behinderung.
Auch ist das Zurückerobern des Körpers als Ort der Lust wichtig. Es ist wichtig dass sie lernen ihren Körper zu pflegen, zu umsorgen. Dazu gehört auch Grenzen zu setzen, sich für den eigenen Körper zu wehren. Selbstverteidigungskurse sind auch für Menschen mit Behinderung sehr wichtig.
Es sollen auch außerhalb der Therapie Möglichkeiten geschaffen werden, wo sich Menschen mit einer Behinderung mit anderen auf ihrer Ebene treffen und kennenlernen können. Denn auch sie haben ein recht auf Liebe, Zärtlichkeit und Sexualität.
RECHTLICHE ASPEKTE
Schändung (StGB)

Wenn ein Opfer ihre Gewalterfahrungen irgendwem erzählt und auch den Täter nennt, bedeutet dies noch nicht, dass dies zu folgenreichen Konsequenzen für ihn führt. Nach wie vor ist Vergewaltigung bzw. sexuelle Gewalt generell der männlichen Norm- und Rechtssprechung unterlegen. Bei Menschen mit Behinderung, denen in der Gesellschaft ein noch geringerer Stellenwert zukommt als Menschen ohne Behinderung, äußert sich dies in noch diskriminierender Weise. Wie sehr die Verfolgung von Gewalttaten im Sand verläuft, zeigt auch ein Blick auf die absoluten Zahlen in der Studie von Zemp, Pircher und Neubauer 1996: Von den 74 Frauen, die von sexueller Gewalt betroffen sind, haben sich 54 jemanden anvertraut. Zu Maßnahmen führte dieser Schritt bei 22 Frauen: In zehn Fällen wurde mit dem Täter gesprochen, in vier Fällen erfolgten Anzeigen und Verurteilungen, in drei Fällen wurde das Verfahren eingestellt, in den wenig verbleibenden Fällen wurde der Täter versetzt oder bekam sonst ein Verbot. In einem Fall wurde der Person nicht geglaubt und so wurden auch keine Maßnahmen ergriffen.
Dass die Verfolgung besonders bei Menschen mit geistiger Behinderung im Sand verläuft und dass es zu keiner Verhandlung kommt bestätigt auch Hauptmann (Leiter des Institutes für Rechtspsychologie in Salzburg) in einem Interview (2002). Der entscheidende Grund dafür ist dass geistig behinderte Menschen nicht als zuverlässige bzw. glaubwürdige Zeugen zu gebrauchen sind, da sie sich häufig widersprechen. Dem gegenüber steht ein zuverlässiger, glaubwürdiger Angeklagter. Auf die Frage ob er einen Fall nennen könne der im Raum Salzburg stattgefunden hat und der auch zur Verhandlung kam sagte er nein, er könne sich an keinen erinnern. (!)
Als letzten Punkt ist noch anzumerken bzw. die Frage zu stellen ab wann man Menschen mit Behinderung als „widerstandsunfähig“ bezeichnet. Wer entscheidet das, wann und wo? Meist entscheiden Nicht-behinderte Menschen wie sich Menschen mit Behinderung verhalten sollen und können. Ist eine Frau zum Beispiel Sprachbehindert wird meist verlangt, dass sie dem Täter durch besonders heftigen körperlichen Widerstand gezeigt hat, dass sie nicht wollte. Kann sie nicht weglaufen, wird verlangt, dass sie auf den Täter besonders überzeugend einredet. Die Behinderung wird dem Täter und nicht dem Opfer zugute gehalten und die Lebenssituation von behinderten Menschen wird häufig völlig ignoriert.
PRÄVENTION
Begriffsdefinition:
Der Begriff „Prävention“ setzt sich aus den beiden lateinischen Bezeichnungen „prae“ (=vorher) und „venire“ (=kommen) zusammen und steht für „strategische Vorbeugung“ und „Zuvorkommen“ (Hermann, 1993).
Der Begriff „Prävention“ wird meist im Zusammenhang mit der psychosozialen Versorgung verwendet und hat das Ziel, psychisches Leid und Störungen von vornherein zu verhindern sowie Maßnahmen im Bereich der Seelsorge unnötig zu machen.
Durch präventive Maßnahmen wird die Hoffnung geweckt, dass die steigende Zahl an psychosozialen Problemen und die damit verbundene Inanspruchnahme von psychosozialen Diensten in Zukunft verringert werden können (Stein, 2001).
Caplans (1964) unterscheidet drei Typen der Prävention:
- primäre Prävention: Vorbeugende Maßnahmen (z. B. Aufklärungskampagnen, Kompetenztrainings) sollen das Auftreten neuer Störungen verringern.
- sekundäre Prävention: Dabei geht es um die möglichst frühzeitige Erkennung von Störungen und entsprechenden Interventionen.
- tertiäre Prävention: Langzeitfolgen von psychischen Störungen sollen durch entsprechende Rehabilitationsprogramme verhindert werden.
In Anlehnung daran kann man drei Formen von Prävention zum sexuellen Missbrauch unterscheiden:
- primäre Prävention:
Diese umfasst alle Maßnahmen, die das Auftreten von sexuellem Missbrauch verhindern können. Darunter fallen alle Versuche, die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse, die den sexuellen Missbrauch an Menschen mit Behinderung überhaupt ermöglichen, zu verändern (Born, 1994).
Die Primärprävention soll möglichst frühzeitig beginnen. Angesprochen werden dabei vor allem Menschen mit Behinderung als potentielle Betroffenen. Die Prävention erfolgt vorwiegend in Form von Programmen in Sonderschulen, Werkstätten und Wohnheimen. Dies kann mittels verschiedener Medien, wie Vorträge, Theaterstücke, Bücher und Spielen erfolgen. Das Ziel liegt darin, dass Menschen mit Behinderung sich selbst vor sexuellen Übergriffen schützen können (May, 1997).
- sekundäre Prävention:
Dabei geht es um die frühzeitige Aufdeckung bzw. Beendigung eines bereits bestehenden Missbrauchsverhältnisses. Sexuelle Übergriffe sollen durch adäquates Wissen als solche so bald als möglich erkannt werden, um negative Auswirkungen und Folgen gering zu halten. Jene Personen, die im Umfeld von Menschen mit Behinderung arbeiten und leben (Eltern, Lehrer, Erzieher, Betreuer usw.) sollen über Möglichkeiten der Diagnose und der Intervention informiert und geschult werden. Mittels Fortbildungen werden Betreuungspersonen für die Signale und Symptome bei betreffenden Menschen mit Behinderung sensibilisiert und lernen, diese zu erkennen und zu deuten, um rechtzeitig und effektiv intervenieren zu können (Amann & Wipplinger, 1998; May, 1997).
- tertiäre Prävention:
Diese Art von Prävention beinhaltet die therapeutische Begleitung und Behandlung von Menschen mit Behinderung, die Opfer eines sexuellen Missbrauchs geworden sind. Das Ziel ist es, die Langzeitfolgen eines sexuellen Missbrauchs zu reduzieren und die Betroffenen in deren Bewältigung zu unterstützen (Stein, 2001).
Die Übergänge zwischen primärer, sekundärer und tertiärer Prävention gestalten sich fließend. Somit ist es sehr schwer, zwischen den verschiedenen Präventionsformen klare Grenzen zu ziehen, da sie sich häufig überschneiden.
Zusammenfassend noch einmal die Ziele von präventiven Maßnahmen nach Amann & Wipplinger (1998):
- Verhinderung von neuen Fällen sexuellen Missbrauchs
- Aufdeckung eines erfolgten sexuellen Missbrauchs
- Trauma und Folgeerscheinungen des sexuellen Missbrauchs verringern
- Den Opfern bzw. den in den Missbrauch Involvierten den Weg in eine adäquate Behandlung erleichtern
Allgemeine Prinzipien der Prävention:
Im Zuge des Daphne Programms der Europäischen Union (2000) wurden folgende Prinzipien der Prävention herausgearbeitet:
- Dein Körper gehört dir! Er ist liebens- und schützenswert. Niemand darf ihn gegen deinen Willen berühren oder anfassen. Dieser Aspekt ist besonders dann brisant, wenn ein Mädchen oder eine Frau mit Behinderung auf Assistenz im körperpflegerischen Bereich angewiesen ist. Dieses Prinzip ernst zu nehmen, würde bedeuten, dass von Assistenz abhängige Menschen in jedem Fall die Entscheidungskompetenz dafür haben müssen, wer ihnen assistiert. Davon sind wir leider noch weit entfernt. Dieser Grundsatz bedeutet auch, Mädchen und Frauen darin zu unterstützen, ein positives Körpergefühl zu entwickeln. Nur so können sie für sich anerkennen, dass ihr Körper „so wie er ist“ liebens- und schützenswert ist.
- Nein-Sagen ist erlaubt! Wenn Angehörige oder MitarbeiterInnen in Institutionen Nein-Sagen fördern, bedeutet dies für sie, sich von dem für sie bequemen Ablauf des Alltags zu verabschieden. Es ist nicht machbar, im Bereich „Sexualität“ das Nein- Sagen zu erlauben und zu fördern, wenn ansonsten gefordert ist, sich im Alltag mit allen Vorgaben zu arrangieren - also ständig „Ja“ zu sagen.
- Vertraue deinem Gefühl! Hierbei muss berücksichtigt werden, dass Mädchen und Frauen mit Behinderung oft die Erfahrung gemacht haben, fremdbestimmt zu sein und ihrem Gefühl nicht folgen zu dürfen, wenn ihnen z. B. von ÄrztInnen gesagt wurde: „Das tut zwar jetzt weh, aber du wirst später begreifen, dass es nur zu deinem Besten ist.“
- Es ist wichtig, den Unterschied zwischen angenehmen und unangenehmen Berührungen zu thematisieren.
- Es ist nötig, zu thematisieren, dass es einen Unterschied zwischen guten und schlechten Geheimnissen gibt. „Geheimnisse, die schön sind, kannst du natürlich für dich behalten. Über Geheimnisse, die z. B. Bauchschmerzen machen, solltest du mit einer Person deiner Wahl sprechen.“
- Gesprächsbereitschaft soll signalisiert werden. „Mit mir kannst du über sexuelle Gewalt reden. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die davon betroffen sind. Für mich ist das Thema kein Tabu.“
- Die umfassende Aufklärung im Bereich „Sexualität“ ist eine notwendige Voraussetzung dafür, sexuellen Handlungen informiert und selbstbestimmt zu zustimmen - oder nicht gewollte erkennen und ablehnen zu können.
Bausteine einer Präventionsarbeit:
Die Präventionsarbeit im Bereich des sexuellen Missbrauchs umfasst nach May (1997) pädagogische Maßnahmen, mit dem Ziel, bei Kindern und Jugendlichen bzw. Menschen mit Behinderung eine aktive und zufriedenstellende Lebensgestaltung zu fördern. Vorrangig gilt es dabei, emanzipatorische, partnerschaftliche, gewaltfreie und demokratische Kommunikations- und Interaktionsformen anzustreben.
Vergleichbar mit einem Baukastensystem werden im Zuge dieser Präventionsarbeit mehrere gleichwertige Themen angeboten, die sich idealerweise miteinander verknüpfen.
Die Bausteine der Präventionsarbeit zum sexuellen Missbrauch:

Das Besondere bei diesen Bausteinen liegt darin, dass der Blick auf das Individuum, wie auch auf die Mitmenschen miteinbezogen wird. Durch die Prävention ermöglicht man einerseits die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, andererseits werden die anderen Individuen mit ihren Bedürfnissen und Gefühlen wahrgenommen, mit dem Bestreben, ihnen Respekt und Empathie entgegenzubringen.
Alle Themen, mit Ausnahme von „Informationen über sexuelle Gewalt“, sind losgelöst von der Problematik „Sexueller Missbrauch“ und können auch in Verbindung mit anderen Kontexten verwendet werden (Stein, 2001).
EMPOWERMENT
Empowerment - so nennt sich ein neuer, aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum importierter Wegweiser für die Praxis der Sozialen Arbeit und der psychosozialen Hilfe. Dieses neue Konzept entwickelte sich aus der Praxis von Selbsthilfeinitiativen, Projekten und Protestaktionen von unterschiedlichsten Adressaten (psycho-)sozialer Hilfen und Dienstleistungen (Arme, Arbeitslose, sozial Benachteiligte, alleinerziehende Mütter, psychisch Kranke, Behinderte) heraus. Selbstbemächtigung (Empowerment) war ihr Ziel, die Überwindung sozialer Ungerechtigkeiten, Benachteiligung und Ungleichheiten durch die (politische) Durchsetzung einer größtmöglichen Kontrolle und Verfügung über die eigenen Lebensumstände. Zugleich ist diese Entwicklung aber auch ein Versuch, neue, sozial tragfähige Beziehungen und Netze zu knüpfen, um psychische Krisen, Lebensprobleme oder kritische Lebensereignisse besser bewältigen zu können (Matztat, 1991; Olk, 1991).
Dieses offensive Empowerment-Programm hat im Bereich der Sozialen Arbeit und psychosozialen Hilfe zu einer tiefgreifenden Umbruchsituation und Neuorientierung geführt: Anstelle der bisherigen Praxis, die darauf ausgerichtet war, Menschen in marginaler Position einzig und allein als Empfänger von Fürsorge, Almosen oder psychosozialer Hilfe zu behandeln, ist ein Konzept getreten, das diese Einbahnstraße einer „Für“-Sorge-Mentalität abzuschaffen versucht. Empowerment ist somit das Markenzeichen für eine Neubestimmung des professionellen Handelns in sozialen Arbeitsfeldern, die ebenso revolutionär wie provokativ anmutet, weil sie die Expertenposition nicht mehr den helfenden Sozialberufen, sondern ihren Adressaten zuspricht (Plaute & Theunissen, 1995).
Empowerment steht für einen Prozess, in dem Betroffenen ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen, sich dabei ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst werden, eigene Kräfte entwickeln und soziale Ressourcen nutzen (Rappaport, 1985, 1987; Stark, 1989). Leitperspektive ist die selbstbestimmte Bewältigung und Gestaltung des eigenen Lebens (Plaute & Theunissen, 1995).
Im Bereich der Behinderung findet der Begriff Empowerment besondere Anwendung und ist heute aus der modernen Behindertenarbeit nicht mehr wegzudenken. Durch gesellschaftliche Mechanismen von Diskriminierung und Ausschluss haben Menschen mit Behinderung in ihrem Leben Prozesse von Empowerment erfahren. Die Orte des sozialen Lebens nicht barrierefrei erleben zu können, auf vielen Gebieten unterschiedlich behandelt zu werden, wie zum Beispiel in der Erziehung und bei der Arbeit, ein von den verschiedensten Faktoren (familiär, sozial, verhaltensbedingt usw.) begrenztes und eingeschränktes Leben zu leben, lässt persönliche Ressourcen und Fähigkeiten auf allen Gebieten des sozialen Lebens und im Beziehungsleben verarmen.
Seit einigen Jahren wird weltweit durch die Behindertenbewegung verstärkt versucht, behinderte Personen durch Empowerment zu stärken und ihre Menschenrechte zu schützen. Damit soll den Schäden entgegengetreten werden, die durch gesellschaftliche Bedingungen und eingeschränkte Möglichkeiten verursacht wurden. Es sollen potenzielle Fertigkeiten und persönliche Ausdrucksfähigkeiten gefördert werden, um der Diskriminierung entgegenzutreten und ein selbständiges, selbstbestimmtes Leben führen zu können. Wenn der Mensch mit Behinderung in seinen Fähigkeiten und Ausdrucksfähigkeiten gestärkt wird, wird er/sie die Respektierung seiner/ihrer Rechte und die Aufnahme in die Gesellschaft leichter erlangen.
Die wesentlichen Instrumente von Empowerment sind Ausbildung und Information. Die Stärkung von Fertigkeiten und Ausdrucksfähigkeit, die Änderung der Perspektive und der Wahrnehmung des eigenen Zustands sind Ansporn und Motivation zur Veränderung des Lebens (Daphne-Programm, 2000).
Hier nochmals eine kurze, exemplarische Zusammenfassung des Empowerment-Konzepts in der Behindertenarbeit (Plaute & Theunissen, 1995):

Relevanz des Empowerment-Konzepts bei der Prävention zum sexuellen Missbrauch:
Gerade bei der Prävention zum sexuellen Missbrauch von Menschen mit Behinderung spielt der Empowerment-Ansatz eine besonders große Rolle.
Eine der wichtigsten Voraussetzungen, damit sexueller Missbrauch überhaupt erst stattfinden kann, ist das Machtgefälle zwischen zwei Personen und der Missbrauch eines daraus entstehenden Autoritätsverhältnisses. In unserer Gesellschaft werden Menschen mit Behinderung gerne als schwache, unmündige, passive und hilfsbedürftige Wesen gesehen.
Während Kinder dieser betreuungsbedürftigen Stufe mit der Zeit entwachsen, bleiben viele Menschen mit Behinderung ihr Leben lang auf dieser Ebene. Sie rangieren damit in der bedauernswertesten und hilfsbedürftigsten Position unserer Gesellschaft. Diese Sichtweise führt dazu, dass Menschen mit Behinderung als schwächste, machtloseste auch die gefährdetste Gruppe ist, was den sexuellen Missbrauch angeht.
Durch die Empowerment-Bewegung sollen eben diese Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Menschen mit und ohne Behinderung minimiert werden. Menschen mit Behinderung sollen als selbstbewusste, selbständige, aktive und vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft wahrgenommen werden. Als oberstes präventives Ziel gilt es laut diesem Ansatz also, Machtgefälle und Autoritätsverhältnisse, die man missbrauchen könnte, gar nicht erst entstehen zu lassen.
PRÄVENTIONSPROGRAMME
PEER COUNSELING
Peer Counseling ist eine Methode, die es behinderten Personen ermöglicht, das eigene Bewusstsein bezüglich ihrer wirklichen Ressourcen und Fähigkeiten zu steigern und ihre Grenzen wahrzunehmen. Wie bei anderen Beratungsmethoden wird eine zwischenmenschliche Beziehung aufgebaut, in der die eine behinderte Person (Peer Counselor) einer anderen behinderten Person (Ratsuchende) zu helfen versucht, ihre Probleme zu verstehen, und zu einer ihr angemessenen Lösung zu gelangen.
Peer Counseling ist eine unterstützende Beziehung zwischen zwei Menschen, die „gleich“ sind. Mit „gleich“ sind Menschen gemeint, die in der gleichen Situationen sind, die das gleiche Alter und die gleiche Kultur haben oder eine gleiche Lebenserfahrung teilen. In unserem Fall sind die Menschen „gleich“, weil sie die Behinderung gemeinsam haben. Dennoch sind sie etwas unterschiedlich, da der Berater/die Beraterin in seinem/ihrem Bewusstseinsprozess im Vergleich zum/zur Ratsuchenden voraus ist. Dies erlaubt ihm/ihr, das eigene Leben in seinen Grenzen zu leben und seine Möglichkeiten auszuschöpfen. Er/Sie nimmt die Funktion eines „Rollenmodells“ gegenüber dem/der Ratsuchenden ein, indem er/sie eine Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten anregt (Empowerment). Das ist ein Prozess, bei dem er/sie angeregt wird, stärker zu werden, das eigenen Leben besser in den Griff zu bekommen und sich besser durchsetzen zu können. Die Tatsache, dass es eine Gleichberechtigung, Gleichheit, in der Hilfe-Beziehung gibt, erlaubt es dem/der Ratsuchenden, sich im Berater/der Beraterin zu spiegeln. Dies fördert den Prozess, der zum Erwerb des Bewusstseins seiner/ihrer selbst gehört. Innere (psychische und emotionale) Fähigkeiten und solche der Fantasie und der Vernunft und äußeren Instrumente (menschliche Hilfe, Gesetze, Hilfstechnologien etc.) können genutzt werden, um ein selbstbestimmtes Leben zu leben und die eigene Selbstbestimmung auszuüben.
Das Peer Counseling kann, da es auf die individuelle Person ausgerichtet ist, Auswirkungen im persönlichen Bereich haben, es ist aber auch eng an die gesellschaftliche Dimension der Verwirklichung der Menschen- und Zivilrechte gebunden. Es ist notwendig, dass sich behinderte Männer und Frauen als Wesen mit einer eigenen Würde wahrnehmen, damit sie die Kraft haben, ihre eigenen Rechte zu vertreten oder erlittene Gewalt anzuzeigen. Diese Anerkennung der eigenen Würde fördert auch, dass andere Menschen mit Behinderung ernst nehmen (Daphne-Programm, 2000).
Ein Beispiel für Peer Counseling:
In Köln existiert seit Oktober 1993 das Modellprojekt „Peer Support für behinderte Frauen“ im Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Es bietet Unterstützung von behinderten Frauen durch behinderte Frauen, wobei sexuelle Gewalt nicht isoliert, sondern als Teil der gesamten Lebenssituation der Frauen gesehen wird. Diese ist geprägt von „Aussonderung, Herabwürdigung und Vorenthaltung von Lebenschancen“ (Schneider, 1994). Die doppelte Diskriminierung betrifft mehrere Bereiche: weibliche Identität; individuelle Lebensgestaltung; Ausbildung; Pflege; Sexualität. Ziel des Projektes ist es, Frauen dazu zu befähigen, selbst etwas zur Veränderung ihrer Situation beizutragen. Die Arbeit bezieht sich sowohl auf äußere Bedingungen (Wohnsituation; Mobilität; Hilfsmittel; persönliche Assistenz/Pflege; Berufswelt) als auch auf psychosoziale Faktoren (Identitätsfindung; Lebenskonzept; Selbstbewusstsein; Körperbewusstsein; Prävention gegen sexuelle Gewalt/Nein-Sagen). Die Angebote umfassen individuelle und Gruppenberatung in der Betroffenheit und Professionalität kombiniert werden. Inhaltlich geht es um Trainingskurse zur persönlichen Assistenz sowie Selbstverteidigungskurse, aber auch um Themen wie Schwangerschaft, neuer Eugenik etc. (Schneider, 1994). Wichtig ist in dieser Arbeit die Betonung von geschlechtshomogener Zusammensetzung der jeweiligen Gruppen, um das Selbstbewusstsein der Frauen zu stabilisieren bzw. zu stärken.
SELBSTVERTEIDIGUNG „WenDo“ - WEG DER FRAUEN
WenDo ist ein von Frauen für Frauen und Mädchen entwickeltes Konzept zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung und ist eine feministische Antwort auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen.
Wen kürzt das englische Wort „women“ ab. Do kommt aus dem Japanischen und wird mit „Weg“ übersetzt. WenDo heißt also: „Weg der Frauen“ - oder sinngemäß: „Frauen in BeWEGung“.
WenDo entstand 1972 in Kanada und wurde seither kontinuierlich weiterentwickelt. Es setzt sich aus den einfachsten und effektivsten Techniken traditioneller Kampfkünste und den psychologischen Aspekten und Strategien der Selbstbehauptung zusammen. WenDo thematisiert geschlechtsspezifische Konfliktsituationen von der alltäglichen Belästigung bis zur versuchten Vergewaltigung. WenDo wird von Frauen an Frauen und Mädchen weitervermittelt.
Die drei Schwerpunkte des WenDo sind:
- Körperliche Selbstverteidigung
- Erlernen verschiedener Befreiungs- und Gegenangriffstechniken zur Verteidigung in konkreten Angriffssituationen
- Erkennen der eigenen Kraft durch Schläge und Tritte in Polster
- Spielen mit der eigenen Stärke und dem Reaktionsvermögen
- Verbale Selbstbehauptung
- Trainieren von selbstbewusstem Auftreten in alltäglichen Belästigungssituationen
- In Rollenspielen klar und eindeutig Stellung beziehen, Raum einnehmen, Grenzen setzen, verschiedene Verhaltensmöglichkeiten erproben
- Erarbeiten von persönlichen Präventionsstrategien
- Prävention
- Informieren über die Hintergründe sexualisierter Gewalt, sich mit der Opfer-Täter- Dynamik auseinandersetzen
- Gesellschaftliche Rollenerwartungen und ihre Auswirkungen auf das Selbstbild von Frauen thematisieren
- Das Selbstbewusstsein stärken und die Wahrnehmung schärfen
Bei Menschen mit Behinderung wird Selbstverteidigung als nebensächlich oder nicht von Nöten angesehen, da sich solche Menschen aufgrund ihrer Behinderung und ihrer darausfolgenden Schwäche ohnehin nicht wehren können. Gerade das Konzept des WenDo setzte jedoch an vielen verschiedenen Gesichtspunkten an, die es ermöglichen etwaige Schwächen auf einem anderen Gebiet auszugleichen. Ein taubes Mädchen kann z. B. diverse verbale Schwächen mit geschulter Wahrnehmung und körperlicher Gegenwehr ausgleichen. Genauso wie ein Körperbehindertes Mädchen statt körperlicher Gegenwehr durch präventive Maßnahmen oder durch verbale Selbstbehauptung vor Übergriffen bewahrt werden kann.
Mehr Infos zu WenDo unter: http://www.wendo.de oder http://www.wendo.ch
„NINLIL“ - Verein wider die sexuelle Gewalt gegen Frauen, die als geistig oder mehrfach behindert klassifiziert werden
Ninlil entstand aus einer Arbeitsgruppe, die sich 1992 nach einem Symposium mit der Thematik „Gegen sexuelle Gewalt/Belästigung an Frauen mit Behinderung oder in der Nacht kommt der Mann ohne Gesicht wieder“ mit Frauen aus dem Beratungs- und Betreuungsbereich bildete.
Wesentliches Ziel war die Auseinandersetzung mit der Thematik und die Veröffentlichung der Tatsache, dass Frauen, die als geistig oder mehrfach behindert klassifiziert werden, in vielfältiger Weise ebenso wie nichtbehinderte Frauen sexuelle Ausbeutung erfahren und überleben müssen. 1996 wurde aus der Arbeitsgruppe ein Verein. Seit August 2000 arbeiten 3 Mitarbeiterinnen bei Ninlil, und können u. a. (noch) den Basisbetrieb gewährleisten.
Den Namen Ninlil haben die Vereinsfrauen dem Buch von Florence Rush „Das bestgehütete Geheimnis: Sexueller Kindesmissbrauch“ (1985) entnommen, welche einen Text einer sumerischen Tontafel zitiert, in dem beschrieben wird, wie sich die junge Göttin Ninlil gegen einen sexuellen Übergriff gegen den Gott Enlil wehrt.
Frauen, die als geistig oder mehrfach behindert klassifiziert werden, erfahren die gesellschaftliche Benachteiligung und Diskriminierung in doppelter Weise, aufgrund ihres Frau-Seins und durch die ihnen zugeschriebene Diagnose der geistigen Behinderung.
Der Ansatzpunkt von Ninlil ist es, gemeinsam mit anderen Frauen weibliche Entfremdungserlebnisse, und -Erfahrungen gesellschaftspolitisch und individuell in ihrem dialektischen Zusammenspiel zu verdeutlichen sowie Änderungsmöglichkeiten zu erproben. Ninlil fordert das Recht für Frauen, die als geistig oder mehrfach behindert klassifiziert werden, selbst bestimmen zu können, wie sie leben möchten und dass sie ihre Entscheidungen selbst treffen können. Als Aktivitäten und Angebote gibt es aktuell Empowermentseminare für Frauen, die als geistig oder mehrfach behindert klassifiziert werden. Weiters werden persönliche und telefonische Einzelberatungen für Frauen, die als geistig oder mehrfach behindert klassifiziert werden, angeboten. Themenspezifische Teamberatungen und Seminare gibt es für BetreuerInnen und MitarbeiterInnen, die Frauen, die als geistig oder mehrfach behindert klassifiziert werden, begleiten, assistieren etc. Es finden laufend „women-first“- Gruppen (Selbstbestimmt-Leben-Gruppen) statt für Frauen, die als geistig oder mehrfach behindert klassifiziert werden. Ninlil stellt dafür die materiellen und organisatorischen Mittel zur Verfügung.
Ein „PsychotherapeutInnenverzeichnis für Frauen, die als geistig oder mehrfach behindert klassifiziert werden“ gibt es bereits als Broschüre. Ein „GynäkologInnenverzeichnis“ mit behindertengerechten Praxen und ein Kriterienverzeichnis für Forderungen an die gynäkologischen Versorgung von Frauen, die als geistig oder mehrfach behindert klassifiziert werden, sind in Planung. Zudem werden Verhandlungen geführt zur Verbesserung der räumlichen Zugänglichkeit des Ninlil-Büros in der Frauenhetz, damit es auch Rollstuhlfahrerinnen ohne Hindernisse erreichen können.
Nähere Infos: Ninlil -Verein wider die sexuelle Gewalt gegen Frauen, die als geistig
oder mehrfach behindert klassifiziert werdenHetzgasse 42/1, 1030 Wien
Tel.: 01-714 39 39 Fax: 01-715 98 88-20
E-Mail: ninlil@utanet.at
Homepage: http://www.ninlil.at
FRAUENHÄUSER FÜR BEHINDERTE FRAUEN
Frauenhäuser, in denen ausschließlich behinderte Frauen aufgenommen werden existieren weder in Österreich noch in Deutschland. Wenn behinderte Frauen in dieser verzweifelten Situation sind, können sie sich an die Frauenhäuser wenden, die auch nicht-behinderte vergewaltigte Frauen aufnehmen.
Leider gibt es nur wenige Frauenhäuser, die behinderte Frauen aufnehmen können, weil sie wegen der architektonischen, kulturellen und gesellschaftlichen Barrieren in der Mehrzahl der Fälle unzugänglich sind (Daphne-Programm, 2000).
SPECIAL LOVE TALKS - ein präventives Modell der Sexualerziehung für den Lebensbereich von Menschen mit Behinderung
Kurzdarstellung des Modells:
Das vom Österreichischen Institut für Familienforschung angebotene Modell „LoveTalks“ schafft für Eltern, Kinder und LehrerInnen im Schulbereich gezielt die Möglichkeit, auf dem sensiblen Gebiet der Sexualerziehung miteinander ins Gespräch zu kommen. „LoveTalks“ entstand 1985 als ein Forschungsprojekt, das die aktuelle Situation der schulischen und familiären Sexualerziehung durchleuchten wollte. Dabei wird von einem bedürfnisorientierten Ansatz ausgegangen.
Gerade in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen zeigen sich eine Reihe von Problemen im Zusammenhang mit dem Themenbereich "Sexualität".
Auf der einen Seite sind wir mit ähnlichen Bedürfnissen konfrontiert wie sonst auch; auf der anderen Seite ist die Kommunikation zusätzlich erschwert. Für die Adaption des Modells „Special LoveTalks“ war es der Lebenshilfe Salzburg ein besonderes Anliegen, Menschen mit geistiger Behinderung in den gesamten Prozess mit einzubeziehen.
Das Modell umfasst daher folgende Schritte:

- Phase A: Das Modell wird allen beteiligten Personen in getrennten Besprechungen vorgestellt; dabei sind neben den Informationen an die potenziellen TeilnehmerInnen bereits folgende Inhalte von Bedeutung:
- die ModeratorIn lernt die Personen persönlich kennen, findet einen Zugang zur persönlichen Situation und erkennt die individuelle Kommunikationsebene
- die ModeratorIn erhält einen Überblick über den Wissenstand und die individuellen Bedürfnisse
- für den Menschen mit Behinderung ergibt sich in dieser Phase bereits eine erste Sensibilisierung für das Thema
- Phase B: aufgrund der besonderen Voraussetzungen in der Kommunikation mit geistig behinderten Menschen wird diese Phase in einen „gruppenspezifischen“ und einen gemeinsamen Abschnitt unterteilt:
- Phase B1: es sind sechs Arbeitskreistreffen (jeweils ca. drei Stunden) vorgesehen; Eltern und BetreuerInnen bzw. behinderte Menschen haben in je drei Arbeitskreistreffen die Möglichkeit, getrennt über selbstgewählte Themen der Sexualität zu sprechen. Die beide Gruppen werden getrennt moderiert, wobei jeweils zwei ModeratorInnen eingesetzt werden. Unsere bisherige Erfahrung zeigt uns, dass diese Vorgangsweise aufgrund der besonderen Bedürfnisse von Menschen mit einer geistigen Behinderung notwendig ist.
- Phase B2: In zwei weiteren Arbeitskreistreffen kommen dann die beiden Gruppen miteinander ins Gespräch; dabei werden die Ergebnisse der ersten drei Arbeitskreistreffen ausgetauscht und gemeinsame Übungen durchgeführt. Zusätzlich erarbeiten und planen Eltern, BetreuerInnen und Menschen mit Behinderung auch eine konkrete Weiterführung für die Praxis, die im Anschluss an die Arbeitskreis-Treffen allen Menschen mit Behinderung der Institution angeboten wird.
- Phase C: die geplante Umsetzung und Anwendung der Gespräche wird nun in der Praxis von MitarbeiterInnen, Menschen mit Behinderungen und Eltern durchgeführt; diese Phase findet ohne unmittelbare Beteiligung der ModeratorInnen statt.
Die Moderatoren:
Die Moderatoren kommen aus den verschiedensten psychosozialen und medizinischen Bereichen, in denen sie auch beruflich tätig sind. Sie weisen eine große Bandbreite an praktischer und theoretische Erfahrung auf, die sie in das Projekt „Special LoveTalks“ einfließen lassen. Die Moderatoren treten nicht als allwissende Experten auf, sondern können neben ihrem fundierten Know-how spezifische Schwerpunkte aufweisen. Bevor die Moderatoren ein Special LoveTalks-Projekt durchführen können, müssen sie eine speziell vom Österreichischen Institut für Familienforschung entwickelte Ausbildung absolvieren. Ein zusätzliches Training im Bereich der Sexualpädagogik ist erforderlich. Inhalte dieser Ausbildung sind das Fachwissen zum Thema Sexualität und Sexualpädagogik, Einführung in entsprechende Methoden und die Möglichkeit zur themenzentrierten Selbsterfahrung. Eingeschlossen ist ein Praxisteil, der sich mit der Moderation eines Arbeitskreistreffens beschäftigt (Stein, 2001).
Ziele des Modells:
Allgemeine Ziele:
- Die Kommunikation zwischen BetreuerInnen und Eltern untereinander sowie innerhalb der Gruppe der Menschen mit geistiger Behinderung und innerhalb der Eltern- bzw. BetreuerInnengruppe selbst zu fördern.
- Das Sprechen über und den Umgang mit Sexualität erlernen.
- Prävention gegen psychische und physische Gewalt, unter besonderer Beachtung der sexuellen Gewalt.
- Bedürfnisorientiert sexualpädagogische näher bringen.
- Neue Wege und Möglichkeiten einer Sexualerziehung für Menschen mit geistiger Behinderung aufzuzeigen.
- Eltern und BetreuerInnen bei der Sexualerziehung zu unterstützen.
- Eigene Ressourcen der beteiligten ArbeitskreisteilnehmerInnen nützen.
- Wege für die gemeinsame Bewältigung von Konflikten aufzeigen.
Ziele für die Projekte:
- Den eigenen Körper kennen lernen (Benennung von Körperteilen sowie Körperwahrnehmung)
- Intimhygiene
- Sprache der Sexualität finden (über Sexualität reden lernen)
- Die persönliche Verantwortung im Zusammenhang mit Sexualität vermitteln
- Beziehungsfähigkeit (vom Ich zum Du)
- Freundschaft - Liebe - Partnerschaft
- Einen realistischen Zugang zu den Themen „Kindeswunsch - Schwangerschaft - Verhütung“ fördern
- Konfliktbewältigungsstrategien erlernen
- Prävention in Bezug auf Gewalt
- Gefahren einschätzen lernen
Anmeldung und Kosten für „Special LoveTalks“:
- Special LoveTalks kann grundsätzlich von Institutionen, die mit Menschen mit Behinderungen arbeiten, angefordert werden!
- Die Anmeldung erfolgt direkt über die Lebenshilfe Salzburg, Dr. W. Plaute, Nonntaler Hauptstraße 55, 5020 Salzburg.
- Die Kosten für die beiden ModeratorInnen (Honorar, Nächtigung, Fahrt ...) sind von der jeweiligen Institution zu tragen. Für die Honorare werden derzeit ca. 35.000.- ÖS (exkl. Mwst.) für das gesamte Modell kalkuliert, zusätzlich fallen 5000.- ÖS Entwicklungs- und Aufwandsgebühren und 500.- ÖS Bearbeitungsgebühr für Horizonte an! Unter der Annahme von durchschnittlich 30 Personen, die an diesem Prozess teilnehmen, ergeben sich Kosten von weniger als 1500.- ÖS pro TeilnehmerIn.
Persönliche Erfahrungen mit Special Love Talks:
Im April 2002 habe ich als Angehörige eines Menschen mit Behinderung persönlich an einem Special LoveTalks-Projekt teilgenommen. Die fünf Arbeitskreistreffen zu je drei Stunden fanden in der Werkstätte Steindorf der Lebenshilfe Salzburg statt.
Ich war nur bei den Arbeitskreistreffen anwesend, die für die Betreuer und Eltern bzw. Angehörige der Menschen mit Behinderung vorgesehen waren. Bei den Treffen, die mit den Menschen mit Behinderung alleine mit den Moderatoren durchgeführt wurden, war ich nicht dabei.
Die Atmosphäre bei den Arbeitskreistreffen mit Betreuern und Eltern bzw. Angehörige der Menschen mit Behinderung war sehr entspannt bis äußerst humorvoll, sodass auch eher heikle Themen offen angesprochen und diskutiert werden konnten. Zu keinem Zeitpunkt der Treffen konnte man Hemmungen oder gar Scham über die besprochenen Themen beobachten. Im Gegenteil, die Informationen der Moderatoren und vor allem der Austausch mit anderen „Betroffenen“ wurde dankbar angenommen.
Folgende Themen wurden beispielsweise angesprochen:
- Wie handeln, wenn man einen Menschen mit Behinderung beim Masturbieren „erwischt“?
- Ist gelebte Sexualität bei Menschen mit Behinderung zulässig, möglich, zu unterstützen?
- Aufklärung bei Menschen mit Behinderung
- Hygiene bei Menschen mit Behinderung
- Menstruation bei Mädchen und Frauen mit Behinderung
- Welche Beziehungsformen sind für Menschen mit Behinderung zulässig, möglich, zu unterstützen?
- Psychosexuelle Entwicklung - Welche Bedürfnisse haben Menschen mit Behinderung überhaupt?
- Welche Verhütungsmittel sind für Menschen mit Behinderung geeignet?
Die letzten beiden Arbeitskreistreffen fanden gemeinsam mit den Menschen mit Behinderung statt. In Kleingruppen, die jeweils aus Menschen mit Behinderung und Betreuern und Eltern bzw. Angehörigen bestanden, wurden Übungen zur Körperteilebenennung und zur Hygiene gemacht. Beim letzten Treffen wurden wiederum in Kleingruppen verschiedene Projekte geplant, die nach den Arbeitskreistreffen die angesprochenen Themen von Special LoveTalks weiter behandeln sollen. Im Zuge dieser Veranstaltung wurden vier weiterführende Projekte geplant:
- Projekt „Grillfest“: Die Menschen mit Behinderung wünschen sich ein geselliges Grillfest, um zu feiern und Leute kennen zu lernen.
- Projekt „Stammtisch“: Die Eltern und Angehörigen planen einen Stammtisch, der vierteljährlich stattfinden soll, um sich weiterhin in geselligem Rahmen austauschen zu können.
- Projekt „Körperwahrnehmung“: Im Zuge einer sommerlichen Projektwoche in der Werkstätte Steindorf wird ein Workshop zum Thema „Körperwahrnehmung“ realisiert.
- Projekt „Aufklärung“: Mit Hilfe des Videos „Wo komm’ ich eigentlich her?“ und anderen Medien werden die Betreuer mit den Menschen mit Behinderung über einige Wochen hinweg die Themen „Zeugung“, „Schwangerschaft“ und „Geburt“ bearbeiten.
Alle Beteiligten arbeiteten sehr intensiv an der Planung dieser Projekte und stellten im Plenum ihr jeweiliges Projekt vor. Alle sind nun gespannt und freuen sich auf deren Verwirklichungen.
Resümierend kann ich nur hervorheben, dass alle Beteiligten von diesem Projekt sehr begeistert waren. Die Menschen mit Behinderung waren nach ihren Treffen immer sehr aufgekratzt und hatten sichtlich viel Spaß. Die Betreuer und Eltern bzw. Angehörige der Menschen mit Behinderung waren froh sich über teilweise heikle Themen mit anderen „Betroffenen“ austauschen zu können und von den Moderatoren gezielt Informationen zu bekommen. Sowohl die Betreuer als auch die Eltern bzw. Angehörigen betonten, es sei sehr angenehm, sich bei dieser Gelegenheit näher kennen zu lernen und Erfahrungen auszutauschen. Alle Teilnehmer merkten jedoch auch an, dass die Themen in dieser relativ kurzen Zeit nur angesprochen werden konnten. Die Umsetzung und Realisierung im Alltag vieler der andiskutierten Konzepte könne jedoch nur in kleineren Schritten und mit viel Engagement erfolgen.
Interessante Links:
- Daphne-Programm:
- Peer Support:
- WenDo:
- Ninlil:
- LoveTalks:
- Sonstiges:
LITERATURVERZEICHNIS
- Amann, G. & Wipplinger, R. (Hrsg.) (1998). Sexueller Missbrauch. Überblick zu Forschung, Beratung und Therapie. (2. Auflage) Tübingen: dgvt-Verlag.
- Becker, M. (1995). Sexuelle Gewalt gegen Mädchen mit geistiger Behinderung. Daten und Hintergründe. Heidelberg.
- Breucker, U. & Tödte, M. (1988). Sexueller Missbrauch von Mädchen in Zusammenhang mit späterer Drogenabhängigkeit. Unveröffentlichtes Manuskript. (3. überarbeitete Auflage). Essen.
- Brill, W. (1998). Sexuelle Gewalt gegen behinderte Menschen - ein Überblick über den aktuellen Stand der Diskussion. Behindertenpädagogik, 37/2, 155-172.
- Caplans, G. (1964). Principles of preventive psychiatry. New York: Basic books. Born, M. (1994). Sexueller Missbrauch - ein Thema für die Schule? Präventions- und Interventionsmöglichkeiten aus schulischer Perspektive. Pfaffenweiler: Centaurus-Verlags- Gesellschaft.
- Corbin, A. (1997). Die sexuelle Gewalt in der Geschichte. Frankfurt/M.
- Das Daphne-Programm (2000). Quelle: http://www.dpi.it/donne/kit0vd.htm (2002-05-14)
- Degener, T. (1994). Die sexuelle Gewalt gegen behinderte Frauen. Rechtliche Aspekte. In: Weinwurm-Krause (Hrsg.), 15-24.
- Finkelhor, D. (1985). American Journal of Orthopsychiatry.
- Fischer, E. (1992). Sexueller „Missbrauch“/sexuelle Gewalt - (k)ein Thema für Schule und Familie?. Unsere Jugend 12, 507-510.
- Furey, E.M. (1994): Sexual Abuse of Adults with Mental Retardation: Who and Where. Mental Retardation, 32/6, 173-180.
- Hartwig, L. (1990). Sexuelle Gewalterfahrungen von Mädchen im Heim. Konfliktlagen und Konzepte mädchenorientierter Heimerziehung. Weinheim.
- Hermann, U. (1993). Herkunftswörterbuch. München: Orbius-Verlag.
- Knapp, G. (1993). Sexueller Missbrauch an Mädchen und frühkindlicher Autismus. In: Voss u. Hallstein, 46-58.
- Laustroer, E. (1996). Was hat sexueller Missbrauch mit Sucht zu tun? Erfahrungen mit dem frauenspezifischen Angebot im Sucht-Kontaktzentrum. In: Gassmann u. Klemm, 61f.
- Lebenshilfe Österreich (1997). Grundposition zur „Sterilisation“.
- Leyendecker, C. (1979). Stichworte zum Thema „ Behinderte und Helfer: Möglichkeiten und Probleme der Interaktion “ . In: Specht, F. & Weber, M. (Hrsg.): Kinder in unserer Gesellschaft. Göttingen.
- May, A. (1997). Nein ist nicht genug. Prävention und Prophylaxe. Inhalte, Methoden und Materialien zum Fachgebiet sexuellen Missbrauch. Ruhnmark: Donna Vita-Verlag.
- Matztat, J. (1991). Spezialistentum und Kooperation. Selbsthilfegruppen-Unterschätzung als Element eines umfassenden regionalen Versorgungssystems. Balke/Thiel, 188-201.
- Offe, H. u.a. (1992). Zum Umgang mit dem Verdacht des sexuellen Kindesmissbrauchs. Neue Praxis 3, 240-257.
- Olk, Th. (1991). In produktiver Bewegung halten. Über die gesellschaftlichen, politischen und strukturellen Bedingungen der Unterschätzung von Selbsthilfegruppen. Balke/Thiel, 201-219.
- Rappaport, J. (1985). Ein Plädoyer für die Widersprüchlichkeit: Ein sozialpolitisches Konzept des „empowerment“ anstelle präventiver Ansätze. Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 2, 257-278.
- Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: toward a theory for community psychology. American Journal of Community Psychology, 15, 121-129.
- Rush, F. (1980). The best kept secret: Sexual abuse of children. Prentice Hall Direct.
- Schneider, Ch. (1994). Das Modellprojekt “Peer Support für behinderte Frauen” des Zentrums für selbstbestimmtes Leben, Köln. In: Weinwurm-Krause, E. (Hrsg.). Sexuelle Gewalt und Behinderung. Hamburg: Kovac.
- Sgroi, S. (Ed.). (1982). Handbook of clinical intervention in child sexual abuse. Lexington: Lexington.
- Sinason, V. (1992). hekt. Arbeitspapier über „Sexueller Missbrauch bei geistig behinderten Menschen“, Tavistock Centre and Clinic, 120 Belsize Lane, London.
- Stark, W. (1989). Empowerment, health promotion, and the competence for social conflict and change. In: Salmon, W. J. &, Göpel, E. (Eds.). Community participation and empowerment strategies in health promotion, 34ff. Bielefeld.
- Stein, M. (2001). „LoveTalks“: Ein präventives Modell der Sexualerziehung für Kinder und Jugendliche im schulischen Bereich. Diplomarbeit.
- Stoppa, V. (1992). Wie weiter? Über die Ratlosigkeit der Fachleute zum Thema der sexuellen Gewalt an behinderten Kindern und Jugendlichen. Pro infirmis, 2, 16-18.
- Strasser-Hui, U. (1992). Das gestohlene Ich. Sexuelle Übergriffe bei Menschen mit geistiger Behinderung. Pro infirmis, 2, 3-9.
- Theunissen, G. & Plaute, W. (1995). Empowerment und Heilpädagogik. Ein Lehrbuch. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Weinwurm-Krause, E. (Hrsg.). (1994). Sexuelle Gewalt und Behinderung. Tagung vom 18.02.1994. Heilpädagogische Fakultät der Universität zu Köln.. Hamburg: Kovac.
- Wittrock, M. (1992). Sexueller Missbrauch an Kindern. Sonderpädagogik 22/3, 164-170.
- Zemp, A. (1991a). Sexuelle Ausbeutung ist sexualisierte Macht und Gewalt. Puls, 1, 8-11.
- Zemp, A. (1991b). Die Zweige des Baumes wachsen nur so weit in die Höhe, wie ihre Wurzeln an Tiefe gewinnen. Von möglichen Heilungsprozessen. Puls, 2, 39-44.
- Zemp, A., Pircher, E. & Neubauer, C. (1996). Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen mit Behinderung. Eine explorative Studie. Im Auftrag der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten. Unveröffentlichter Projektbericht. Salzburg: Institut für Alltagskultur.
- Zemp, A. & Pircher, E. & Schoibl, H. (1997). Sexualisierte Gewalt im behinderten Alltag - Jungen und Männer mit Behinderung als Opfer und Täter. Salzburg.
1 Der Text wurde vermutlich von der Verfasserin sprachlich überarbeitet
2 Internationales Symposium, Wien 9.-11.11.1992: Gegen sexuelle Belästigung/Gewalt an Frauen mit Behinderung oder in der Nacht kommt der Mann ohne Gesicht wieder. Veranstalterin: Bundesministerium für Frauenangelegenheiten.
Häufig gestellte Fragen
- Was ist das Thema dieses Dokuments?
- Dieses Dokument behandelt sexuelle Gewalt gegen Menschen mit Behinderung. Es untersucht Definitionen, Epidemiologie, die Situation behinderter Menschen, das Erleben und die Folgen sexueller Gewalt, Interventionsmöglichkeiten, Therapieansätze, rechtliche Aspekte sowie Präventionsmaßnahmen und Empowerment.
- Wie definiert das Dokument sexuelle Ausbeutung von Menschen mit Behinderung?
- Das Dokument zitiert Sgroi (1982), der sexuelle Ausbeutung von Kindern und/oder physisch und/oder geistig abhängigen Menschen durch Erwachsene (oder ältere Jugendliche) als eine sexuelle Handlung des Erwachsenen mit einem abhängigen Menschen definiert, der aufgrund seiner emotionalen, intellektuellen oder physischen Entwicklung nicht in der Lage ist, dieser sexuellen Handlung informiert und frei zuzustimmen. Dabei nützt der Erwachsene die ungleichen Machtverhältnisse zwischen sich und der/dem Abhängigen aus, um sie/ihn zur Kooperation zu überreden oder zu zwingen. Zentral ist dabei die Verpflichtung zur Geheimhaltung.
- Welche epidemiologischen Daten werden im Dokument genannt?
- In einer österreichischen Studie aus dem Jahr 1996 gaben 62% der befragten Frauen mit Behinderung an, sexuell belästigt worden zu sein, und 64% gaben an, sexuelle Gewalt erlebt zu haben. In einer weiteren Studie von Zemp, Pircher & Schoibl (1997) wurden 136 Männer mit Behinderung befragt. Die Hälfte der Männer gab an, sexuelle Belästigung und/oder sexuelle Gewalt erlebt zu haben.
- Welche Faktoren tragen zur Gefährdung von Menschen mit Behinderung durch sexuelle Gewalt bei?
- Mehrere Faktoren tragen dazu bei, darunter gesellschaftliche Vorstellungen über die Sexualität von Menschen mit Behinderung, mangelnde sexuelle Aufklärung, wiederholte medizinische Untersuchungen und Eingriffe, soziale Ablehnung und Ausgrenzung, Fremdbestimmung und Abhängigkeiten im Alltag sowie mangelnde Artikulationsmöglichkeiten und mangelnder Glaube an ihre Aussagen im Falle von Missbrauchserfahrungen.
- Welche Folgen kann sexuelle Gewalt bei Menschen mit Behinderung haben?
- Die Folgen können traumatische Sexualisierung, Stigmatisierung, Betrug, Machtlosigkeit, Angst- und Panikattacken, psychosomatische Beschwerden (wie Einnässen, Essstörungen, Schlafstörungen), Auto-Aggression, Drogen- und Alkoholabhängigkeit und ein negatives Körpergefühl sein.
- Welche Interventionsmöglichkeiten werden im Dokument genannt?
- Das Dokument betont die Bedeutung von Ruhe bewahren bei Verdacht auf sexuelle Gewalt, dem Überlebenden zu glauben, ihn aktiv in den Prozess einzubeziehen, UnterstützerInnen zu identifizieren, das Handeln transparent zu machen und die Konsequenzen einer Anzeige sorgfältig zu prüfen.
- Welche Therapieansätze werden im Dokument erwähnt?
- Das Dokument betont, dass nicht jeder Betroffene eine Therapie benötigt, sondern dass viele durch Beratung geholfen werden kann. Falls Therapie gewünscht ist, wird die Bedeutung der Selbstheilungskräfte des Klienten betont, ebenso wie die Bedeutung, das richtige Menschenbild zu haben, sowie das passende Tempo zu wählen.
- Welche rechtlichen Aspekte werden behandelt?
- Das Dokument erwähnt den Straftatbestand der Schändung nach dem österreichischen StGB sowie Schwierigkeiten bei der Verfolgung von Gewalttaten gegen Menschen mit Behinderung aufgrund ihrer Glaubwürdigkeit als Zeugen und der Frage, ab wann man Menschen mit Behinderung als "widerstandsunfähig" bezeichnet.
- Welche Präventionsmaßnahmen werden im Dokument beschrieben?
- Das Dokument unterscheidet zwischen primärer, sekundärer und tertiärer Prävention. Es nennt Prinzipien wie "Dein Körper gehört dir!", "Nein-Sagen ist erlaubt!" und "Vertraue deinem Gefühl!". Außerdem werden Präventionsprogramme wie Peer Counseling, Selbstverteidigung ("WenDo"), Ninlil - ein Verein gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen mit geistiger Behinderung - Special Love Talks beschrieben.
- Was ist Empowerment im Kontext von Menschen mit Behinderung und sexueller Gewalt?
- Empowerment bedeutet, dass Betroffene ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen, sich dabei ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst werden, eigene Kräfte entwickeln und soziale Ressourcen nutzen. Im Kontext sexueller Gewalt soll Empowerment dazu beitragen, Machtgefälle und Abhängigkeitsverhältnisse zu minimieren und Menschen mit Behinderung als selbstbewusste und vollwertige Mitglieder der Gesellschaft wahrzunehmen.
- Was ist Special Love Talks?
- Special Love Talks ist ein präventives Modell der Sexualerziehung für Menschen mit Behinderung, das die Kommunikation zwischen Betreuern, Eltern und Menschen mit Behinderung fördern soll. Es zielt darauf ab, über Sexualität zu sprechen und aufzuklären, sowie präventiv gegen Gewalt, insbesondere sexuelle Gewalt, zu wirken.
- Quote paper
- Barbara B. (Author), 2002, Sexuelle Gewalt bei Menschen mit Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107298