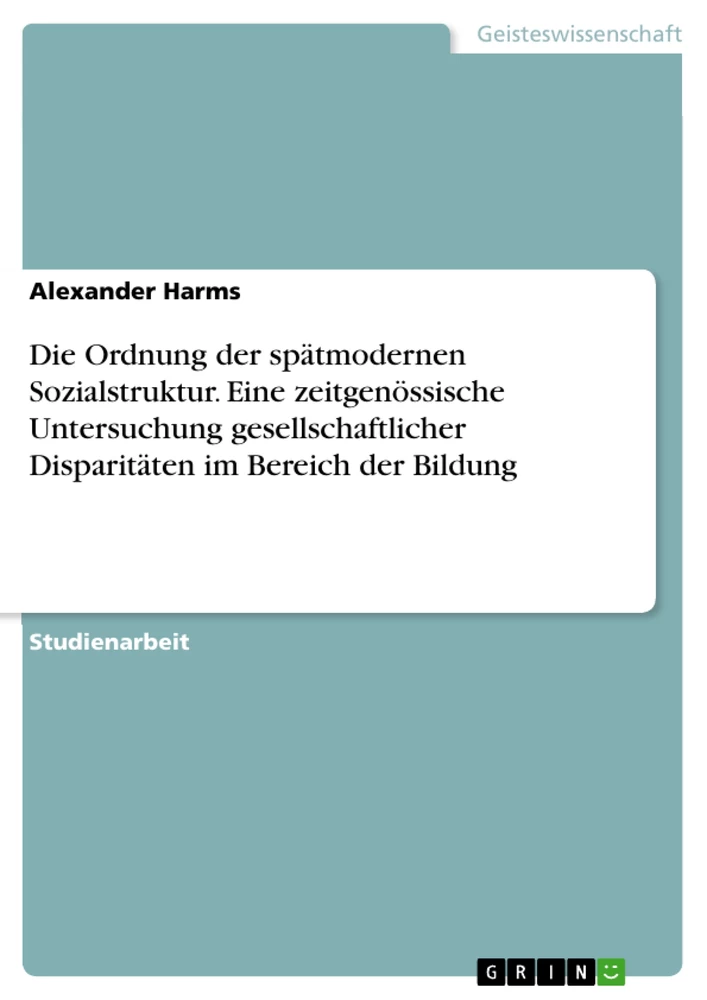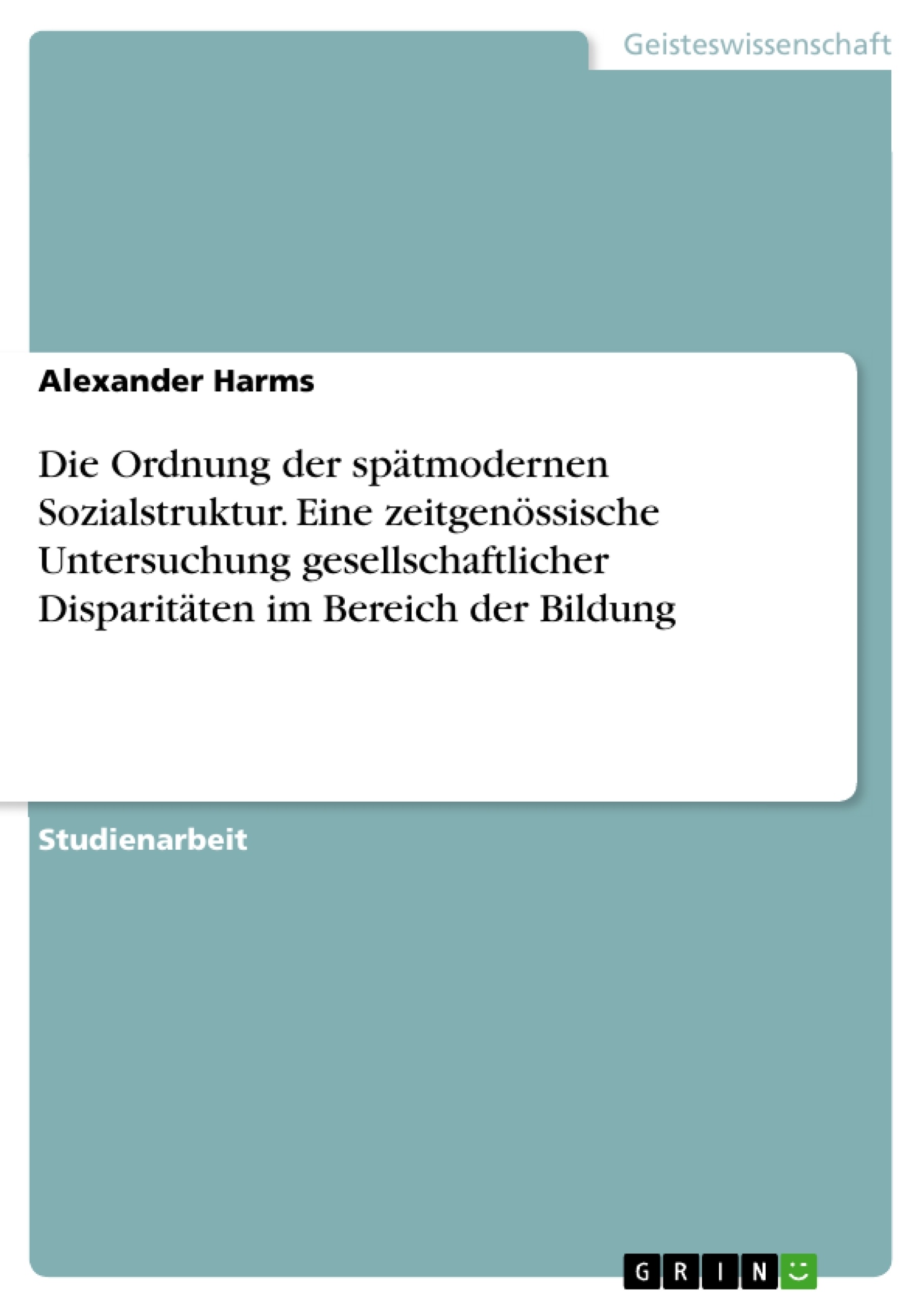Die Frage, die es im Folgenden zu bearbeiten gilt, ist, wie sich soziale Ungleichheiten über den Bildungsaspekt perpetuieren, institutionell legitimieren und somit ein gesellschaftliches Ordnungssystem darstellen, auch wenn die Folgen der Ungleichheit nicht unbedingt intentional sind. Dies soll, nach dem Vorstellen theoretischer Ansätze, mittels einer Aufteilung der, von der Anzahl her noch immer, dominierenden Mittelklasse geschehen. Unter dem Heranziehen theoretischer Ansätze Bourdieus, wird das Feld der Bildung nach außen hin abgesteckt und in angrenzende Felder eingebunden.
Da ein Feld von einem permanenten Kampf zwischen den Individuen gekennzeichnet ist, werden als nächstes die für diesen Kampf nutzbaren Ressourcen, die Kapitalien, erläutert, die mitunter den Habitus der Individuen bedingen. Dabei wird insbesondere auf die Herausbildung des kulturellen Kapitals wert gelegt, da diesem in der Spätmoderne ein starkes Gewicht bei der sozialen Positionierung des Individuums innewohnt. Weiterhin wird das theoretische Gerüst, um es zeitgenössisch zu nutzen, mit dem Begriff der Singularisierung erweitert, der in den Arbeiten von Andreas Reckwitz eine starke Erklärungskraft der spätmodernen gesellschaftlichen Ordnung besitzt.
Bei der Bearbeitung sollen im übergeordneten Sinne die Aktualität Bourdieus theoretischer Ausarbeitungen überprüft sowie die strukturelle Ordnung der spätmodernen Gesellschaft mit dem Aspekt der Bildung als konstitutiven Faktor aufgezeigt werden. Abschließend werden in einem Fazit noch einmal alle auftauchenden Prämissen und Konklusionen zusammenfassend dargestellt und einer kritischen Betrachtung unterzogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die gesellschaftliche Urteilskraft in der (Spät-)Moderne
- Habitus und die soziale Position des Subjekts
- Die symbolische Logik des Singulären
- Eine ungleiche Charakteristik der spätmodernen Mittelklasse
- Die neue Mittelklasse
- Die traditionelle Mittelklasse
- Die prekäre Mittelklasse
- Fazit und Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der spätmodernen Sozialstruktur Deutschlands und analysiert die Rolle von Bildung in der Perpetuierung gesellschaftlicher Disparitäten. Sie untersucht, wie soziale Ungleichheiten über den Bildungsaspekt perpetuiert und institutionell legitimiert werden. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die strukturelle Ordnung der spätmodernen Gesellschaft mit dem Aspekt der Bildung als konstitutiven Faktor aufzuzeigen.
- Soziale Ungleichheit in der Spätmoderne
- Die Rolle von Bildung in der Reproduktion sozialer Strukturen
- Theoretische Ansätze zur Analyse sozialer Ungleichheit (z.B. Bourdieu)
- Die Bedeutung von kulturellem Kapital für die soziale Positionierung
- Der Einfluss der Mittelklasse auf die gesellschaftliche Ordnung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit und die Forschungsfrage vor. Sie beleuchtet die Bedeutung der moralischen Urteilskraft in der Spätmoderne und zeigt auf, wie Bildung in die Sozialisierung von Subjekten involviert ist.
- Die gesellschaftliche Urteilskraft in der (Spät-)Moderne: Dieses Kapitel analysiert die Rolle von Habitus und sozialer Positionierung im Kontext der spätmodernen Gesellschaft. Es greift auf Bourdieus Theorie der sozialen Felder zurück, um die Entstehung von Ungleichheit zu erklären.
- Eine ungleiche Charakteristik der spätmodernen Mittelklasse: Das Kapitel untersucht die drei Untergruppen der spätmodernen Mittelklasse (neue, traditionelle und prekäre Mittelklasse) und analysiert ihre jeweiligen Herausforderungen und Positionen im Bildungssystem.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen soziale Ungleichheit, Bildung, Spätmoderne, Habitus, kulturelles Kapital, soziale Felder, Mittelklasse, und die Arbeiten von Bourdieu und Reckwitz.
Häufig gestellte Fragen
Wie perpetuiert Bildung soziale Ungleichheit?
Bildung fungiert oft als institutionelle Legitimation für bestehende Disparitäten, indem sie den Zugang zu Ressourcen an kulturelles Kapital knüpft, das ungleich verteilt ist.
Welche Bedeutung hat Bourdieus Begriff des „kulturellen Kapitals“?
Kulturelles Kapital umfasst Bildungstitel, Wissen und kulturelle Gewohnheiten. In der Spätmoderne ist es entscheidend für die soziale Positionierung und den Aufstieg innerhalb der Gesellschaft.
Was versteht Andreas Reckwitz unter „Singularisierung“?
Singularisierung beschreibt den spätmodernen Trend zur Einzigartigkeit und Besonderheit von Objekten, Orten und Personen, was die traditionelle soziale Ordnung transformiert.
Wie unterteilt sich die spätmoderne Mittelklasse?
Die Arbeit unterscheidet zwischen der neuen Mittelklasse (akademisch geprägt), der traditionellen Mittelklasse und der prekären Mittelklasse.
Was ist ein „soziales Feld“ nach Bourdieu?
Ein Feld ist ein gesellschaftlicher Teilbereich (wie Bildung), in dem Individuen permanent um Macht und Ressourcen kämpfen, basierend auf ihrem Habitus und Kapital.
- Quote paper
- Alexander Harms (Author), 2021, Die Ordnung der spätmodernen Sozialstruktur. Eine zeitgenössische Untersuchung gesellschaftlicher Disparitäten im Bereich der Bildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1074466