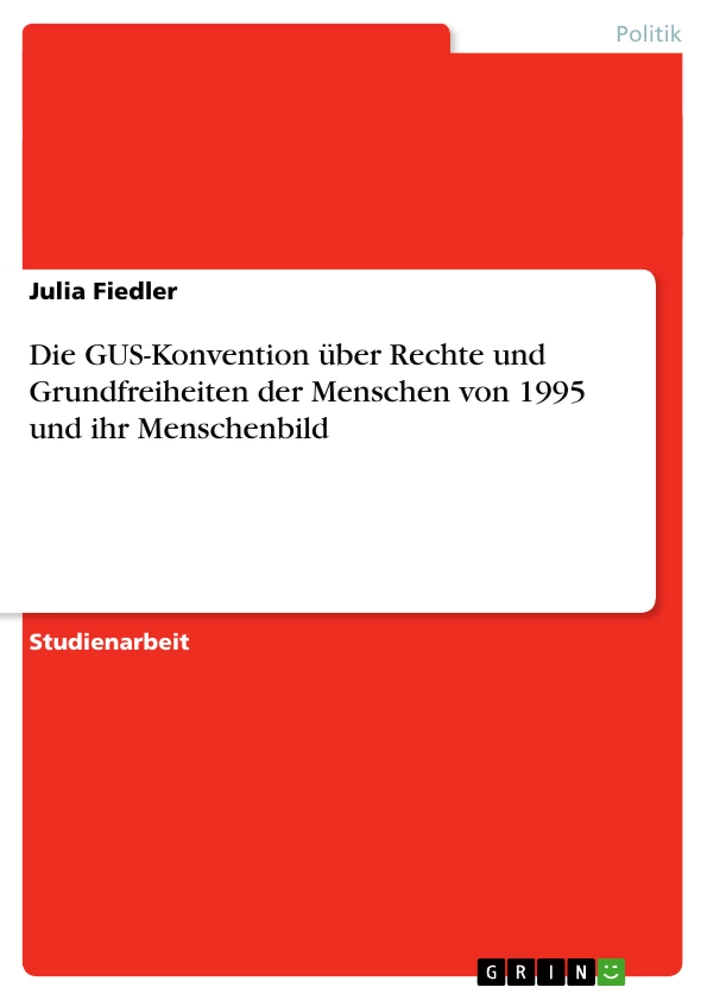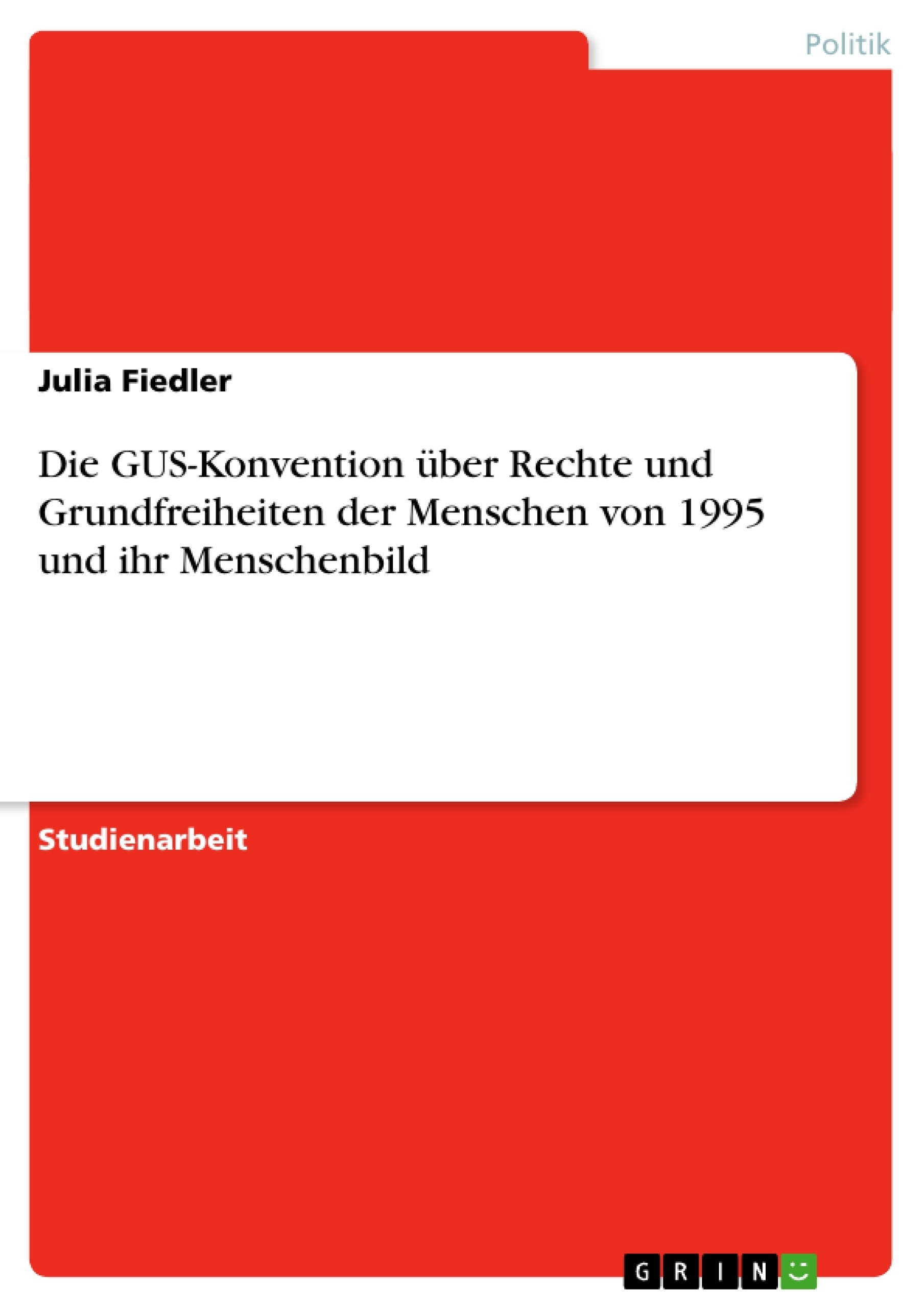Inhalt
1. Einleitung
2. Hauptteil
1. Rückblick: Die Geschichte der Menschenrechte auf GUS-Gebiet
2. Der Aufbau der Konvention
2.1 Die Konvention und ihr Menschenbild
2.2 Gründe für die Erstellung
3. Umsetzung der Menschenrechte
3. Zusammenfassung
4. Literaturverzeichnis
1.: Einleitung
Am 26. Mai 1995 wurde von den Staatsoberhäuptern der Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) eine eigene Konvention über die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen unterzeichnet. Dieser Vertrag wurde erstellt unter Berücksichtigung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte. Er sichert den Staatsbürgern umfassende Rechte und Freiheiten zu, schränkt diese mitunter ein und weist auf Pflichten gegenüber Staat und Gemeinschaft hin. Des Weiteren werden Pflichten der Vertragschließenden Parteien, also des Staates und seiner Verwaltungsorgane, benannt.
Der Vertrag wurde aufgesetzt „im Glauben, dass die Einhaltung der internationalen Standards im Bereich der Menschenrechte durch alle Mitgliedsstaaten der GUS [...] zu der Vertiefung demokratischer Umgestaltungen, zum wirtschaftlichen und sozialen Wachstum, zu der Verstärkung der Gesetzlichkeit und Rechtsordnung“[1] beitrage.
Eine Menschenrechtskonvention eigens für die GUS – warum? Wodurch wird ihr Inhalt geprägt? Was für ein Menschenbild liegt ihr zugrunde? Wie steht es mit der Verbindlichkeit des Vertrages? Besitzt die GUS ein Kontrollorgan, und werden Verstöße gegen den Vertrag und Menschenrechtsverletzungen verurteilt? Ist eine positive Entwicklung bei den Menschenrechten in den Mitgliedsstaaten zu verzeichnen?
Anhand dieser Fragen werde ich im Folgenden das Thema erörtern. Dabei beginne ich mit einem kurzen Rückblick: Welche Verträge zu den Menschenrechten hat es vorher schon auf GUS-Gebiet gegeben? Hiernach gehe ich kurz auf die Struktur der Konvention ein.
Es folgt ein Versuch, der Konvention grundlegende Inhalte zu entnehmen und ein Menschenbild aus ihren Zeilen zu deuten. Die gewonnenen Erkenntnisse betrachtend, versuche ich, Gründe für die Erstellung des Vertrages zu finden und gebe in einem kurzen Abriss darauf folgend einen Überblick, wie sich die Behandlung der Menschenrechte in den letzten Jahren gewandelt hat.
In einem Fazit fasse ich den Inhalt der Ausarbeitung zusammen und stelle meine eigene Meinung zum Nutzen der Konvention kurz dar.
1.: Rückblick: Geschichte der Menschenrechte auf GUS-Gebiet
Die Konvention der Gemeinschaft unabhängiger Staaten über die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen von 1995 ist nicht der erste Vertrag auf dem Gebiet der 1991 zur GUS zusammengeschlossenen Staaten, welcher Artikel zu den Menschenrechten enthält. Menschenrechtsbestimmungen waren bereits in den Verfassungen der UdSSR von 1936 und 1977 festgeschrieben.
Die Verfassung von 1936 koppelt die Rechte bereits an die Pflichten. „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen“, oder „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung“[2]. Dieser Vertrag sichert den Menschen garantierte Beschäftigung[3], das Recht auf Bildung[4], Rede-, Presse-, Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit[5], das Recht auf Erholung[6] und einige andere Rechte zu. Auch die Gleichberechtigung der Frau ist verankert. Die Menschenrechte in dieser Verfassung erscheinen allerdings fragwürdig vor dem Hintergrund der Menschenrechtsverletzungen zu jener Zeit, begangen durch den Staat, unter seinem Oberhaupt Josef Stalin. Sie sollen gar nur ein „für die europäische Öffentlichkeit bestimmter propagandistischer Trick“[7] gewesen sein.
Die Verfassung von 1977 enthält im wesentlichen die gleichen Rechte und Pflichten, es gibt einige weitere wie zum Beispiel das Recht, den staatlichen Organen und gesellschaftlichen Organisationen Vorschläge für die Verbesserung ihrer Tätigkeit zu unterbreiten und Mängel an ihrer Arbeit zu kritisieren[8]. Aber auch hier sind die Rechte an die Pflichten gekoppelt, was eine Garantie der Rechte bei nicht-Erfüllung der Pflichten fraglich macht. Dieser Vertrag enthält also einen doppelten Boden, es gibt einen verfassungsmäßigen Grund, Rechte einzuschränken.
2.: Der Aufbau der Konvention
Die GUS-Konvention über Rechte und Grundfreiheiten der Menschen von 1995 beinhaltet 39 Artikel. Diese lassen sich den drei Generationen von Menschenrechten[9] zuordnen. So enthalten die
- Artikel 2 bis 12 und 22 bis 25 Menschenrechte der ersten Generation. Zum Beispiel Artikel zwei: Das Recht auf Leben, Artikel drei: Das Verbot von Folter, einige weitere Artikel: Bürgerrechte und Freiheitsrechte.
- Artikel 13 bis 21 und 26 bis 28 Menschenrechte der zweiten Generation. Zum Beispiel Artikel 14: Das Recht auf Arbeit, Artikel 15: Das Recht auf Schutz der Gesundheit, Artikel 16: Das Recht auf soziale Sicherheit.
- Artikel 29 Menschenrecht der dritten Generation. Das Recht auf Partizipation.
In Artikel 30 bis 39 sind Regeln zur Handhabung des Vertrages seitens der Mitglieder festgehalten. Für die ihn schließenden Parteien ist der Vertrag verbindlich. Unter bestimmten Umständen, wenn es der „Ernst der Situation“[10] erfordert, werden Abweichungen geduldet, diese müssen jedoch sinnvoll begründet werden. Jeder Staat kann die Konvention kündigen. Andere Staaten, die Ziele und Prinzipien der Konvention teilen, können ihr beitreten.
2.1: Die Konvention und ihr Menschenbild
Die „gegenseitige Verantwortlichkeit von Staat und Persönlichkeit“[11] sowie die „Koppelung der Grundrechte und –freiheiten an die Grundpflichten“[12] sind wichtige Charakteristika des sozialistischen Staates. Dementsprechend wird der Mensch in der Konvention als zweigeteiltes Wesen gesehen: Er ist zum Einen Teil der Gemeinschaft, zum Anderen Individuum. Dem Menschen sind nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten zugewiesen. Er trägt für sich selbst Verantwortung und für die Gesellschaft in der er lebt; Im Kleinen für die Familie, im Großen für die Gemeinschaft aller Menschen im Staat. Ebenso hat auch der Staat Verpflichtungen gegenüber seinem Bürger. Diese werden maßgeblich gekennzeichnet durch die „Ideale der Freiheit und der Herrschaft des Gesetzes“[13], welche der Konvention zugrunde liegen. Der Staat soll dem Menschen Lebensgrundlage und Möglichkeit zur freien Entfaltung bieten, aber auch das Zusammenleben in der Gemeinschaft überwachen und regulieren. Ziel aller Bemühungen, auf der einen Seite durch Engagement und Brüderlichkeit, auf der anderen durch Gesetzgebung und soziale Regelungen, ist es, ein solides und harmonisierendes System herzustellen.
„Alle Personen sind vor Gericht gleich“[14], heißt es in Artikel sechs der Konvention.
„Jedermann hat das Recht auf gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit, [...], sowie auf gleiche Bedingungen für gleichwertige Arbeit und auf gleiche Kriterien der Bewertung der Arbeit“[15], in Artikel 14.
Gleichberechtigung und Gleichheit stehen in der Konvention ganz oben. Doch nicht nur die Rechte, auch die Aufgaben von Bürger und Staat werden in der Konvention zum Teil sehr genau benannt. Ein wichtiger Aspekt ist Integration: Zur „effektiven Verwirklichung der Rechte körperlich und geistig nicht erwerbsfähiger Personen auf [...] Wiedereingliederung in das gesellschaftliche Leben verpflichten sich die Vertragschließenden Parteien [...] Maßnahmen zur Stimulierung der Arbeitgeber zu ergreifen, Behinderte einzustellen.“[16] Diese Aufforderung richtet sich einerseits an den Staat, der zur Gleichberechtigung aufrufen und Regelungen zu ihrer Durchsetzung schaffen soll. Aber vor allem auch an die Arbeitgeber und Kollegen, ja an alle Menschen, andere als gleichwertig zu anzuerkennen und sie dementsprechend zu behandeln. Diskriminierung etwa wegen „des Geschlechtes, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, politischen oder anderen Überzeugungen, der nationalen oder sozialen Herkunft, Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, der Vermögenslage oder Dienststellung, des Geburtsorts“[17] ist alles andere als erwünscht, Toleranz und Mitmenschlichkeit dagegen sehr.
Aufgabe des Staates ist es außerdem, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch gleichberechtigt die ihm zur Verfügung stehenden Chancen und Angebote, etwa zur Ausbildung, annehmen kann, egal, wie seine persönlichen Möglichkeiten sind. Hier ist der Staat verpflichtet „zur Gewährleistung einer effektiven Verwirklichung des Rechts auf berufliche Ausbildung [...] die [...] Ausbildung aller Personen, einschließlich der Behinderten [...] so weit wie möglich zu fördern, [...]“ und „materielle Hilfe in entsprechenden Fällen“[18] zu gewähren.
Eine Gesellschaft, die sich auf Gleichheit und Gleichberechtigung stützt, möchte gerecht sein. Gerechtigkeit soll in allen Bereichen herrschen, besonders auch in der Rechtssprechung. „Jeder der Begehung einer Straftat beschuldigte gilt als unschuldig, solange seine Schuld nicht in Übereinstimmung mit dem Gesetz nachgewiesen ist.“[19]
Die Väter der Konvention formulierten viele Artikel in dem Wissen, dass ihre Staaten vom erstrebten Zustand zum Teil noch weit entfernt sind. Und im Bewusstsein, dass der Wunsch nach alles umfassender Gerechtigkeit ein Ideal ist, welches dem Menschen viel abverlangt. Ihr steht das der menschlichen Art eigene Streben nach Verbesserung und Macht entgegen. So deuten besonders jene Artikel, die Regelungen zur Erstellung und Verfestigung von Gerechtigkeit beinhalten, ein Menschenbild an. Man wünscht sich den Menschen als einen gerechten, manchmal selbstlosen und hilfsbereiten. Da man jedoch sieht, dass er sich nicht immer so verhält, will man ihm durch die Konvention den rechten Weg weisen und ihn seinem Idealbild ein Stück näher bringen (ebenso verhält es sich mit dem Staat, dessen Angestellte Menschen sind, deren Schwächen sich auf ihn übertragen). Man unternähme keine Anstrengungen, täte man es nicht in der Gewissheit, dass man Erfolge erzielen kann. Die Urheber der Konvention sehen also Potential im Menschen, so zu werden, wie er idealer Weise sein sollte. Das Ideal ist hierbei natürlich subjektiv das, welches der Ideologie der GUS-Staaten entspricht. Man ist überzeugt, den Menschen nach eigenem Interesse umformen zu können. Da eine Ideologie eine starke Überzeugung ohne Zweifel ist, denke ich nicht, dass man den Menschen als ein leicht manipulierbares Wesen sieht. Man geht wohl eher davon aus, dass er von Grund auf gut ist, und somit das gewünschte Verhalten in ihm liegt.
Soziale Verpflichtungen des Staates erstrecken sich unter anderem auf den Bereich der Familie. Zur „Gewährleistung der erforderlichen Bedingungen für eine volle Entfaltung der Familie, die die grundlegende Keimzelle der Gesellschaft ist“ verpflichtet sich der Staat, „durch solche Maßnahmen wie Sozial- und Familienhilfe, [...], zum wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Schutz der Familie beizutragen“[20]. Die Familie gibt Halt und Fürsorge und ist die kleinste Teilgemeinschaft der Gesellschaft. Ihre Wichtigkeit, die in diesem Artikel hervorgehoben wird, weist auf die Bedeutung des sozialen Verhaltens und des Menschen und seiner Position in einem festen sozialen Umfeld hin. Wie die Familie die grundlegende Keimzelle der Gesellschaft ist, so ist das soziale Gefüge insgesamt das Fundament jeder Gesellschaft. Der enge Zusammenhalt der Familie ist ein alter Wert, den die Menschen bewahren sollen. Hierbei muss der Einzelne oft seine eigenen Interessen zurückstellen. Egoistisch sollte der Mensch also nicht sein, auch nicht absolut selbstlos, er soll ein gutes Mittelmaß finden.
Freiheit ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Konvention. Die freie Wohnsitzwahl, und das Recht, jedes Land zu verlassen (auch das eigene)[21], die Achtung des Privat- und Familienlebens (einschließlich der Unverletzlichkeit der Wohnung und des Briefgeheimnisses)[22], das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit[23], das Recht auf freie Meinungsäußerung[24], und das Recht, sich zu versammeln und Gewerkschaften zu bilden[25] sind in der Konvention verankert. Diese Freiheiten sind durch einen Zusatz beschränkt: Einschränkungen „im Interesse der staatlichen und öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, des Schutzes der Volksgesundheit und der öffentlichen Sittlichkeit oder des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer“[26] können vorgenommen werden. Dies erscheint paradox. Machen doch gerade Freiheiten wie das Recht auf freie Meinungsäußerung kaum Sinn, wenn gewisse Meinungen nicht zulässig sind. Und das Recht, sich zu versammeln, ist nutzlos, wenn es eingeschränkt werden kann. Versammelt man sich doch schließlich, um auf etwas aufmerksam zu machen und gegen etwas zu mobilisieren, in der Hoffnung, dass der öffentliche Druck zum Einlenken führt. Welche Handhabe bleibt also um gegen etwas zu protestieren, das das Handeln des Staates betrifft? Die Bürger werden beschränkt und überwacht. Wieso? Man ist sich der Kritik und Unzufriedenheit offensichtlich bewusst, die das System hervorruft. Wieso zweifelt man dann nicht an ihm, sondern versucht, durch Zwang Ordnung herzustellen und ein Selbstständigwerden des Menschen zu ersticken? Wenn hier nicht am Staat, sondern am Menschen gezweifelt wird, deutet dies wieder ein Menschenbild an. Man macht den Menschen unmündig, wie ein Kind. Man traut ihm das richtige Urteilsvermögen nicht zu.
Die Freiheitsrechte wirken fast wie reine Schau, vielleicht wurden diese Artikel nur formuliert, um einen guten Eindruck im Ausland zu machen. Solch eine Vorgehensweise ist aus der Verfassung von 1936 bekannt: Hier wurden dem Menschen umfassende Rechte, auch das der Meinungsfreiheit, zugesichert, dennoch wurden Gegner der Regierung hingerichtet.
In Artikel vier verspricht die Konvention, dass niemand gezwungen werden darf „Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten.“[27] Auch dies wird im Interesse der Gemeinschaft eingeschränkt: Ausgenommen sind „jede Dienstleistung militärischer Art“ und „jede Dienstleistung, deren Erfüllung anstelle der Wehrpflicht verlangt wird“, „jede Dienstleistung, die in Fällen eines Notstandes oder einer Katastrophe, die das [...] Wohl der Gemeinschaft bedrohen, obligatorisch ist“, „jede Arbeit oder Dienstleistung, die zu den gewöhnlichen Bürgerpflichten gehört“. Auch Mitglieder einer Familie sind sich in ihrer kleinen Gemeinschaft gegenseitig die Erfüllung von Pflichten schuldig. „Die Eltern, die notwendigen Bedingungen für die Kinder zu schaffen“ und die „volljährigen Kinder, die arbeitsunfähigen und hilfsbedürftigen Eltern zu unterstützen“[28]. Zwangs- und Pflichtarbeit sind zwar verboten, aber es gibt Ausnahmen, Pflichten des Staatsbürgers werden hier konkret benannt. Er soll sie im Dienste der Gemeinschaft verrichten. So birgt dieser Artikel keinen Widerspruch, schließlich geht man davon aus, dass der Bürger für seinen Staat freiwillig, wenn nicht sogar gerne arbeitet. In früheren Verfassungen wird diese Ansicht sehr deutlich formuliert: „Der Militärdienst in den Reihen der Roten Armee der Arbeiter und Bauern ist Ehrenpflicht der Bürger der UdSSR.“[29] Die Pflichten innerhalb der Familie werden ebenso als selbstverständlich angesehen. Der Mensch wäre undankbar und unmoralisch, würde er es ablehnen, seiner Familie wenn nötig zur Seite zu stehen. Wie die Konvention also die Bereitschaft zu Zwangs- und Pflichtarbeit in diesem Sinne voraussetzt, sieht sie den Menschen als ein Moral und Pietät besitzendes Wesen an.
Ein scheinbarer Widerspruch findet sich in Artikel zwei: „Das Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich geschützt.“[30] Jedoch: „Bis zu ihrer Abschaffung darf die Todesstrafe [...] wegen besonders schwerer Straftaten angewendet werden.“[31] Bei einem so fundamentalen Recht wie dem Recht auf Leben fällt die Einschränkung im Zusatz besonders stark auf. Das menschliche Leben so sehr schätzend, dass man seinen Schutz zum Gesetz erhebt, muss man einen guten Grund haben, die Todesstrafe auch nur in Ausnahmefällen zu billigen. Dieser Artikel enthält in sich selbst einen Widerspruch. Seinen Schöpfern war das sicher bewusst und sie nahmen es in kauf. Gerade dieser Widerspruch gibt den Unterschied zwischen Wunschbild und realem Bild des Menschen besonders deutlich wieder. Der ideale Mensch muss nicht bestraft werden. Aber ist nicht auch für den realen Menschen, der nicht ideal ist, die Todesstrafe zu hart? Wahrscheinlich soll sie eine abschreckende Wirkung ausüben. Ihre Abschaffung in Aussicht stellend, hofft man wohl, den Menschen nicht mehr abschrecken zu müssen, wenn er eine bestimmte Entwicklung durchgemacht hat. Bei der Idee, den Menschen zu erziehen, sieht man ihn wohl als im Wesen grundsätzlich gut an.
2.2: Gründe für die Erstellung der Erklärung
Die GUS-Staaten schufen knapp 40 Jahre nach Inkrafttreten der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte eine eigene Konvention zu den Rechten und Grundfreiheiten der Menschen. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde 1948 von der UdSSR, als deren Nachfolgeorganisation die GUS gesehen wird, aufgrund von Vorbehalten nicht unterzeichnet, aber anerkannt. Ein wichtiger Grund war damals, dass Rassismus und Nazismus in der Erklärung nicht ausdrücklich verurteilt wurden, und es beim Recht auf Meinungsfreiheit und Vereinigung keine Einschränkung für Nazis gab.[32]
Einschränkungen wichtiger Rechte und Freiheiten wie der Meinungsfreiheit oder der Versammlungsfreiheit findet man im Gegensatz zur GUS-Konvention in der ansonsten sehr ähnlichen allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nicht. Der GUS-Vertrag ist ein Kompromiss gegenüber der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Hinter diesem Menschenrechtsvertrag können die Mitgliedsstaaten uneingeschränkt stehen, da er ihrem kulturellen und ideologischen Hintergrund entspricht, und außerdem ihrem Menschenbild. Vermutlich liegt hauptsächlich im unterschiedlichen Menschenbild der Grund für die Erstellung einer eigenen Konvention. Das die Konvention erst nach Zerfall der UdSSR und Gründung der GUS entstand, soll vermutlich einen Aufbruch signalisieren und die Mitgliedsstaaten enger zusammenschweißen.
3.: Umsetzung der Menschenrechte
Um von einer zufriedenstellenden Gewährleistung der Rechte und Grundfreiheiten sprechen zu können, muss in den GUS-Staaten noch viel getan werden. In den GUS-Staaten werden weiterhin schwere Menschenrechtsverletzungen begangen. Bekanntestes Beispiel ist wohl der Konflikt in der Tschetschenischen Republik. Dort machten sich russische Streitkräfte wie auch tschetschenische Truppen in den vergangenen Jahren schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht schuldig.[33] Berichte über Folter und Misshandlungen durch die Polizei oder in Haft, teilweise mit Todesfolge, hört man aus allen Mitgliedsstaaten, ausgenommen Kirgisistan. Aber auch hier wurde gegen in der Konvention festgelegte Grundrechte, wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit, verstoßen. So waren Journalisten Repressalien ausgesetzt.[34] In Aserbaidschan ebenfalls. Dort „prügelten Polizeibeamte in Uniform und Zivil [...] auf mindestens acht Journalisten ein, die dabei Verletzungen davontrugen. Die Journalisten hatten über eine nicht genehmigte Demonstration in Baku berichtet.“ „Korrespondenten russischer und türkischer Fernsehanstalten wurden ebenfalls tätlich angegriffen und am Filmen gehindert.“[35] Die Ukraine wurde von mehreren zwischenstaatlichen Organisationen wegen Einschränkungen der Pressefreiheit und Menschenrechtsverletzungen kritisiert.[36] Ebenso vom UN-Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung wegen des „brutalen Vorgehens der Polizei gegen die in der Ukraine lebenden Roma.“[37] In Georgien gab es tätliche Übergriffe auf Angehörige religiöser Minderheiten.[38] In Armenien wurden Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen in Haft genommen, das gleiche in der Russischen Föderation.[39]
3.: Zusammenfassung und Fazit
Die GUS-Konvention erscheint sehr fortschrittlich und modern. Schon allein die Formulierung der Artikel, verglichen mit der der Menschenrechtsartikel der vorherigen Verfassungen, erzeugt diesen Eindruck. Toleranz und Mitmenschlichkeit werden groß geschrieben, ebenso wie Gleichberechtigung. Im Vordergrund steht der Wunsch nach einer idealen Gesellschaft mit idealen Menschen. Man hat sich einen Staat erdacht und einen Menschen, der in ihm lebt. Nun versucht man, diese Vorstellungen auf den realen Menschen und auf den Staat zu projizieren, was Zeit und Anstrengung braucht. Das Menschenbild stellt den Menschen als imperfekten dar, der dem Ideal nicht entspricht, aber zugleich auch als Wesen, das von Grund auf gut ist und Potential besitzt. Man traut ihm alle erwünschten Eigenschaften zu. So werden dem Menschen die Fähigkeit zur Selbstlosigkeit und Hilfsbereitschaft ebenso wie die zur Toleranz zugesprochen, man versucht diese Eigenschaften, wo immer sie nicht zu sehen sind, anzusprechen und nach außen zu kehren. Der Staat soll die nötigen Voraussetzungen schaffen, damit der Mensch zufrieden und geschützt in ihm leben kann.
Die Konvention erzeugt Zuversicht und Hoffnung. Es scheint, als hätte man erkannt, dass die Situation in der Vergangenheit nicht gut war, und wage nun einen Aufbruch. Da die Wahrung der Menschenrechte in den Mitgliedsstaaten alles andere als zufriedenstellend erfolgt, ist eine Einhaltung der Konvention wünschenswert.
4.: Literaturverzeichnis
- Menschenrechte. Dokumente und Deklarationen. Bonn 1999, Bundeszentrale für politische Bildung.
- amnesty international Deutschland. URL: www.amnesty.de
- Peter Danchin: “Drafting history – the universal declaration of human rights”. URL:http://www.ccnmtl.columbia.edu/projects/mmt/udhr/udhr_general/drafting_history_10.html
- Theodor Schweisfurth: „Die Sowjetunion im Aufbruch zum sozialistischen Rechtsstaat“.
- Sergej Kowalew: „Die Überwindung des Totalitarismus in Russland“. URL: http://www.igfm.de/mr/mr1998/mr980235.htm
- Die Verfassung der UdSSR von 1936.
- Die Verfassung der UdSSR von 1977.
[...]
[1] Konvention der Gemeinschaft unabhängiger Staaten über die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen, Einleitung.
[2] Die Verfassung der UdSSR von 1936, Kapitel 1, Artikel 12.
[3] Die Verfassung der UdSSR von 1936, Kapitel 1, Artikel 118.
[4] Die Verfassung der UdSSR von 1936, Kapitel 1, Artikel 121.
[5] Die Verfassung der UdSSR von 1936, Kapitel 1, Artikel 125.
[6] Die Verfassung der UdSSR von 1936, Kapitel 1, Artikel 119.
[7] Sergej Kowalew: „Die Überwindung des Totalitarismus in Russland“. URL: http://www.igfm.de/mr/mr1998/mr980235.htm
[8] Die Verfassung der UdSSR von 1977, Kapitel 7, Artikel 49.
[9] Menschenrechte lassen sich formal in drei Generationen unterteilen. Mit den Rechten der ersten Generation sind dabei die klassischen bürgerlichen und politischen Freiheitsrechte gemeint. Als Rechte der zweiten Generation lassen sich wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte benennen. Die dritte Generation umfasst Rechte wie das Recht auf Entwicklung, Frieden, Umweltschutz, Partizipation und Selbstbestimmung.
[10] Konvention der Gemeinschaft unabhängiger Staaten über die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen, Artikel 35.
[11] Theodor Schweisfurth: „Die Sowjetunion im Aufbruch zum sozialistischen Rechtsstaat“, Kapitel 3.
[12] Theodor Schweisfurth: „Die Sowjetunion im Aufbruch zum sozialistischen Rechtsstaat“, Kapitel 3.
[13] Konvention der Gemeinschaft unabhängiger Staaten über die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen, Einleitung.
[14] Konvention der Gemeinschaft unabhängiger Staaten über die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen, Artikel 6.
[15] Konvention der Gemeinschaft unabhängiger Staaten über die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen, Artikel 14.
[16] Konvention der Gemeinschaft unabhängiger Staaten über die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen, Artikel 18.
[17] Konvention der Gemeinschaft unabhängiger Staaten über die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen, Artikel 20.
[18] Konvention der Gemeinschaft unabhängiger Staaten über die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen, Artikel 28.
[19] Konvention der Gemeinschaft unabhängiger Staaten über die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen, Artikel 6.
[20] Konvention der Gemeinschaft unabhängiger Staaten über die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen, Artikel 13.
[21] Konvention der Gemeinschaft unabhängiger Staaten über die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen, Artikel 22.
[22] Konvention der Gemeinschaft unabhängiger Staaten über die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen, Artikel 9.
[23] Konvention der Gemeinschaft unabhängiger Staaten über die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen, Artikel 10.
[24] Konvention der Gemeinschaft unabhängiger Staaten über die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen, Artikel 11.
[25] Konvention der Gemeinschaft unabhängiger Staaten über die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen, Artikel 12.
[26] Konvention der Gemeinschaft unabhängiger Staaten über die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen, Artikel 9.
[27] Konvention der Gemeinschaft unabhängiger Staaten über die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen, Artikel 4.
[28] Konvention der Gemeinschaft unabhängiger Staaten über die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen, Artikel 4.
[29] Die Verfassung der UdSSR von 1936, Artikel 132.
[30] Konvention der Gemeinschaft unabhängiger Staaten über die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen, Artikel 2.
[31] Konvention der Gemeinschaft unabhängiger Staaten über die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen, Artikel 2.
[32] Peter Danchin, Columbia University: “Drafting History - The Universal Declaration of Human Rights” URL: http://www.ccnmtl.columbia.edu/projects/mmt/udhr/udhr_general/drafting_history_10.html
[33] amnesty international Deutschland: Jahresbericht Russische Föderation, 2002.
[34] amnesty international Deutschland: Jahresbericht Kirgisistan, 2002.
[35] amnesty international Deutschland: Jahresbericht Aserbaidschan, 2002.
[36] amnesty international Deutschland: Jahresbericht Ukraine, 2002.
[37] amnesty international Deutschland: Jahresbericht Ukraine, 2002.
[38] amnesty international Deutschland: Jahresbericht Georgien, 2002.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt der Konvention der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) über die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen?
Die Konvention, unterzeichnet 1995, sichert Staatsbürgern umfassende Rechte und Freiheiten zu, schränkt diese aber auch ein und weist auf Pflichten gegenüber Staat und Gemeinschaft hin. Sie berücksichtigt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte. Ziel ist die Vertiefung demokratischer Umgestaltungen und die Stärkung der Rechtsordnung in den GUS-Staaten.
Welche Menschenrechtsbestimmungen gab es vor der GUS-Konvention?
Menschenrechtsbestimmungen waren bereits in den Verfassungen der UdSSR von 1936 und 1977 festgeschrieben. Diese waren jedoch oft an Pflichten gekoppelt und wurden als propagandistisch kritisiert.
Wie ist die GUS-Konvention aufgebaut?
Die GUS-Konvention umfasst 39 Artikel, die sich den drei Generationen von Menschenrechten zuordnen lassen: bürgerliche und politische Rechte (erste Generation), wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (zweite Generation) und das Recht auf Partizipation (dritte Generation). Die Artikel 30 bis 39 regeln die Handhabung des Vertrages durch die Mitgliedsstaaten.
Welches Menschenbild liegt der GUS-Konvention zugrunde?
Die Konvention sieht den Menschen als zweigeteiltes Wesen: Individuum und Teil der Gemeinschaft. Er hat sowohl Rechte als auch Pflichten. Der Staat soll Lebensgrundlage und freie Entfaltung ermöglichen, aber auch das Zusammenleben überwachen und regulieren. Gleichberechtigung, Toleranz und Mitmenschlichkeit werden betont.
Warum wurde die GUS-Konvention erstellt?
Die Konvention ist ein Kompromiss gegenüber der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Sie soll den kulturellen und ideologischen Hintergrund der GUS-Staaten widerspiegeln und ihren Mitgliedern die Möglichkeit geben, sich vollumfänglich mit einem Menschenrechtsvertrag zu identifizieren. Sie soll einen Aufbruch signalisieren und die Mitgliedsstaaten enger zusammenschweißen.
Wie steht es um die Umsetzung der Menschenrechte in den GUS-Staaten?
Die Umsetzung der Menschenrechte in den GUS-Staaten ist oft mangelhaft. Es gibt Berichte über schwere Menschenrechtsverletzungen, Folter, Misshandlungen durch die Polizei, Einschränkungen der Pressefreiheit und Diskriminierung.
Welche Rolle spielt die Familie in der GUS-Konvention?
Die Familie wird als grundlegende Keimzelle der Gesellschaft hervorgehoben. Der Staat verpflichtet sich, durch Sozial- und Familienhilfe zum wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Schutz der Familie beizutragen. Sie ist die kleinste Teilgemeinschaft der Gesellschaft, und der enge Zusammenhalt der Familie ist ein alter Wert, den die Menschen bewahren sollen.
Inwieweit sind Freiheitsrechte in der GUS-Konvention eingeschränkt?
Freiheitsrechte wie die Meinungsfreiheit und das Recht auf Versammlung können im Interesse der staatlichen und öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung oder des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer eingeschränkt werden. Dies erscheint widersprüchlich, da diese Einschränkungen die eigentliche Bedeutung der Freiheitsrechte untergraben können.
Wie bewertet die GUS-Konvention Zwangs- und Pflichtarbeit?
Zwangs- und Pflichtarbeit sind grundsätzlich verboten, aber es gibt Ausnahmen, wie z.B. Dienstleistungen militärischer Art oder solche, die im Falle eines Notstandes obligatorisch sind. Auch Pflichten innerhalb der Familie werden als selbstverständlich angesehen.
Wie steht die GUS-Konvention zur Todesstrafe?
Obwohl das Recht auf Leben gesetzlich geschützt wird, darf die Todesstrafe bis zu ihrer Abschaffung wegen besonders schwerer Straftaten angewendet werden. Dieser Widerspruch spiegelt den Unterschied zwischen dem Wunschbild und dem realen Bild des Menschen wider.
- Quote paper
- Julia Fiedler (Author), 2002, Die GUS-Konvention über Rechte und Grundfreiheiten der Menschen von 1995 und ihr Menschenbild, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107565