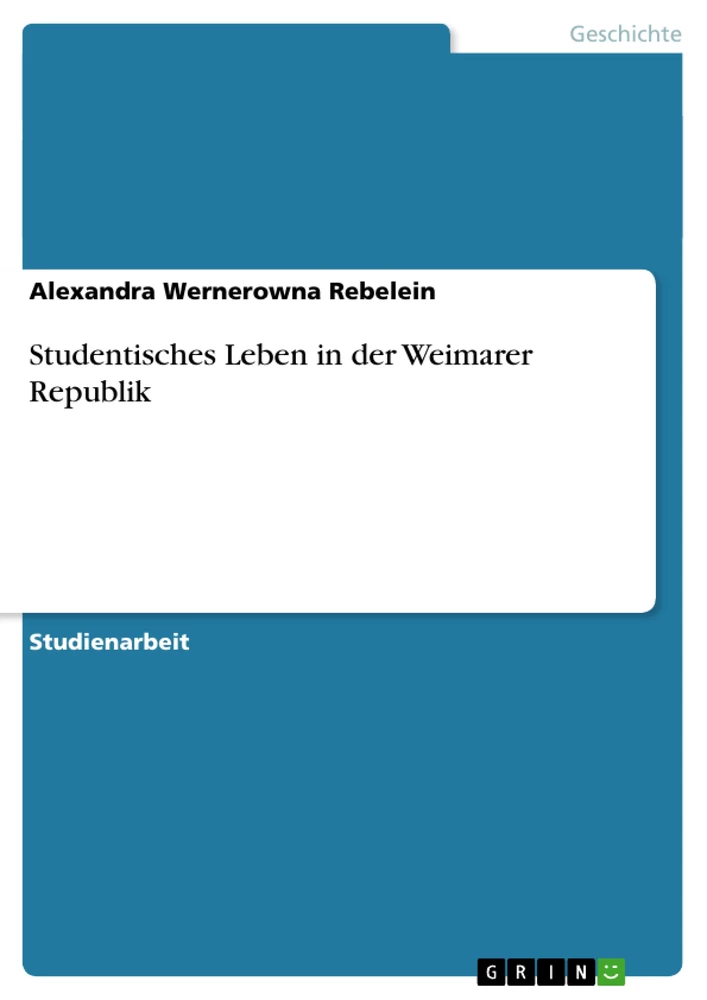Wie prägte die Weimarer Republik die akademische Jugend Deutschlands? Tauchen Sie ein in eine Zeit des Wandels, der Unsicherheit und des Aufbruchs, in der die deutsche Studentenschaft zwischen Tradition und Moderne, zwischen Kriegserlebnissen und dem Drang nach einer neuen Zukunft navigierte. Diese tiefgreifende Analyse beleuchtet die vielschichtige Welt der Studierenden in der Weimarer Republik, von ihren demografischen Merkmalen und ihrer sozialen Herkunft bis hin zu den drängenden finanziellen Nöten und den kreativen Selbsthilfeinitiativen, die aus der Not geboren wurden. Erfahren Sie, wie sich die Studentenzahlen nach dem Ersten Weltkrieg entwickelten, welche Fakultäten besonders beliebt waren und welchen Einfluss die soziale Herkunft auf den Bildungsweg hatte. Entdecken Sie die wachsende Bedeutung des Frauenstudiums und die Herausforderungen, mit denen Studentinnen in einer von Männern dominierten akademischen Welt konfrontiert waren. Das Werkstudententum, eine Notlösung zur Finanzierung des Studiums, wird ebenso thematisiert wie die Rolle von Stipendien und Darlehen. Ein besonderes Augenmerk gilt der "Wirtschaftshilfe der Deutschen Studentenschaft" und ihren Bemühungen, die Lebensbedingungen der Studierenden zu verbessern. Doch wie wirkten sich diese Umstände auf die politische Orientierung der Studenten aus? Welche Rolle spielten traditionelle Verbindungen und Korporationen? Und inwieweit trugen die erlebten Nöte zur Radikalisierung der Studentenschaft bei, die schließlich den Weg für den Nationalsozialismus ebnete? Diese facettenreiche Untersuchung bietet einen faszinierenden Einblick in eine entscheidende Epoche der deutschen Geschichte und wirft ein neues Licht auf die Lebensrealität der akademischen Jugend in der Weimarer Republik. Sie ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Hochschulgeschichte, Sozialgeschichte und die Ursachen des Nationalsozialismus interessieren. Erforschen Sie die Studentenschaft, das Frauenstudium, die Weimarer Republik, die Wirtschaftshilfe, das Werkstudententum und die soziale Herkunft der Studierenden in einer bewegten Zeit. Eine akademische Analyse, die zum Nachdenken anregt und neue Perspektiven eröffnet. Verpassen Sie nicht diese aufschlussreiche Reise in die Vergangenheit.
Inhalt
Vorwort
1. Die Studentenschaft in der Weimarer Republik
1.1. Studentenzahlen (Schema I)
1.2. Gliederung der Studierenden nach Fakultäten (Schema II)
1.3. Soziale Herkunft der Studierenden (Schema III)
1.4. Religiöse Zugehörigkeit der Studierenden (Schema IV)
1.5. Frauenanteil an der Gesamtstudentenschaft (Schema V)
1.6. Ausländerstudium
2. Student – sein in der Weimarer Republik
2.1. Studentische Selbsthilfe
2.1.1. Werkstudententum
2.1.2. Darlehen und Stipendien
2.2. Zur Lage der Studentinnen
SchlussbemerkungS
Literaturverzeichnis
Anlagen
Vorwort
Die Weimarer Republik soll hier im Hinblick auf ihre Wissenschaftspolitik näher beleuchtet werden, was durchaus ein Bild der gegebenen politischen und auch gesellschaftlichen Verhältnisse in ihrem Bestand und ihrer Entwicklung zeichnen kann. Die Universität und alle Gruppen und Institutionen, die ihr angehören, bildeten und bilden einen interessanten Teil der Gesellschaft und des Staates. Im Besonderen soll hier auf die Gruppe der Studierenden eingegangen werden.
Den ersten Teil der Untersuchung bildet eine Analyse der Studentenschaft in der Weimarer Republik in quantitativer und qualitativer Hinsicht. Es werden hier verschiedenste Teilaspekte einer Gesamtstudentenschaft näher beleuchtet, die ein Charakteristikum dieser Gruppe geben können.
In einem zweiten Teil wird versucht, anhand von v. a. der alltäglichen Problematiken wie Finanzierung der Lebenshaltung, Ernährung und Unterkunft ein Bild vom Leben der Studierenden in der Weimarer Republik zu zeichnen. Dabei wird auch insbesondere auf Institutionen wieWirtschaftshilfe der Deutschen Studentenschaftund dem Phänomen desWerkstudententumseingegangen.
Nicht eingegangen werden kann auf eine nähere Betrachtung der studentischen Verbindungen und politischen Gruppierungen der Studierenden, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
1. Die Studentenschaft in der Weimarer Republik
1.1. Studentenzahlen(Schema I)
Betrachtet man die Entwicklung der Studentenzahlen in der Zeit der Weimarer Republik, so kann man hier den im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts begonnenen, historisch neuartigen Wachstum[1]weiterverfolgen. Diese Entwicklung lässt sich für die Weimarer Zeit in einem Grundmuster verdeutlichen[2]. Die Zahl der Studierenden erfährt einen sprunghaft starken Anstieg in den Nachkriegsjahren bis 1923 (1914/15: 62.363 auf Universitäten und Technischen Hochschulen; 1918/19: 91.208; 1923/24: 102.180)[3], geht dann bis 1925 wieder teilweise zurück auf Vorkriegswerte (1925: 79.945)[4]und erfährt in der zweiten Hälfte der 20er Jahre und in den letzten Jahren der Republik einen nochmaligen vermehrten Zustrom (1931: 126.187)[5]. Konrad Jarausch gebraucht für diese Enzwicklung den Begriff des sog. „doppelgipfligen Freqenzwachstums“[6]und nennt mehrere Gründe und Erklärungen dafür:
Der erste Anstieg der Studentenzahlen war zunächst kriegsbedingt. Die zurückkehrenden „Kriegsstudenten“[7](ab 1915 waren 70 – 80 % aller Universitätsstudenten wegen der Teilnahme am Krieg beurlaubt[8]) nach dem Ende des 1. Weltkriegs prallten an den Universitäten auf eine Schar von Abiturienten, deren Zahl sich während des Krieges nicht verringert hatte. Zudem machte der „moderne“[9]Ausbau des Oberschulwesens für nun ganze 30% der Schüler den Zugang zur Hochschule möglich. Nach dem Ausscheiden der Kriegsstudenten verminderte sich die Zahl dann auch wieder.
Grundlegend für das Entwicklungsbild war das Frauenstudium[10].Die Zahl der Studentinnen wuchs seit ihrer Zulassung zum universitären Studium vor dem 1. Weltkrieg auch während des Krieges und danach stetig an[11].
Nicht zuletzt, eine kurzfristige Auswirkung der Weltwirtschaftskrise, verlängerte sich die Studienzeit durch schlechte Berufsaussichten, auch infolge von Ungleichgewicht bei Angebot und Nachfrage, um etwa 1/5, was den Begriff „Parkstudententum“[12]hervorbrachte.
1.2. Gliederung der Studierenden nach Fakultäten(Schema II)
Die Gliederung der Studierenden nach Studienfächern gestaltet sich mitunter schwierig, besonders in den wissenschaftlichen Disziplinen, die im frühen 19. Jahrhundert der umfassenden Philosophischen Fakultät angehörten[13]. Die philosophische Fakultät wurde als eine Art Sammelkategorie für alle Studierenden, die nicht in den anderen Fakultäten (Theologie, Jura, Medizin) unterzubringen waren angenommen. Mit dem Prozess der immer komplexer werdenden fachlichen Ausdifferenzierung wurde dieses überkommene Fakultätsgefüge bald gesprengt, so dass die Entwicklung seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zu einer institutionellen Auflösung der traditionellen Philosophischen Fakultät tendierte (jedoch auf der Ebene der Einzeluniversitäten sehr unterschiedlich; Tübingen gründete 1863 als erste deutsche Universität eine selbstständige Naturwissenschaftliche Fakultät, in Heidelberg wurde 1890 aus der Philosophischen Fakultät eine Naturwissenschaftlich – Mathematische Fakultät ausgegliedert; bis zum 2. Weltkrieg war die Zahl der Universitäten mit einer ungeteilten Philosophischen Fakultät in der Minderzahl[14]). Im Gegensatz zu den vier Einzelfächern Evang. Theologie, Kathol. Theologie, Jura und Allgemeine Medizin, wo die fachliche Klassifikation mit der Fakultätszugehörigkeit weitgehend übereinstimmte, lassen sich für die anderen Fächer erst ab 1925, mit der neu eingeführten Hochschulstatistik, relativ genau abgrenzen[15].
Die Verteilung der Studierenden auf die einzelnen Fakultäten und Studienfächer folgt einem zyklischen Muster[16], wobei die spezielle Dynamik in den einzelnen Fakultäten v. a. abhängig ist von den wechselnd guten bzw. schlechten Berufsaussichten der Absolventen[17].
1.3. Soziale Herkunft der Studierenden(Schema III)
Für die Darstellung der sozialen Schichtung der Studierenden werden hier der Beruf und die Berufsstellung des Vaters als maßgebendes Kriterium der Einteilung angenommen[18]. Zu bemerken ist bei Kindern von Beamten der Rückgang von aus oberen Beamtenfamilien stammenden Studenten von 1/5 auf 1/8, aber ein Zuwachs der Studenten aus mittleren Beamtenfamilien auf 1/3 und aus unteren Beamtenfamilien auf 1-3%[19]. Das hing damit zusammen, dass die Universität als Sprungbrett zur Karriere und damit als Aufstiegschance innerhalb der Mittelschicht, d.h. von der unteren zur mittleren und womöglich zur oberen usw. gesehen wurde und dieses Bestreben in der mittleren und unteren Mittelschicht gestiegen sein muss. Der Zuwachs der Studierenden aus Familien von Freiberuflern ist damit zu erklären, dass neue freie Berufe (außer Ärzten und Apothekern) hinzukamen.
Man kann also nach der Revolution von 1918 eine soziale Umstrukturierung der Studentenschaft feststellen, bei der die Zahl der Studierenden aus Kreisen der mittleren und unteren Beamten, Handwerker und Angestellten zunahm[20]. Der elitebewussten akademischen Oberschicht musste diese Entwicklung als „Inflation der Bildungsexklusivität“[21]vorgekommen sein. In einer Untersuchung des Bayrischen Statistischen Landesamtes von 1930 heißt es aber dazu: „Die akademischen Kreise ergänzen sich im Durchschnitt noch über die Hälfte aus sich selbst und der wirtschaftlichen Oberschicht, im übrigen aus den mittleren und unteren Volksklassen“[22], wovon der Mittelstand den Hauptteil ausmachte und die Arbeiterschaft nur sehr gering beteiligt war[23]. Jedoch war gerade diese mittlere und untere Mittelschicht in den Inflations- und Wirtschaftskrisenzeiten besonders anfällig.
1.4. Religiöse Zugehörigkeit der Studierenden(Schema IV)
Die Aufgliederung der Studierenden nach ihrer religiösen Zugehörigkeit entspricht in etwa dem jeweiligen Anteil der Kirchenzugehörigkeit in der Gesamtbevölkerung. So waren bei der Volkszählung 1925 ca. 60% der Bevölkerung dem evangelischen Glauben zugehörig und 30% dem katholischen Glauben[24].Dieses Bild spiegelt sich auch in der Universität wieder: etwa 60% der Studenten waren im SS 1925 der evangelischen Kirche angehörig und etwa 30% der katholischen Kirche[25]. Somit kann man hier weder von Bildungsunter- noch Bildungsüberrepräsentation sprechen.
Auffällig ist ein Anteil von über 5% Studierender jüdischen Glaubens[26]. Hier kann man allerdings von einer Bildungsüberrepräsentation der jüdischen Bevölkerung sprechen, die im Jahre 1925 einen Anteil von 1% an der Gesamtbevölkerung ausmachten[27].
Der Anteil der Studierenden anderer als dieser drei behandelten Glaubensrichtungen und Studierender ohne Bekenntnis zu einer Glaubensrichtung war dagegen verschwindend gering[28].
1.5. Frauenanteil an der Gesamtstudentenschaft(Schema V)
Bis zur Durchsetzung des Frauenstudiums war es ein weiter Weg, als sich um die Wende zum 19. Jahrhundert die öffentliche Meinung zu diesem Thema langsam wandelte. Fakten und Argumente für diesen Meinungswandel lagen allgemein und offenkundig auf der Hand[29]. Da war die als wachsendes Problem angesehene standesgemäße Unterbringung unverheirateter Töchter des Bürgertums. Die Frauenbewegung trug ebenfalls ihren Teil zu dieser Entwicklung bei. Außerdem musste man erkennen, dass das Deutsche Reich in dieser Hinsicht den Anschluss an den Rest Europas zu verpassen drohte, wo schon seit den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts Frauen an den Universitäten zugelassen waren. So konnten Beispiele einzelner Pionierinnen das Bild der Frau als Studentin und in akademischen Berufen langsam positiveren. Nicht zuletzt zählte auch das Argument, dass weibliche Ärzte benötigt würden, um weibliche Patientinnen behandeln zu können.
Zuerst eröffnete dann Baden 1899 den Frauen das Studium an seinen Universitäten Heidelberg und Freiburg, 1903 folgte Bayern, 1904 Württemberg und 1906 Sachsen, Preußen bildete hier 1908 das Schlusslicht[30].
Bis 1907 hatten 302 Frauen und Mädchen ein Studium an einer deutschen Universität begonnen[31]und ihre Zahl wuchs stetig an, so dass bis zum Ausbruch des 1. Weltkriegs ihr Anteil an der Gesamtstudentenschaft schon bei 7%[32]lag, was etwa 4.000 Studentinnen entsprach[33]. Auch während des Krieges, ist ein kontinuierlicher Anstieg des Frauenstudiums zu vermerken, der offizielle Anteil lag bei 9%[34]. Da aber ab 1915 70 – 80% aller Universitätsstudenten wegen der Teilnahme am Krieg beurlaubt waren[35], waren Frauen in der Realität des Vorlesungsbetriebes in viel höherem Maße repräsentiert. Im Allgemeinen war die Studiensituation während des Krieges durchaus angenehm: Die Hochschullehrer waren durch die geringe Zahl der tatsächlich Studierenden entlastet, so dass die gewonnene Zeit den verbleibenden Studenten zugute kam, die dann sehr gut betreut werden konnten und gute Arbeitbedingungen vorfanden[36].
Nach dem Ende des 1. Weltkriegs und in der Zeit der Weimarer Republik ging das stetige Wachstum der Studentinnenzahlen weiter voran: 1925 waren über 13% aller Studienanfänger weiblich, 1930 schon über 26% und 1932/33 sogar 29%[37]; allerdings erfuhr diese Entwicklung im Dritten Reich ein jähes Ende, schon im SS 1933 waren nur noch knapp 20% der Studienanfänger weiblich, im WS 1933/34 nur noch knapp 13%[38].
In den 20 Jahren des Frauenstudiums hatte sich ihr Anteil also um fast das Dreifache erhöht. Dieser überproportionale Anstieg rief in der sowieso schon durch Verunsicherung geprägten Stimmung der akademischen Kreise Besorgnis und kritische Stimmen hervor, denn die Frauen waren nicht zuletzt auch eine Konkurrenz auf dem ohnehin hoffnungslos überfüllten Arbeitsmarkt; auch sah man hier v. a. in den akademisch – bürgerlichen Kreisen die althergebrachte Geschlechterordnung durcheinander gebracht[39]. Sogar aus den eigenen Reihen der „Universitätsfrauen“[40]wurden Stimmen laut, die das „studieren aus Mode oder, weil man sonst nichts anzufangen weiß oder andere Berufsfelder überlastet sind“[41]kritisierten. So schrieb Dr. Hilde Grünbaum – Sachs 1924 in der ZeitschriftDie Studentin:
„Die Zukunft des Frauenstudiums ist nicht ein Problem der Quantität, sonder ein Problem der Qualität […]. Das Frauenstudium ist nicht erkämpft worden, damit die Frauen dieselben Fehler machen wie die Männer. Was diesem Kampf sein Ethos verlieh, war der Glaube an die Sonderaufgabe der Frauen auf dem Gebiet der höheren geistigen Arbeit […]. Um den Beruf einer Akademikerin wirklich auszufüllen, dazu gehört geistig überdurchschnittliche Begabung“[42].
1.6. Ausländerstudium
„Die statistischen Nachweisungen [des Ausländerstudiums] dürfen als Maßstab für die Wertung des deutschen Hochschulwesens im Ausland gelten“[43].
Dieses Zitat weist auf die damals allgemeine Erkenntnis der Wichtigkeit des Ausländerstudiums für die deutsche Universität und das Deutsche Reich überhaupt hin. Aufgrund dessen wurde seit 1927 an einigen Universitäten (München, Leipzig, Heidelberg, Frankfurt a. M., Bonn und Köln) örtliche selbstständige „akademische Auslandsstellen“[44]ins Leben gerufen. Diese Einrichtungen sollten zur Beratung und Förderung der ausländischen Studierenden dienen und bei ihrer Einführung in das deutsche geistige, kulturelle, künstlerische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben behilflich sein[45].
Insgesamt ist zwischen den Vorkriegsjahren und den letzten Jahren der Weimarer Republik (1929), eine rückläufige Entwicklung des Ausländerstudiums zu erkennen.
2. Student – Sein in der Weimarer Republik
„ Vor dem Krieg schien das Erbgut so gefestigt, dass Student – sein ein spielerisches Herumtummeln in den überlieferten Werten wurde, der Gegenwartsgenuss ein lebendiges Recht der heranwachsenden Jugend schien und die Zukunftsgestaltung den mehr oder weniger klaren Gesetzlichkeiten der Karriere als solche überlassen blieb“[46]
Die Zeit nach dem 1. Weltkrieg und der Weimarer Republik war im Allgemeinen geprägt durch Verunsicherung und Desorientierung. In sozialer Hinsicht ergab sich in den akademischen Kreisen und der Universität v. a. für die Studenten eine neue Lage[47]. Die missliche ökonomische Situation wurde im Besonderen für die Studierenden, die ja kein eigenes Einkommen hatten[48]von Semester zu Semester katastrophaler. Diese Zuspitzung der Umstände zwangen die Studierenden geradezu zu einem studentischen Selbsthilfeunternehmen. Auf demErlanger Studententag(1921) wurden die wichtigsten Punkte dieser studentischen Selbsthilfe definiert[49]. Die Knappheit an Zimmern führte zur Gründung von Wohnungsämtern und Studentenunterkünften. Hunger konnte in Studentenspeisungen und Mensen gestillt werden. Stipendien und Darlehen sollten die Studenten finanziell unterstützen[50].
2.1. Die „Wirtschaftshilfe der Deutsche Studentenschaft“
Schon kurz nach Kriegsende fanden sich an den Hochschulen „Allgemeine Studentenausschüsse“ (ASTA) als Gesamtvertretung der örtlichen Studentenschaft zusammen. Bald traf man sich auch auf dem ersten deutschen Studentenparlament in Würzburg (17. – 19. Juli 1919), eine Zusammenkunft und Institution, die erst ein republikanisches Staatsgefüge eröffnete[51]und den Zusammenschluss einer alle deutschen Studenten umfassenden „Deutschen Studentenschaft“ hervorbrachte[52]. Mit der Gründung der „Wirtschaftshilfe der Deutschen Studentenschaft“ am 19. Februar 1921 in Tübingen hatte sich eine Dachorganisation für die vielfältigen örtlichen Bestrebungen einer Studentischen Selbsthilfe institutionalisiert[53], die auf dem Erlanger Studententag 1921 ihre Zielsetzungen und Maßnahmen konstituiert hatte. Das sog.Erlanger Programmsah als die vornehmlichste der Bestrebungen die Bekämpfung der studentischen Not an. Die Aufgaben lagen v. a. in der Verbilligung der wesentlichen Bedürfnisse der Lebenshaltung, in einem studentischen Speisebetrieb auf gemeinwirtschaftlicher Basis, in der Einrichtung von Verkaufsstellen, Wäschereien usw. und in besonderem Maße in der Einrichtung und Organisation von Erwerbsvermittlungsstellen, denn man wollte keine „Almosen, sondern Selbsthilfe“[54].
All diese Maßnahmen waren unbedingt nötig, um das große Elend und die Not in die immer mehr Studierende gerieten abzuwenden.
„Wenn irgendetwas überhaupt die Notwendigkeit einer Studentischen Wirtschaftshilfe beweisen kann, so sind es einige nüchtere Zahlen, die mit eindringlichen Worten von der großen Not sprechen, die in den Kreisen der deutschen Hochschuljugend vorhanden und wie es scheint immer noch im wachsen begriffen ist“[55].
Fast 80% aller Studierenden lebten 1922 unter dem Existenzminimum und 30% bekamen monatlich nicht mehr als 200 Mark[56].
2.1.1. Werkstudententum
Die Idee des Werkstudententums entstand eigentlich aus eher idealen Beweggründen. Die Arbeit sollte den Akademiker wieder in die Mitte des Volkes zurückführen, um damit „den verantwortungsstarken, von sozialer Gesinnung erfüllten Menschen zu fördern, den Gegenwart und Zukunft brauchen“[57]. Der eigentliche Impuls war also eher ein sozialer als ein wirtschaftlicher. Die Studentenschaft sah hier eine Möglichkeit, sich auch in den neuen sozialen und politischen Gegebenheiten behaupten zu können und v. a. die Kluft zwischen Studierenden und Arbeiter zu verringern.
„Wenn aber Studenten ernst und schwer körperlich arbeiten müssen, um weiter studieren zu können, wenn sie bei der körperlichen Arbeit Seite an Seite mit dem Berufsarbeiter sein Schicksal teilen, sich in seine Art zu denken und seine Gedanken auszusprechen eingewöhnen, wenn sie einen Einblick in ihre eigenen Kämpfe und Probleme geben, dann kann das Misstrauen und der Hass schwinden und das vertrauen sich einstellen und der unglückselige Riss im Volke hie und da geschlossen werden. Der Student muss durch die Tat die körperliche Arbeit adeln, da wird der Arbeiter der geistigen Arbeit die Überlegenheit zugestehen, die ihr gebührt, ohne Missgunst und Hass.“[58]
Die Tätigkeiten für Werkstudenten lagen in allen denkbaren Zweigen und Unternehmen der deutschen Wirtschaft. Nach der Deutsche Hochschulstatistik wurden fünf Arten der Arbeit für einen Werkstudenten unterschieden: die Lehrtätigkeit, die Tätigkeit im Handel, in der Industrie, im Versicherungswesen, Verkehrs- und Bankwesen, die Bürotätigkeit, Arbeiten jeder Art und sonstige Beschäftigungen, insbesondere Tätigkeiten im erstrebten Beruf[59]. Die Durchschnittsarbeitszeit pro Jahr betrug für Werkstudenten 8 – 9 Wochen[60]. Die Bezahlung der Werkstudenten war geringer als für Hilfsarbeiter[61].
Das Werkstudententum entwickelte sich nun für viele Studenten von seiner anfänglich idealen Idee zu einer Notwendigkeit, um ihr Leben und ihr Studium finanzieren zu können. Im SS 1922 waren auf den Universitäten knapp 42% der Studierenden Werkstudenten, auf den Technischen Hochschulen knapp 62%[62].
Mit der wirtschaftlichen Stabilisierung nahm auch die Notwendigkeit der Werkarbeit ab, so dass 1925 nur noch knapp 10% aller Universitätsstudenten erwerbstätig waren[63]. Auch im Zusammenhang mit der wirtschaftlich besseren Lage der Republik nahm aber nun in der zweiten Hälfte der 20er Jahre die Studierendenzahl wieder zu[64], was einen ungemeinen Konkurrenzdruck auf dem zukünftigen Arbeitsmarkt bedeutete, der sich mit dem totalen Zusammenbruch der Weltwirtschaftskrise in eine Katastrophe verwandelte. Es bedeutete für die Studierenden nämlich weder Aussicht auf einen Beruf, noch auf Werkarbeit.
In seiner „pervertierten“[65]Form wurde das Werkstudententum auch zunehmend kritisiert, besonders im Hinblick auf Studentinnen, die arbeiten gehen mussten. Man forderte, dass die Universität wieder zu einer „Pflegestätte ernster wissenschaftlicher Arbeit“[66]werden solle. Es wurde die ungeheure Belastung des Körpers und Geistes bemängelt. Die Armut und dazu zusätzliche Belastung durch körperliche Arbeit wirkten sich ja auch negativ auf den Gesundheitszustand der Studierenden aus. Fehl- und Unterernährung waren keine Seltenheit. Besonders häufig waren Erkrankungen der Lunge, Zahnkrankheiten und Grippe. Im WS 1927/28 mussten etwa 25% der Studentinnen als nicht ganz gesund bezeichnet werden[67].
2.1.2. Darlehen und Stipendien
Eine weitere Art der Existentsicherung war es in den Genuss eines Darlehens oder Stipendiums zu kommen. Das galt v. a. für Studierende, die weder von zu Hause aus noch durch Werkarbeit oder von anderer Seite ihren Existenzbedarf decken konnten[68](neben Lebenshaltungskosten galt es auch für Studien- und Vorlesungsgebühren aufzukommen und den Kauf von Büchern zu ermöglichen).
Stipendien waren schon im Kaiserreich eine Möglichkeit, den akademischen Nachwuchs zu fördern oder sich eben fördern zulassen. Meist wurden diese Stipendien durch Familienstiftungen finanziert. Der Student, welcher sich in besonderer Weise auszeichnete, bekam bei Vorlage eines sog.testemonium paupertatisdie Zahlung der professoralen Honorare erlassen. Nach dem 1. Weltkrieg wurden dann auch staatliche Stipendien ins Leben gerufen[69].
1922 wurde dieDarlehenskasse der Deutschen Studentenschaftgegründet. Sie hatte zum Zweck und zur Aufgabe, „bedürftige, wissenschaftlich und menschlich bewährte Studenten durch Gewährung eines Darlehens in Examenssemestern von der täglichen Sorge um den Lebensunterhalt zu entlasten“[70]. Die Höhe des Darlehens richtete sich nach der Bedürftigkeit. Als Voraussetzung für die Gewährung, war ein Gutachten eines Hochschullehrers vorzulegen, bevor dann ein Auswahlgremium aus Vertretern der Studierenden, der Hochschullehrer und der Wirtschaft über die endgültige Vergabe des Darlehens entschied.
1925 wurde für ähnliche Zwecke, in ähnlicher Form dieStudienstiftung des deutschen Volkesgegründet[71]. Hier wurden v. a. besonders begabte Studenten während ihres Studiums unterstütz[72].
Die finanzielle Lage der Studierenden war aber nicht die einzige Misere ihres Daseins. Eine Knappheit an für ihre Verhältnisse geeigneten Zimmern und mangelnde ordentliche Ernährung machten die Studienzeit zu einer Zeit voller Entbehrungen.
Im Zusammenhang mit der Wohnungsnot wurde die Einrichtung von Studentenhäusern vorangetrieben. Diese sollten aber nicht nur ein Dach über dem Kopf bieten, sondern überhaupt den äußeren Rahmen der den Studenten zu Verfügung stehenden Räume vergrößern. Als besondere Aufgabe und Bedeutung des Studentenhauses wurde deshalb hier, mehr noch als die wirtschaftliche, die kulturelle Absicht als wichtig und dringend betont. Es sollte „den Studenten v. a. auch ein kulturelles Heim sein“[73].Und so wurden die Studentenhäuser auch eingerichtet: Den Kern bildete ein großer Speiseraum, daneben gab es v. a. Aufenthaltsräume und Lesesäle und dazu kamen noch Klubräume, die an studentische Vereine, aber auch an Außenstehende vermietet werden konnten. In diesen Räumlichkeiten also sollte in erster Linie der Austausch und die Kommunikation untereinander gefördert werden (nicht zuletzt im Hinblick auf die Entwicklung in RichtungMassenuniversitätundAnonymität des Studiums[74]). In zweiter Linie sollte das Studentenhaus natürlich auch „den vielen Studenten, die den Winter in ungeheizten Zimmern verbringen müssen, die Möglichkeit zum Arbeiten und zur Erholung bieten“[75].
Ein sehr schönes Beispiel aus der Not eine Tugend zu machen, bildet eine Form der Selbsthilfe in Leipzig. Dort hatten sich seit 1922 v. a. drei Studenten um die Studentenschaft und Studentenhilfe verdient gemacht: der Jurist Helmuth Volckmann, der Germanist Rudolf Thieme und der Chemiker und Biologe Kurt Mothes[76]. Rudolf Thieme hatte sich im Besonderen um die Fürsorgeeinrichtungen, die die verfallenen Stipendienstiftungen ersetzten mussten gekümmert. Herausragend ist die Leistung Kurt Mothes’, der eine in ihrer Art besondere Mensa in Leipzig „schuf“[77]. Mit Hilfe zweier Professorenfrauen baute er eine große und leistungsfähige Mensa auf, die bis zu 2000 Studierende verköstigen konnte. Seit 1921 hatte Mothes für diese Mensa große Lebensmittelspenden der nordsächsischen Landwirtschaft erwerben können und eine Reihe von Studierenden, die er seine „Helferschaft“[78]nannte wurden mit in das Projekt eingebunden. So entwickelte sich in Leipzig eine gut funktionierende und adäquat organisierte studentische Selbsthilfegruppe, aus etwa hundert Studenten und Studentinnen, die diesen Dienst ehrenamtlich, aber mit Begeisterung ob der Persönlichkeit Mothes’ übernahmen. Neben dem Mensaprojekt gab es noch einige „spezielle“[79]Projekte von Mothes: das Wohnungsamt, eine Leihbücherei, ein (Wander-) Kartenverleihamt, ein Theateramt, ein „Bettwäscheleihamt“ und u. a. auch ein „Akademisches Übersetzungs- und Dolmetscherbüro“, sowie die „Studentischen Arbeiterunterrichtskurse“[80].
All das kennzeichnet eine schöne Form der studentischen Selbsthilfe in Leipzig, die nicht in allen Universitätsstädten mit soviel Engagement betrieben wurde und über die ausgesprochen schlechte Situation nicht hinwegtäuschen kann.
2.2. Zur Lage der Studentinnen
Die sich gravierend zum Negativen verändernden Studienbedingungen wie schlechte materielle Situation, Wohnungsnot usw. trafen im Prinzip beide Geschlechter der Hochschuljugend schwer. Die weiblichen Studierenden trafen Inflation und Wirtschaftskrise aber viel schwerer. Das hatte verschiedene Gründe:
Studentinnen die von zu Hause nicht genügend unterstützt wurden, hatten es schwer andere Möglichkeiten der Existenzsicherung zu finden. Die Chance auf Arbeit als Werkstudent war äußerst gering, was v. a. am sehr begrenzten Spektrum der Möglichkeiten lag. Mehr als 70% der arbeitenden Studentinnen waren daher in der Lehrtätigkeit oder im Büro beschäftigt[81], oft nicht die rentabelste Arbeitsstelle und in begrenzter Weise gegeben, im Gegensatz zu den besser bezahlten Jobs in Fabriken o. ä. Von Organen wie der ZeitschriftDie Studentinwurde hier bemängelt, dass die Wirtschaftshilfe stark auf die Lebensführung der männlichen Studierenden ausgerichtet sei, die in ihren Stellenangeboten v. a. Arbeiten technischer Art vermittelten, die meist für die Studentinnen nicht in Frage kamen[82].
Mit den Bemühungen um ein Stipendium mussten Studentinnen oft ebenso erfolglos bleiben. In Tübingen z. B. sahen 1919 von 112 Familienstiftungen nur drei davon ausdrücklich auch Frauen als Bezugsberechtigte vor[83]. Bei der Darlehensvergabe sah es nicht viel anders aus. Dort wurden nur halb so viele Studentinnen gefördert, als es ihrem Anteil an der Gesamtstudentenschaft entsprochen hätte. Allerdings lassen sich hierfür durchschaubare Gründe aufführen: Die Darlehen wurden i. d. R. an höhere Examenssemester vergeben, unter denen sich weniger Frauen befanden, als in den Anfangssemestern, was v. a. daran lag, dass Frauen in höheren Semestern zu einem Zeitpunkt mit dem Studium begonnen hatten, als der Frauenanteil allgemein niedrig war, während er in den jüngeren Semestern stetig anstieg[84].
Außerdem konnte eine Studentin keinem Erwerb neben dem Studium nachgehen, wenn sie noch im elterlichen Haushalt wohnte, was ein hoher Prozentsatz der Studentinnen tat, denn im Allgemeinen hatten Eltern bei ihren Töchtern größere Bedenken über das „Allein – wohnen“[85]als bei ihren Söhnen. Rund 1/3 der Studentinnen verblieben nach einer Umfrage des Deutschen Akademikerbundes von 1927/28 am Heimatort. Im SS 1928 wohnten 51% der Studentinnen in Berlin und Hamburg noch zu Hause[86]. Dies bedeutet natürlich auch eine Einschränkung der Wahl der Fächerangebote, da nicht jede Universität dasselbe Spektrum an Fächer anbot oder eine bestimmte Fächerkombination ermöglichte. Wer noch zu Hause wohnte musste dann aber natürlich den Pflichten im Haushalt nachgehen und verbrachte auch seine Semesterferien mit Hausarbeit, während andere sich etwas dazuverdienen konnten.
Einige junge Mädchen wohnten aber nicht mehr im Elternhaus, doch auch für sie war es ein gravierendes Problem ein geeignetes Zimmer zu finden. Da Frauen viel weniger Möglichkeiten hatten, ihre freie Zeit außer Haus zu verbringen, erwarteten sie von ihrem Zimmer auch eine gewisse Wohnlichkeit. Sie wollten dort kleine Mahlzeiten selbst zubereiten können, in bescheidenem Rahmen Besuch empfangen können und mal einige kleine Kleidungsstücke selbst waschen und trocknen können[87]. Dazu kam die Einschränkung, dass Frauen in bestimmten billigeren Gegenden von vorne herein kein Zimmer nehmen durften, Männer hier aber eine günstige Möglichkeit zur Unterbringung fanden[88]. Auch die Erfahrung von Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt mussten viele Studentinnen bei ihrer Zimmersuche machen: „bei der Suche nach einem geeigneten Zimmer merk[ten] sie bald, dass sie als Mieterinnen weniger beliebt sind als ihre männlichen Kommilitonen“[89], was v. a. an der Mehrbeanspruchung der Frauen an das Zimmer und einer gewissen gesellschaftlichen Abneigung gegen das Frauenstudium lag. Aus dieser Problematik heraus kam es in den 20er Jahren zur Einrichtung von speziellen „Studentinnen“ – Wohnheimen. Daneben wurden für einen geringen Unkostenbeitrag oder umsonst auch „Studentinnen“ – Tagesheime zur Verfügung gestellt, wo sich die Frauen zwischen den Vorlesungen aufhalten konnten[90] (undenkbar, sie würden sich auf den Straßen oder in den Cafés „herumtreiben“[91]).
Schlussbemerkung
Die Darstellung der vielen Probleme, denen sich Studenten in der Weimarer Republik in ihrem täglichen Leben an der Universität und dem Staat stellen mussten lässt erahnen, was für eine Verunsicherung und auch Verbitterung gegenüber diesem System am Ende der 20er Jahre spätestens aufgekommen sein dürfte. Selbst eine studentische Selbsthilfe, die für das heutige studentische Leben als Vorreiter gelten muss, erreicht mit ihrer Arbeit zuwenig der Studierenden und konnte diese antirepublikanischen und antidemokratischen Strömungen in der Studentenschaft kaum aufhalten. Die Radikalisierung der Studentenschaft ist zu einem großen Teil bestimmt einer mangelnden Aufmerksamkeit für die studentischen und überhaupt hochschulischen Bedürfnisse und Belange des Staates zu erklären, jedoch scheint mir auch das traditionelle und in der Studentenschaft tief verwurzelte Verbindungs- und Koporationsstudententum, das keinerlei demokratische Erfahrung machen durfte ein wichtiger, wenn nicht der wichtigere Wegweiser in eine nationalsozialistische Studentenschaft zu sein.
Literaturverzeichnis
- Das Studentenhaus; in: Student und Hochschule; Jahrgang 1929, Nr. 1
- Die Tragik der deutschen Studentenschaft; in: Der Student, Deutsche Akademische Rundschau; Jahrgang 1925, Folge 18/ 19
- Ellwein, Thomas; Die deutsche Universität, Vom Mittelalter bis zur Gegenwart; Wiesbaden 1997
- Frank, Irene; „Ja das Studium der Weiber ist schwer“, Studentinnen und Dozentinnen an der Kölner Universität bis 1933; Katalog zur Ausstellung in der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln; Köln: M&T Verlag, 1995
- Geißler, Gerhard; Wirtschaftshilfe; in: Student und Hochschule, Nachrichtenblatt für deutsches Hochschulwesen; Hrsg. vom Vorstand des Deutschen Studentenverbandes; Jahrgang 1929, Nr.1
- Graven, Hubert; Gliederung der heutigen Studentenschaft nach statistischen Ergebnissen; in: Das akademischen Deutschland; Hrsg. von Doeberl, M./ Scheel, O./ Schlink, W./ Sperl, H.;
Berlin 1930; Bd.3
- Grünbaum – Sachs, Hilde; Zeitgemäße Betrachtungen zum Studium der Frauen; in: Die Studentin, Eine Monatsschrift 1, Nr. 10/11 (1924)
- Huerkamp, Claudia; Bildungsbürgerinnen, Frauen im Studium und in akademischen Berufen; Göttingen 1995
- Humbert, G.; Werkstudentinnen; in: Die Studentin; Jahrgang 1924, Nr.1
- Jarausch, Konrad; Deutsche Studenten 1800 – 1970; Frankfurt a. M. 1984
- Student und Republik; in: Deutsche Studenten auf dem Weg ins Dritte Reich; Hrsg. von Bleul, Hans Peter/ Klinnert, Ernst; Gütersloh 1967
- Titze, Hartmut; Das Hochschulstudium in Preußen und Deutschland 1820 – 1944; Göttingen 1987 (= Datenhandbuch zur deutschen Bildungsgeschichte Bd. 1)
- Titze, Hartmut; Hochschulen; In: Die Weimarer Republik und die nationalsozialistische
Diktatur; Hrsg. von Dieter Langwiesche, Heinz-Elmar Tenorth; München: Beck 1989 (=
Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte Bd. 5)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
[1]Titze, Hartmut; Hochschulen; In: Die Weimarer Republik und die nationalsozialistische Diktatur; Hrsg. von Dieter Langwiesche, Heinz-Elmar Tenorth; München: Beck 1989 (= Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte Bd. 5); S.?
[2]Jarausch, Konrad; Deutsche Studenten 1800 – 1970; Frankfurt a. M. 1984; S. 131 – 132
[3]Titze, Hartmut; Das Hochschulstudium in Preußen und Deutschland 1820 – 1944; Göttingen 1987 (= Datenhandbuch zur deutschen Bildungsgeschichte Bd. 1); S. 29 – 30
[4]Ebd.
[5]Ebd.
[6]Jarausch, Konrad; Deutsche Studenten; S. 129
[7]Ebd.
[8]Titze, H.; Hochschulen; 1989; S.?????
[9]Jarausch, Konrad; Deutsche Studenten; S.129
[10]Titze, H.; Hochschulen; 1989; S.?????
[11]Vgl. im Kap. 1.5. Frauenstudium; S. 7/8
[12]Jarausch, K.; Deutsche Studenten; S. 129
[13]Titze, H.; Das Hochschulstudium; 1987; S. 81 ff.
[14]Ebd.; S. 82
[15]Ebd.; S. 84
[16]Titze, H.; Hochschulen; 1989; S. ?
[17]Jarausch, K.; Deutsche Studenten; S.131
[18]Graven, Hubert; Gliederung der heutigen Studentenschaft nach statistischen Ergebnissen; in: Das akademischen Deutschland; Hrsg. von Doeberl, M./ Scheel, O./ Schlink, W./ Sperl, H.; Berlin 1930; Bd.3
[19]Ebd.
[20]Student und Republik; in: Deutsche Studenten auf dem Weg ins Dritte Reich; Hrsg. von Bleul, Hans Peter/ Klinnert, Ernst; Gütersloh 1967; S. 79
[21]Ebd.
[22]Ebd. S. 79 u. – 80 o.
[23]Ebd.
[24]Titze, H.; Das Hochschulstudium; 1987; S. 227
[25]Ebd.; S. 226 - 227
[26]Ebd.
[27]Ebd.
[28]Titze, H.; Das Hochschulstudium; 1987; S. 227
[29]Huerkamp, Claudia; Bildungsbürgerinnen, Frauen im Studium und in akademischen Berufen; Göttingen 1995; S. 75
[30]Ebd.
[31]Ebd.
[32]Ebd.
[33]Bei Hartmut Titze sind es in den letzten fünf Kriegsjahren 3 – 6% (Titze, H.; Hochschulen; 1989; S. ?); eine nur geringe Abweichung zu Huerkamp
[34]Huerkamp, C.; Bildungsbürgerinnen; S. 78
[35]Titze, H.; Hochschulen; 1989; S. ?
[36]Huerkamp, C.; Bildungsbürgerinnen; S.78
[37]Titze, H.; Das Hochschulstudium; 1987; S. 189
[38]Ebd.
[39]Huerkamp, C.; Bildungsbürgerinnen; S. 78/79
[40]Hervorhebung von mir, A.R.
[41]Grünbaum – Sachs, Hilde; Zeitgemäße Betrachtungen zum Studium der Frauen; in: Die Studentin, Eine Monatsschrift 1, Nr. 10/11 (1924); S. 135 - 138
[42]Ebd.
[43]Graven, H.; Gliederung der heutigen Studentenschaft
[44]Graven, H.; Gliederung der heutigen Studentenschaft
[45]Ebd.
[46]Die Tragik der deutschen Studentenschaft; in: Der Student, Deutsche Akademische Rundschau; Jahrgang 1925, Folge 18/ 19; S. 5
[47]Ellwein, Tohmas; Die deutsche Universität, Vom Mittelalter bis zur Gegenwart; Wiesbaden 1997; S. 230
[48]Ebd.; S. 271 – 271., T66
[49]Student und Republik; Bleul, H.-P/ Klinnert, E. (Hrsg.); S.80
[50]Jarausch, K.; Deutsche Studenten; S. 142
[51]Titze, H.; Hochschulen; 1989; S.???
[52]Ellwein, T.; Die deutsche Universität; T66, S.272
[53]Titze, H.; Hochschulen; 1989; S. ?????
[54]Ellwein, T.; Die deutsche Universität; S. 273
[55]Geißler, Gerhard; Wirtschaftshilfe; in: Student und Hochschule, Nachrichtenblatt für deutsches Hochschulwesen; Hrsg. vom Vorstand des Deutschen Studentenverbandes; Jahrgang 1929, Nr.1; S. 8
[56]Ellwein, T.; Die deutsche Universität; T67, S. 274
[57]Geißler, G.; in: Student und Hochschule; Jahrgang 1929, Nr.2, S.26
[58]Ellwein, T.; Die deutsche Universität; T67, S.276
[59]Graven, H.; Gliederung der heutigen Studentenschaft; S.????
[60]Bleul, H.P./Kinnert, E.; Student und Republik; S. 80
[61]Ebd.
[62]Ebd.
[63]Ebd.; S.81
[64]Vgl. Anm. 5; Titze, H.; Das Hochschulstudium; 1987; S. 29 - 30
[65]Hervorhebung von mir, A.R.
[66]Humbert, G.; Werkstudentinnen; in: Die Studentin; Jahrgang 1924, Nr.1, S.11 - 12
[67]Huerkamp,C.; Bildungsbürgerinnen; S. 130
[68]Bleul, H.P./Kinnert, E.; Student und Republik; S. 80
[69]Anm. 67; S. 139
[70]Ebd.
[71]Huerkamp,C.; Bildungsbürgerinnen; S. 139
[72]Ellwein, T.; Die deutsche Universität; S. 231
[73]Das Studentenhaus; in: Student und Hochschule; Jahrgang 1929, Nr. 1; S.58
[74]Hervorhebung von mir, A.R.
[75]Das Studentenhaus; in: Student und Hochschule; Jahrgang 1929, Nr. 4; S.57
[76]Ellwein, T.; Die deutsche Universität; T68, S. 277
[77]Ellwein, T.; Die deutsche Universität; T68, S. 278
[78]Ebd.
[79]Hervorhebung von mir, A. R.
[80]Ellwein, T.; Die deutsche Universität; T68, S. 278
[81]Huerkamp,C.; Bildungsbürgerinnen; S. 138
[82]Frank, Irene; „Ja das Studium der Weiber ist schwer“, Studentinnen und Dozentinnen an der Kölner Universität bis 1933; Katalog zur Ausstellung in der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln; Köln: M&T Verlag, 1995
[83]Huerkamp, C.; Bildungsbürgerinnen; S. 139
[84]Ebd.; S.141
[85]Hervorhebung von mir, A.R.
[86]Frank, Irene; „Ja das Studium der Weiber ist schwer“; S. 42
[87]Huerkamp, C.; Bildungsbürgerinnen; S. 130
[88]Ebd.
[89]Frank, Irene; „Ja das Studium der Weiber ist schwer“; S. 42 - 43
[90]Huerkamp, C.; Bildungsbürgerinnen; S. 132
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Analyse der Studentenschaft in der Weimarer Republik?
Diese Analyse beleuchtet die Studentenschaft in der Weimarer Republik, indem sie quantitative und qualitative Aspekte untersucht. Sie konzentriert sich auf die Zusammensetzung der Studentenschaft, ihre soziale Herkunft, religiöse Zugehörigkeit, den Frauenanteil und die Situation ausländischer Studierender.
Wie entwickelten sich die Studentenzahlen während der Weimarer Republik?
Die Studentenzahlen erlebten in den Nachkriegsjahren bis 1923 einen starken Anstieg, gefolgt von einem Rückgang bis 1925 und einem erneuten Anstieg in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre und den letzten Jahren der Republik. Dieser "doppelgipflige Freqenzwachstum" wurde durch Faktoren wie die Rückkehr der "Kriegsstudenten", den Ausbau des Oberschulwesens und das wachsende Frauenstudium beeinflusst.
Wie war die Studentenschaft nach Fakultäten gegliedert?
Die Gliederung der Studierenden nach Studienfächern war komplex, insbesondere in den wissenschaftlichen Disziplinen der Philosophischen Fakultät. Die Verteilung der Studierenden auf die einzelnen Fakultäten und Studienfächer folgte einem zyklischen Muster, das von den Berufsaussichten der Absolventen beeinflusst wurde.
Welche Rolle spielte die soziale Herkunft der Studierenden?
Nach der Revolution von 1918 gab es eine soziale Umstrukturierung der Studentenschaft mit einem Anstieg der Studierenden aus Familien von Beamten, Handwerkern und Angestellten. Dies führte zu einer "Inflation der Bildungsexklusivität", da die traditionelle akademische Oberschicht einen geringeren Anteil an der Studentenschaft hatte.
Wie verteilte sich die religiöse Zugehörigkeit der Studierenden?
Die religiöse Zugehörigkeit der Studierenden entsprach weitgehend dem Anteil der Kirchenzugehörigkeit in der Gesamtbevölkerung. Allerdings war der Anteil jüdischer Studierender überproportional hoch.
Wie entwickelte sich der Frauenanteil an der Gesamtstudentenschaft?
Der Frauenanteil an der Studentenschaft stieg seit der Zulassung von Frauen zum Universitätsstudium vor dem Ersten Weltkrieg stetig an. Im Dritten Reich erfuhr diese Entwicklung ein jähes Ende.
Was war das "Ausländerstudium" und warum war es wichtig?
Das Ausländerstudium galt als Maßstab für die Wertschätzung des deutschen Hochschulwesens im Ausland. Einige Universitäten richteten "akademische Auslandsstellen" ein, um ausländische Studierende zu beraten und zu fördern.
Wie gestaltete sich das Leben der Studierenden in der Weimarer Republik?
Das Leben der Studierenden in der Weimarer Republik war geprägt von Verunsicherung und Desorientierung. Die missliche ökonomische Situation zwang die Studierenden zu studentischer Selbsthilfe.
Welche Rolle spielte die "Wirtschaftshilfe der Deutschen Studentenschaft"?
Die "Wirtschaftshilfe der Deutschen Studentenschaft" war eine Dachorganisation für die vielfältigen örtlichen Bestrebungen einer Studentischen Selbsthilfe, die auf dem Erlanger Studententag 1921 ihre Zielsetzungen und Maßnahmen konstituiert hatte. Sie hatte sich zum Ziel gesetzt die studentische Not zu bekämpfen.
Was war das "Werkstudententum"?
Das Werkstudententum entstand aus idealen Beweggründen, um den Akademiker wieder in die Mitte des Volkes zurückzuführen. Später wurde es für viele Studenten eine Notwendigkeit, um ihr Leben und ihr Studium finanzieren zu können.
Wie war die Situation für Studentinnen in der Weimarer Republik?
Studentinnen hatten es oft schwerer als ihre männlichen Kommilitonen, da sie weniger Möglichkeiten zur Existenzsicherung hatten und Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt erfuhren.
- Quote paper
- Alexandra Wernerowna Rebelein (Author), 2002, Studentisches Leben in der Weimarer Republik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107576