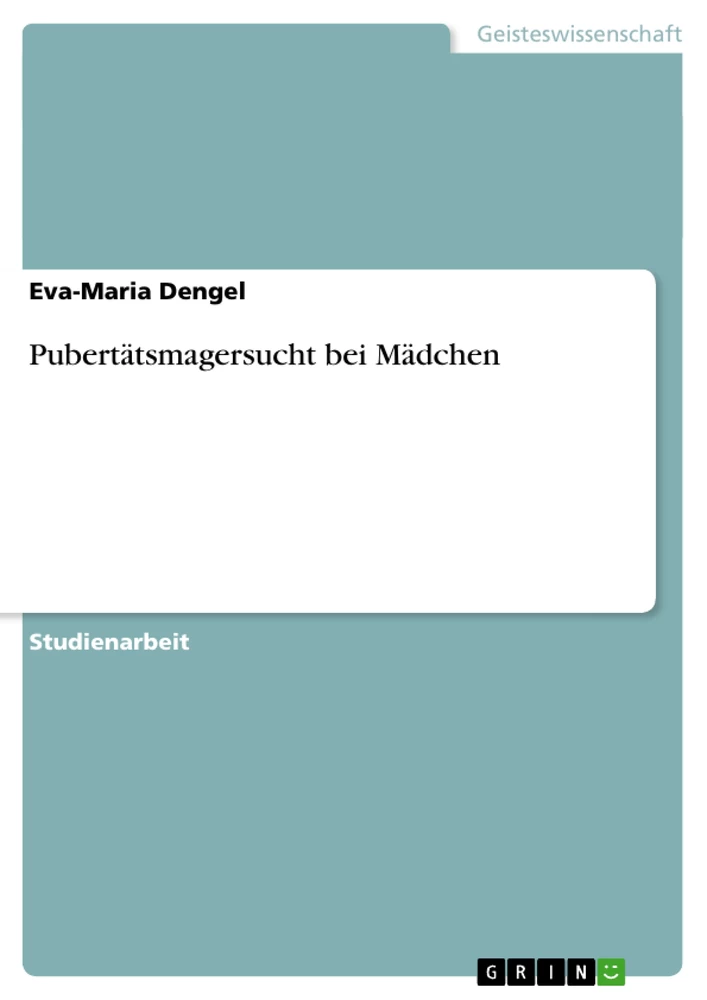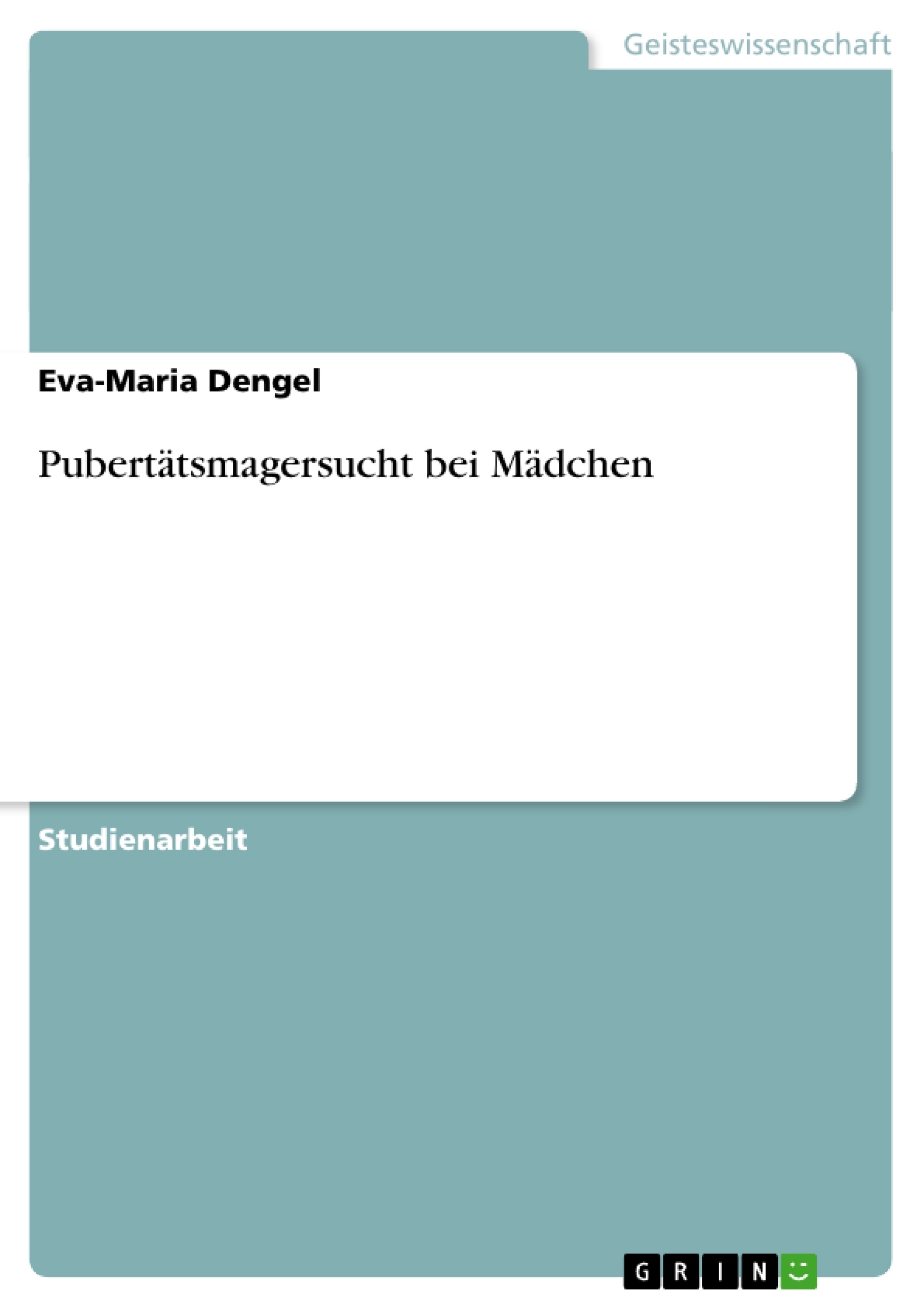Gliederung
I. Einleitung
II. Hauptteil
Kapitel 1: KRANKHEITSBESCHREIBUNG
1.1 Definition des Syndroms
1.2 Symptome und Anzeichen
1.3 Krankheitsverlauf
Kapitel 2: URSACHEN DER ANOREXIA NERVOSA
2.1 Gesellschaftliche Einflüsse
2.2 Soziokulturelle Aspekte
2.3 Familiäre Einflüsse
2.4 Sinn der Magersucht
Kapitel 3: FOLGEN DER ANOREXIA NERVOSA
3.1 Körperliche Folgen
3.2 Psychische Folgen
3.3 Soziale Folgen
III. Schlussteil
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Einleitung
Essstörungen, vor allem Magersucht und Bulimie (Anorexia und Bulimia nervosa), sind in unserer heutigen Gesellschaft vor allem bei Mädchen und jungen Frauen gut bekannt und rücken immer mehr in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Auch Männer sind von dieser Krankheit betroffen, jedoch weitaus seltener als Frauen.
Neben unzähligen Diättipps in Zeitschriften und Schlankheitsprodukten beeinflussen uns auch Lebensmittelhersteller mittels ausgefeilter Werbung.
"Es ist unglaublich, wie manche Leute versuchen, ihre Produkte an den Mann (bzw. die Frau) zu bringen!" denke ich manchmal, wenn ich mir eine bekannte Frauenzeitschrift kaufe und auf der einen Seite über die "Superdiät" staune, die verspricht "In nur 2 Wochen 5 Kilo leichter!" zu werden, und auf der anderen Seite eine junge Frau genüsslich das "Eis des Jahres" verzehren sehe.
Doch dann fällt mir auf, dass es funktioniert. Es wird nicht nur versucht, mit solchen Dingen Geld zu machen, es wird wirklich verdient. Selbst ich kaufe mir diese Zeitschrift, und wahrscheinlich werde ich auch das "Eis des Jahres" probieren. Doch wie schafft es die Frau trotz Nascherei so schön schlank zu bleiben? Also muss ich auch die Diät auf der gegenüberliegenden Seite ausprobieren. Es hört sich immerhin sehr vielversprechend an, fünf Kilo in zwei Wochen abzunehmen.
So denken wahrscheinlich sehr viele junge Frauen. Nahrungsmittelüberangebot auf der einen und Schlankheitswahn auf der anderen Seite - viele Mädchen und Frauen finden nicht den (im wahrsten Sinne des Wortes) "gesunden" Mittelweg - und erkranken letztendlich an einer Essstörung.
In meiner Studienarbeit werde ich versuchen, vor allem Ursachen und Folgen von Essstörungen, insbesondere der Anorexia nervosa, zu verdeutlichen.
Auf die zahlreichen Therapieformen werde ich hier nicht eingehen, jedoch finden sie im Anhang dazu unter "Weiterführende Literatur" einige Buchtipps.
Hauptteil
Kapitel 1 KRANKHEITSBESCHREIBUNG
1.1 Definition des Syndroms
Die Anorexia nervosa (=Pubertätsmagersucht) ist eine Krankheit, eine Form von Essstörungen.
„Von Eßstörungen spricht man, wenn die Beschäftigung mit Nahrung im Leben einer Person einen übermäßig großen Raum einnimmt – wenn die Gedanken vorrangig um das Essen kreisen und alle anderen Dinge des Lebens nebensächlich werden“ (Harland, Siegel 1996, S.10).
Anorexia ist zwar der medizinische Begriff für Appetitverlust, jedoch leiden Magersüchtige in Wirklichkeit nicht an Appetitlosigkeit; sie sind hungrig, weigern sich aber zu essen.
Der Begriff „Pubertätsmagersucht“ leitet sich davon ab, dass der Großteil der von dieser Krankheit Betroffenen junge Frauen in der Zeit der Pubertät oder der Nachpubertät sind. Als Sucht wird diese Form der Nahrungsverweigerung bezeichnet, da die Gedanken an das Essen stets gegenwärtig sind und die Beschäftigung mit Nahrung, Gewicht und Kalorien wie zu einer Sucht wird; es ist sozusagen eine „Sucht nach Magerheit“, vergleichbar mit Alkoholismus oder Rauchen – in allen Fällen sind die Betroffenen abhängig.
Die Magersucht entsteht dadurch, dass die Betroffene von dem Wunsch besessen ist, abzunehmen um dem Schönheitsideal zu entsprechen. Während ihrer Krankheit wird sie dieses Ziel in ihren Augen jedoch nie erreichen, da sie sich trotz fortschreitendem Gewichtsverlust immer für zu dick halten wird; auch dann noch, wenn sie extrem untergewichtig ist und in den Augen anderer als krankhaft dünn bezeichnet wird.
1.2 Symptome und Anzeichen
Das Verhalten von Magersüchtigen (=Anorektikerinnen) beschreibt am besten die Symptome und Anzeichen ihrer Krankheit.
Aufgrund der Unterernährung bekommen Magersüchtige mit der Zeit Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, werden depressiv, gereizt und aggressiv – vor allem dann, wenn sie auf ihre extreme Gewichtsabnahme angesprochen werden. Denn obwohl sie auf jedes verlorene Pfund stolz sind, versuchen sie z. B. durch weite Kleidung ihren abgemagerten Körper zu verstecken. Das Verheimlichen des Gewichtes und der Gewichtsabnahme und das Leugnen von Hungergefühlen, Müdigkeit und Abgeschlagenheit sind zwei Hauptmerkmale Magersüchtiger.
Doch die Kranken streiten nicht nur ihre Erschöpfung ab, sie legen darüber hinaus ein extrem aktives Verhalten an den Tag, z. B. indem sie übermäßig viel Sport treiben (vgl. Harland, Siegel 1996, S.18).
In engeren Kreisen, z. B. in der Familie, ist häufig zu beobachten, dass die Betroffene versucht, gemeinsame Mahlzeiten so oft es geht zu vermeiden. Um Ausreden sind Magersüchtige nicht verlegen; so behaupten sie, in der Schule, unterwegs oder bei Freunden bereits gegessen zu haben – was selbstverständlich nicht den Tatsachen entspricht. Anorektikerinnen ziehen es vor, alleine zu essen – was meistens darauf hinausläuft, dass sie gar nicht oder nur sehr wenig Nahrung zu sich nehmen (vgl. Gerlinghoff, Backmund 1999, S.43). Als „Ersatz“ für die ausgelassenen Mahlzeiten gewöhnen sich viele an, Unmassen von Flüssigkeit zu trinken – natürlich alles ohne Kalorien, wie z. B. Mineralwasser, ungesüßten Tee oder Kaffee. Die seltenen Mahlzeiten sind durch ein auffälliges Essverhalten gekennzeichnet. So sind bei Magersüchtigen das Löffeln von Flüssigkeiten, z. B. Suppen, Essen mit Stäbchen, extrem langsames Essen und langes Kauen und endloses Mischen und Zerkleinern der Nahrung sehr beliebt um nicht zu viele Kalorien zu sich zu nehmen (vgl. Gerlinghoff, Backmund 1999, S.39).
Doch nicht nur durch eine drastische Ernährungsumstellung versuchen Magersüchtige ihr Ziel, „die Schlankste“ zu sein, zu erreichen, sondern sie wollen durch zusätzlichen Energieverbrauch die Gewichtsabnahme noch beschleunigen, d. h. mehr Kalorien verbrauchen als zuführen, z. B. indem sie Fahrstühle und Rolltreppen meiden, ihren Schlaf reduzieren oder ihre sportlichen Aktivitäten intensivieren (vgl. Gerlinghoff, Backmund 1999, S.42 f).
Abgesehen von dem Verhalten magersüchtiger junger Frauen ist eines der Hauptsymptome bei der Diagnose Anorexia nervosa das „Nichteinsetzen oder Ausbleiben der Menstruation. Wir sprechen von primärer oder sekundärer Amenorrhoe“ (Gerlinghoff 1996, S.13).
1.3 Krankheitsverlauf
Heutzutage scheint es „ungewöhnlich zu sein, wenn eine junge Frau mit ihrer Figur zufrieden ist und noch keine Fastenkur gemacht hat“ (Gerlinghoff, Backmund 1999, S.38). Fast jedes junge Mädchen entschließt sich eines Tages dazu, abzunehmen, um ihrem Schönheitsideal näherzukommen. Diäten im Pubertätsalter sind längst nichts Außergewöhnliches mehr. Wenn die Abnehmende jedoch nach dem Erreichen ihres Wunschgewichtes nicht zu ihrem gewohnten Essverhalten weitgehend zurückkehrt sondern weiterhungert, ist sie nicht weit davon entfernt, an Magersucht zu erkranken.
Gerlinghoff und Backmund beschreiben den Verlauf der Anorexia nervosa folgendermaßen: Alles beginnt mit einer „harmlosen“ Diät, die jedoch über den natürlichen Zeitrahmen hinausgeht. Die Betroffenen definieren für sich immer wieder ein neues, niedrigeres Wunschgewicht, erreichen dieses – und hungern weiter. Sie sind stolz auf ihre erbrachte Leistung, auf das Erreichen ihres Zieles, und gerade das ermutigt sie dazu, weiterzumachen, das nächste Ziel zu erreichen.
Der Abstand zwischen Untergewicht und Idealgewicht vergrößert sich fortlaufend, und schließlich "hat sich die Gewichtsabnahme verselbständigt und ist zur Leistung geworden" (Gerlinghoff, Backmund 1999, S.38). Die anfänglichen Ziele, wie z. B. ein flacher Bauch, dünnere Beine oder Attraktivität wurden abgelöst von dem einen Ziel "die Dünnste" zu sein. Es gibt unterschiedliche "Hungerpraktiken", wie z. B. Mahlzeiten auslassen, die Ernährung auf Rohkost umstellen oder Unmassen von Flüssigkeit zu sich nehmen. Im Laufe der Zeit entwickeln fast alle Magersüchtigen ihre eigenen Essensrituale und Kontrollmaßnahmen, um die Gewichtsabnahme sicherzustellen.
Viele Magersüchtige wollen nicht nur durch Hungern Leistung erbringen, sondern z.. B. auch durch übertriebene Hausarbeit oder gute schulische und sportliche Leistungen. Die Betroffenen wollen Anerkennung finden, und so wandelt sich normale Leistungserbringung in Leistungszwang, der von diesem Zeitpunkt an den Tagesablauf bestimmt und das Krankhafte offensichtlich macht. Der extreme Leistungszwang, vor allem in den übertriebenen sportlichen Aktivitäten, ist schon lange nicht mehr gesundheitsfördernd – er geht langsam in Gesundheitsschädigung und schließlich in Selbstzerstörung über, wenn Schwindel, Schwäche, Frieren und andere negative Anzeichen ignoriert und nicht als Warnsignale des Körpers verstanden werden (vgl. Gerlinghoff, Backmund 1999, S. 38-41).
Symptome und Anzeichen der Magersucht (siehe 1.2) werden oft von Angehörigen oder Freunden nicht oder zu spät erkannt, mitunter weil die Anorektikerinnen bewusst versuchen, ihre Krankheit zu verheimlichen. Die Betroffenen leiden meist jahrelang unter ihrer Krankheit, bevor sie sich einer notwendigen Therapie unterziehen.
Kapitel 2 URSACHEN DER ANOREXIA NERVOSA
Essstörungen haben nicht nur eine Ursache. Bei der Entwicklung einer solchen Krankheit wirken unter anderem gesellschaftliche Einflüsse, soziokulturelle Aspekte, familiäre Einflüsse und die Persönlichkeit der Betroffenen zusammen.
2.1 Gesellschaftliche Einflüsse
Die Gesellschaft, in der wir leben, hat großen Einfluss darauf, ob es überhaupt möglich ist, an Magersucht zu erkranken. Zum Beispiel in Ländern, in denen Nahrungsmangel herrscht, gibt es keine Magersucht. Essstörungen sind an Überfluss gebunden, d. h. Magersucht oder Bulimie treten nur dort auf, wo Lebensmittel keine Mangelware sind, sondern zu jeder Zeit und in jedem Maß verfügbar.
Inzwischen hat sich die Magersucht über alle sozialen Schichten ausgebreitet, doch früher hatten Angehörige von ärmeren Schichten nicht genug zu essen, um magersüchtig werden zu können. Magersucht bedeutet freiwilliger Verzicht auf Nahrung und kommt deshalb dort nicht vor, wo viele Menschen hungern müssen, d. h. wo der Verzicht auf Nahrung nicht mehr freiwillig, sondern durch äußere Verhältnisse erzwungen ist (vgl. Gerlinghoff, Backmund 1999, S.67).
In unserer heutigen Gesellschaft ist der Wunsch, schlank zu sein, schon längst Teil unseres täglichen Lebens geworden. Es vergeht kein Tag, an dem man nicht wenigstens durch ein Plakat an der Bushaltestelle auf einen neuen Diätdrink hingewiesen wird.
Auch im Fernsehen wird schon seit geraumer Zeit für Diätprodukte geworben, und diese Reklame bedient sich stets neuer Tricks; unter anderem wird suggeriert, dass bereits junge Mädchen Diät halten sollten.
Das Fernsehen ist eines der einflussreichsten Kommunikationsmittel und ein in unserer visuell orientierten Gesellschaft weit verbreitetes, beliebtes Medium, dass zahlreiche Kinder bereits in jungen Jahren durch die hypnotische Macht von Bildern prägt.
In unserer gegenwärtigen Fernsehlandschaft überwiegt die schlanke Körperform, was den Zuschauern eine eindeutige Botschaft übermittelt, nämlich dass erfolgreiche Menschen schlank sind.
Diese Aussage hat starken Einfluss auf Überzeugungen und Verhalten der Zuschauer. Die Schauspielerinnen werden bewundert, beneidet und sind Vorbild für viele junge Mädchen (vgl. Valette 1990, S. 17-19).
Jeder will in irgendeiner Weise einem Schönheitsideal entsprechen – auch wenn die Vorstellungen von Schönheit teilweise sehr weit auseinander liegen, haben die Ideale eines gemeinsam: sie sind schöner, perfekter als man selbst, und meistens sind sie auch schlanker. Es gibt viele Abmagerungswillige, aber die Zahl derer, die auf dem Weg zu ihrer Traumfigur nicht scheitern, ist eher klein. Einen Teil dieser Minderheit bilden die später Magersüchtigen (vgl. Gerlinghoff, Backmund 1999, S.67).
Bei vielen Anorektikerinnen spielt der Stolz auf die erbrachte Leistung und die Bewunderung der anderen eine Rolle beim Einstieg in die Krankheit. Der Übergang vom erfolgreichen Hungern zum magersüchtigen Verhalten ist oft fließend und wird selbst von den Betroffenen oft nicht wahrgenommen. Es findet eine Entwicklung hin zur Magersucht statt, es ist nicht wie ein spontaner Einfall. Das Verlangen, nach einem erreichten Wunschgewicht weiterzuhungern, hat viele Gründe. Oft sind es positive Gefühle und Erfahrungen wie die Bewunderung der Eltern, die, auch wenn sie in Sorge umschlägt, stets als positiv empfunden wird und die Betroffene zum Weiterhungern veranlasst.
Auch das Erleben des Hungergefühls, das als Spüren des eigenen Körpers wahrgenommen wird, kann durchaus als wohltuend empfunden werden. Wie schon erwähnt, spielt auch Stolz bei der Erkrankung eine Rolle; der Stolz über die Kontrolle des Hungertriebes und der Stolz über die Gewichtsabnahme bewirken ein Glücksgefühl, das die Magersüchtige zum Weiterhungern animiert – und spätestens ab diesem Zeitpunkt, "wenn aus dem Hungergefühl das Bewußtsein erwächst, etwas Elitäres zu sein" (Gerlinghoff, Backmund 1999, S.68), ist die Grenze zwischen einer gesunden Diät und einer krankhaften Sucht überschritten (vgl. Gerlinghoff, Backmund 1999, S.68).
2.2 Soziokulturelle Aspekte
Mitverantwortlich für das häufige Auftreten von Anorexia nervosa in unserer Zeit sind soziokulturelle Aspekte wie die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft und das Aufwachsen in Kleinfamilien.
Viele Magersüchtige wollen die Rolle als Frau, wie sie ihnen von ihren Müttern vorgelebt wird, nicht annehmen. Sie haben Angst davor, ihr Leben könnte nur aus Verzicht und Opfern der Familie zuliebe bestehen. Ihre Mütter scheinen oft nicht erfüllt oder glücklich, wirken oft verstimmt, lustlos, missmutig und haben Migräne. Diese Unzufriedenheit entsteht aus dem Gefühl des Unerfülltseins und der Angst, etwas versäumt zu haben. Das Dasein als Frau wird von den Magersüchtigen oft als Benachteiligung empfunden. Die meisten Mütter von Anorektikerinnen identifizieren sich nur scheinbar mit der Rolle der Frau, die ihnen von der Gesellschaft praktisch aufgedrängt wird. Ihre Töchter jedoch können hinter die Maske sehen und spüren das Unglücklichsein ihrer Mütter. Dadurch wächst die Angst, das gleiche Schicksal zu "erleiden".
Eine Betroffene berichtet: "Ich wußte, daß ich als Frau nicht mein eigenes Leben leben kann. Mir wurde jede Mündigkeit, jedes eigenverantwortliche Handeln als Mädchen abgesprochen. Meine Mutter war mir ein lebendes Beispiel dafür, was mich als Frau erwartete; das machte mir angst und schreckte mich ab" (Gerlinghoff, Backmund 1999; S.70).
Viele Magersüchtige träumen davon, es einmal ganz anders zu machen als ihre Mütter. Sie wollen erfolgreich sein und träumen von einer steilen Karriere. Sobald sie aber die Diskrepanz zwischen ihrem Traumbild und der Realität erkennen, geben sie verzweifelt auf und schaffen sich eine eigene Welt mit eigenen Gesetzen: die Welt des Hungerns.
Anorektikerinnen sehen den Sinn der Magersucht unter anderem in dem Protest gegen die Rolle der Frau, wie sie in unserer Gesellschaft definiert ist. Dies bedeutet jedoch nicht die gänzliche Ablehnung von Frausein und Sexualität (vgl. Gerlinghoff, Backmund 1999, S.69-73).
2.3 Familiäre Einflüsse
Auch familiäre Einflüsse können beim Einstieg in die Magersucht eine große Rolle spielen. Die Familien, aus denen Anorektikerinnen kommen, scheinen auf den ersten Blick die perfekt organisierten Vorbild-Familien zu sein. Sie weisen nichts Außergewöhnliches auf, sind Mittelstandsfamilien und richten sich nach den gesellschaftlichen Normen. Die Eltern wissen genau, was man tut oder nicht tut und haben Moral und Ordnung verinnerlicht. Eine Betroffene berichtet: "Es gelten ungeschriebene Gesetze allüberall, und ich rühre nichts an, was mir nicht zugeteilt ist. (...) In der Stadt einen Kaffee trinken war unnötig, zu Hause gab es ihn billiger. (...) Hagebuttenmarmelade gab es im Winter, Kuchen und Frühstückseier nur sonntags (...). Eine Welt ohne Ordnung ist Chaos, deshalb bezeichnet meine Mutter meinen Bruder und mich oft als Chaoten; mein Bruder mag nämlich Frühstückseier auch in der Woche“ (Gerlinghoff, Backmund 1999, S.74).
Gesellschaftliche und verwandtschaftliche Verpflichtungen werden, soweit nötig, wahrgenommen, doch gegen die Außenwelt kapseln sich die meisten Familien ab. Individualisten sind in diesen Familien nicht erwünscht, es herrscht ein Streben nach Einheit und Konformität, wobei vertrauensvolle Verbundenheit und Intimität fehlen; Emotionen werden kaum ausgedrückt. Trotz allen Einheitsstrebens sind die Beziehungen der einzelnen Familienmitglieder untereinander problematisch. Die Großeltern spielen oft eine beherrschende Rolle, wenn sich die Eltern nicht von ihnen gelöst haben. So streben manche Eltern bis ins hohe Alter nach Lob und Anerkennung der Großeltern. Die drei Ebenen (Großeltern – Eltern – Kinder) werden so oft nicht respektiert. Es finden Grenzüberschreitungen statt, z. B. indem der Vater auf der Seite seiner Mutter steht statt auf seiten seiner Frau, oder indem sich die Mutter mit dem Kind gegen den Vater verbündet. Häufig wechseln die Bündnisse, in jedem Fall führen sie zu einer Spaltung der Familie.
Anorektikerinnen sind meist mit der Mutter verbündet, was wie eine Symbiose erlebt werden kann. Die Kranke fühlt sich verantwortlich für ihre Mutter, für ihr Glück und das der ganzen Familie. Problematische Familienverhältnisse erschweren ihnen diese Aufgabe und können somit auf den Krankheitsverlauf massiv einwirken (vgl. Gerlinghoff, Backmund 1999, S.73-77).
2.4 Sinn der Magersucht
- „Magersucht ist mein Leben.“
- „Ohne Magersucht bin ich ein Nichts.“
- „Magersucht macht mich zu etwas Besonderem.“
- „Magersucht ist mein Halt und Lebensinhalt.“
- „Magersucht ist Macht und Stärke.“
(Gerlinghoff, Backmund 1999, S.23)
Diese fünf Behauptungen sind Aussagen einzelner Magersüchtiger über den Sinn ihrer Krankheit. Solche Begründungen für Anorexia nervosa sind von Nichtbetroffenen schwer nachvollziehbar. Doch die Anorektikerinnen werden nicht magersüchtig, um ihren Lebenssinn und –inhalt zu finden. Sie versuchen erst dann, ihrer Krankheit einen Sinn zu geben, wenn sie schon lange darunter leiden. Beispielsweise durch die Behauptung, wegen der Magersucht etwas Besonderes zu sein, rechtfertigen sie ihr Suchtverhalten und wollen von ihren Mitmenschen besser verstanden werden, die sie oft mit Fragen löchern wie: „Warum tust Du das?“ (vgl. Gerlinghoff, Backmund 1999, S. 23).
„Die Magersucht als Selbstwert, Lebenssinn und –inhalt, als Macht, Stärke und als Leistungsbeweis sind „Werte“, die viele Magersüchtige in der Magersucht zu finden glauben. Im Laufe der Krankheit können sich diese Werte wandeln. Oft nimmt das positive Erleben ab, und das negative wächst. Hungern aus Selbsthaß ist keine Seltenheit“ (Gerlinghoff, Backmund 1999, S.25). Selbsthass entsteht, wenn sich Anorektikerinnen wertlos fühlen, wenn sie glauben, bestimmte Leistungen nicht erbracht oder Erwartungen nicht erfüllt zu haben (vgl. Gerlinghoff, Backmund 1999, S.25).
Die Magersucht erfüllt für viele an dieser Krankheit Leidende die Funktion, das Erwachsenwerden aufzuhalten. Sie glauben, mit Eintritt in das Erwachsenenalter die perfekte Frau sein zu müssen und erhoffen sich durch die Magersucht einen Aufschub.
Kapitel 3 FOLGEN DER ANOREXIA NERVOSA
3.1 Körperliche Folgen
„Im schlimmsten Fall führt die Magersucht durch allmähliches Verhungern zum Tod“ (Harland, Siegel 1996, S.22).
Essstörungen bleiben für den Organismus nicht ohne Folgen, da der Entzug von Nahrung über einen längeren Zeitraum einen schweren Eingriff in die normalen Abläufe des Körpers darstellt.
Abgesehen von der unerlässlichen Abmagerung des Körpers, treten die ersten Folgen der Magersucht bereits nach einigen Tagen des Hungerns auf. Es kommt zu Euphoriegefühlen und einige Zeit später, um das Hungergefühl zu unterdrücken, zur Ausschüttung von Endorphinen. Relativ bald beginnt das Ausbleiben von Eisprung und Regelblutung, oft schon in den ersten Wochen der Magersucht. Um sich dem Nahrungsentzug anzupassen, verändert sich der Stoffwechsel. Der Organismus wird durch diese Krankheit so sehr geschwächt, dass das Hungern zu Schäden an Herz und Nieren führen kann. Folge davon sind Wasseransammlungen (=Ödeme) im Körper, vor allem in den Beinen. Im Verlauf der Krankheit gerät der Stoffwechsel und der Elektrolytenhaushalt des Körpers immer mehr durcheinander. Es kann zu Wahnvorstellungen kommen, wenn das Gehirn nicht mehr ausreichend mit lebenswichtigen Stoffen versorgt wird und am Ende der Krankheit kann der Tod stehen (vgl. Harland, Siegel 1996, S.22-23).
3.2 Psychische Folgen
Anorektikerinnen haben meist ein mangelndes Selbstwertgefühl. Werte sind für sie von großer Bedeutung, und so versuchen sie alles, um in der Gesellschaft anerkannt zu werden. Dies meinen sie jedoch nicht zu erreichen und fühlen sich somit unterlegen und glauben, von den Menschen in ihrer Umgebung nicht akzeptiert oder gar verachtet zu werden. Sie verfallen oft in Angst und Depressionen.
Magersüchtige sind meist sehr sensibel und reagieren häufig sehr stark auf ihre Umwelt. Durch ihre Krankheit haben sie ein gestörtes Verhältnis zu ihren Gefühlen und sind oft nicht in der Lage, die eigenen Emotionen und Bedürfnisse zu erkennen und auszudrücken. Dadurch kommt es häufig zu Missverständnissen mit anderen Menschen, und beide Seiten, sowohl die Kranke als auch ihre Familie und / oder Freunde, fühlen sich nicht verstanden oder sogar abgelehnt (vgl. Harland, Siegel 1996, S.24).
3.3 Soziale Folgen
Die Anorexia nervosa führt bei fast allen Betroffenen zu einer Veränderung des sozialen Verhaltens. Anorektikerinnen fühlen sich von ihrer Umwelt nicht verstanden und ziehen sich so mehr und mehr in sich selbst zurück. Durch diese Isolation und Abkapselung von anderen haben sie Probleme, in näheren Kontakt mit anderen Menschen zu treten oder diesen aufrechtzuerhalten.
Magersüchtige reagieren in Gesellschaft anderer oft gereizt. Folge ihrer Launenhaftigkeit kann sein, dass Freunde sich zurückziehen.
Gespräche mit Magersüchtigen sind oft sehr schwierig, da sie meist kein Interesse an zwischenmenschlichen Kontakten zeigen. Einige Anorektikerinnen pflegen oberflächliche Kontakte, jedoch baut sich während der Krankheit nie eine engere, intimere Beziehung zu einem anderen Menschen auf (vgl. Harland, Siegel 1996, S.24).
Schlussteil
Zusammenfassung
Kann man der Magersucht vorbeugen? Wird es womöglich irgendwann sogar ein Mittel gegen diese Krankheit geben?
Viele Betroffene würden sich vielleicht ein solches Wundermittel wünschen; und viele Eltern würden wahrscheinlich gerne vorbeugen, sodass ihre Töchter nicht an Magersucht erkranken.
Erfolgreiche Prävention setzt das Wissen um die Entstehung der Anorexia nervosa voraus, und schließlich das Einwirken auf die Risikofaktoren.
Das hört sich ziemlich einfach an, doch wenn man sich die Ursachen dieser Krankheit noch einmal ins Gedächtnis ruft, wird man feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, diese zu bekämpfen.
Man müsste z.B. die Rolle der Frau neu definieren, damit junge Mädchen keinen Grund mehr haben, dagegen zu protestieren.
Unsere Wohlstands-Gesellschaft müsste in eine Gesellschaft umgewandelt werden, in der jeder nur das Notwendigste besitzt, und es sich keiner leisten kann, freiwillig auf Nahrung zu verzichten.
Es dürfte keinerlei Schönheitsideale mehr geben. Doch da die Ideen von Schönheit sehr unterschiedlich sind, müssten alle Menschen gleich aussehen, damit sich niemand zurückgesetzt fühlt und der Wunsch, abzunehmen, gar nicht erst aufkommt.
Es dürfte niemand erwachsen werden, damit sich bei jungen Mädchen nicht der Wille entwickelt, diesen Prozess aufzuschieben (, was sie durch Magersucht erreichen können).
Diese oben genannten Vorstellungen finde ich sehr absurd.
Wie würden Sie sich fühlen, wenn jeder so aussehen würde wie sie? Oder wie wäre es, wenn es nichts „Unnötiges“ mehr geben würde, kein Eis, keine Schokolade, keine Pommes?
Es fällt mir sehr schwer, mir so ein Leben auszumalen, und ich glaube nicht, dass es in naher Zukunft jemandem gelingen wird, erfolgreich auf die genannten Risikofaktoren der Anorexia nervosa einzuwirken.
Was können wir also tun?
Zunächst müssen wir hellhörig werden und Krankheitsanzeichen erkennen, z.B. veränderte Essgewohnheiten, extremer Gewichtsverlust und seelische Veränderungen wie Depression, Gereiztheit und Aggressivität. Auch das Intensivieren von körperlichen Aktivitäten, das Vermeiden von gemeinsamen Mahlzeiten (in der Familie oder mit Freunden) muss uns auf die mögliche Erkrankung aufmerksam machen.
Wenn wir in der Familie oder im Freundeskreis engeren Kontakt zu einer Magersüchtigen haben, können wir versuchen, auf die Betroffene zuzugehen, mit ihr zu reden und hoffen, dass sie sich für eine Therapie entscheidet, um die Auswirkungen der Krankheit möglichst gering zu halten.
Aber primär können wir dieser Krankheit weder vorbeugen, sie aufhalten, noch abschaffen; so schön es auch wäre.
Literaturverzeichnis
Benutzte Literatur:
- Gerlinghoff, M., 1996: „Magersucht und Bulimie – Innenansichten. Heilungswege aus der Sicht Betroffener und einer Therapeutin“, München: Pfeiffer
- Gerlinghoff, M. und Backmund, H., 1999: „Wege aus der Eßstörung. Magersucht und Bulimie: Wie sie entstehen und behandelt werden. So finden Sie zu einem normalen Eßverhalten zurück. Denkanstöße und Hilfen für Betroffene, Angehörige und Freunde“, Stuttgart, Trias
- Harland, S. und Siegel, W., 1996: „Eßstörungen. Erkennen und behandeln“, Küttingen/Aarau: Midena-Verlag
- Valette, B., 1990: „Suppenkasper und Nimmersatt. Eßstörungen bei Kindern und Jugendlichen“, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH
Weiterführende Literatur:
- Cuntz, U. und Hillert, A., 1998: „Eßstörungen. Ursachen, Symptome, Therapien“, München, Beck
- Dogs, W., 1985: „Psychosomatische Therapie der Magersucht“, Heidelberg: Verlag für Medizin Fischer
- Gerlinghoff, M., Backmund, H., Mai, N., 1999: „Magersucht und Bulimie. Verstehen und bewältigen“, Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Klessmann, E. und Klessmann, H.-A., 1990: „Heiliges Fasten – heilloses Fressen. Die Angst der Magersüchtigen vor dem Mittelmaß“, Bern, Stuttgart, Toronto: Verlag Hans Huber
- Orbach, S., 1998: „Magersucht. Ursachen und neue Wege der Heilung“, München: Econ & List
- Thomä, H., 1961: „Anorexia nervosa“, Stuttgart: Ernst Klett Verlag
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Definition von Anorexia nervosa laut diesem Text?
Die Anorexia nervosa (Pubertätsmagersucht) ist eine Krankheit, eine Form von Essstörungen, bei der die Beschäftigung mit Nahrung im Leben einer Person einen übermäßig großen Raum einnimmt und die Gedanken vorrangig um das Essen kreisen.
Welche Symptome und Anzeichen werden im Text für Anorexia nervosa genannt?
Zu den Symptomen und Anzeichen gehören Konzentrationsschwierigkeiten, Depressionen, Reizbarkeit, aggressives Verhalten, Verheimlichen des Gewichtsverlusts, Leugnen von Hungergefühlen, Müdigkeit, übermäßige sportliche Aktivität, Vermeiden gemeinsamer Mahlzeiten, auffälliges Essverhalten (z. B. langsames Essen, Zerkleinern der Nahrung), übermäßiger Konsum kalorienfreier Getränke und Ausbleiben der Menstruation (Amenorrhoe).
Welche Ursachen für Anorexia nervosa werden in diesem Text diskutiert?
Der Text diskutiert gesellschaftliche Einflüsse (z. B. Überfluss an Nahrung, Schönheitsideale), soziokulturelle Aspekte (z. B. Rolle der Frau, Aufwachsen in Kleinfamilien) und familiäre Einflüsse (z. B. perfekt organisierte Familien, fehlende Intimität, problematische Beziehungen zwischen Familienmitgliedern). Auch der vermeintliche Sinn der Magersucht für die Betroffenen (z.B. als Lebensinhalt oder Macht) wird betrachtet.
Welche gesellschaftlichen Einflüsse werden als Ursache für Anorexia nervosa beschrieben?
Es wird betont, dass Essstörungen an Überfluss gebunden sind und in Gesellschaften mit Nahrungsmangel nicht vorkommen. Ebenso werden der Einfluss von Medien (z.B. Fernsehwerbung für Diätprodukte) und Schönheitsidealen diskutiert.
Welche soziokulturellen Aspekte werden als Ursache für Anorexia nervosa angeführt?
Die Rolle der Frau in der Gesellschaft und das Aufwachsen in Kleinfamilien werden als mitverantwortlich genannt. Magersüchtige wollen oft die Rolle als Frau, wie sie von ihren Müttern vorgelebt wird, nicht annehmen.
Welche familiären Einflüsse werden im Text als Ursache für Anorexia nervosa genannt?
Die Familien werden oft als perfekt organisiert und nach außen hin angepasst beschrieben. Es herrscht ein Streben nach Einheit und Konformität, aber es fehlt an Intimität. Die Beziehungen der einzelnen Familienmitglieder untereinander sind oft problematisch. Die Großeltern spielen oft eine beherrschende Rolle.
Welchen Sinn sehen Magersüchtige in ihrer Krankheit laut dem Text?
Magersüchtige sehen in ihrer Krankheit oft einen Lebensinhalt, eine Möglichkeit, sich besonders zu fühlen, Macht und Stärke, oder eine Art Selbstwertgefühl. Die Magersucht kann auch als eine Art Aufschub des Erwachsenwerdens empfunden werden.
Welche körperlichen Folgen von Anorexia nervosa werden im Text beschrieben?
Zu den körperlichen Folgen gehören Abmagerung, Ausbleiben von Eisprung und Regelblutung, Stoffwechselveränderungen, Schäden an Herz und Nieren, Wasseransammlungen (Ödeme), Störungen des Elektrolytenhaushaltes und im schlimmsten Fall der Tod durch Verhungern.
Welche psychischen Folgen von Anorexia nervosa werden im Text angeführt?
Die psychischen Folgen umfassen ein mangelndes Selbstwertgefühl, Angst, Depressionen, ein gestörtes Verhältnis zu den eigenen Gefühlen und Schwierigkeiten, Emotionen auszudrücken.
Welche sozialen Folgen hat Anorexia nervosa laut dem Text?
Die sozialen Folgen umfassen eine Veränderung des sozialen Verhaltens, Rückzug von anderen Menschen, Isolation, Probleme, engere Beziehungen aufzubauen, Gereiztheit in Gesellschaft und Verlust von Freunden.
Wie wird der Krankheitsverlauf von Anorexia nervosa beschrieben?
Der Verlauf beginnt oft mit einer harmlosen Diät, die jedoch über den natürlichen Zeitrahmen hinausgeht. Die Betroffenen definieren immer wieder ein neues, niedrigeres Wunschgewicht und hungern weiter. Die Gewichtsabnahme verselbstständigt sich und wird zur Leistung. Es entstehen eigene Essensrituale und Kontrollmaßnahmen.
Was kann man tun, um Anorexia nervosa vorzubeugen?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass eine erfolgreiche Prävention des Wissens um die Entstehung der Anorexia nervosa voraussetzt. Jedoch werden die oben genannten Vorstellungen als sehr absurd bezeichnet und es wird es als sehr schwer eingestuft Risikofaktoren der Anorexia nervosa einzuwirken.
- Arbeit zitieren
- Eva-Maria Dengel (Autor:in), 2002, Pubertätsmagersucht bei Mädchen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107631