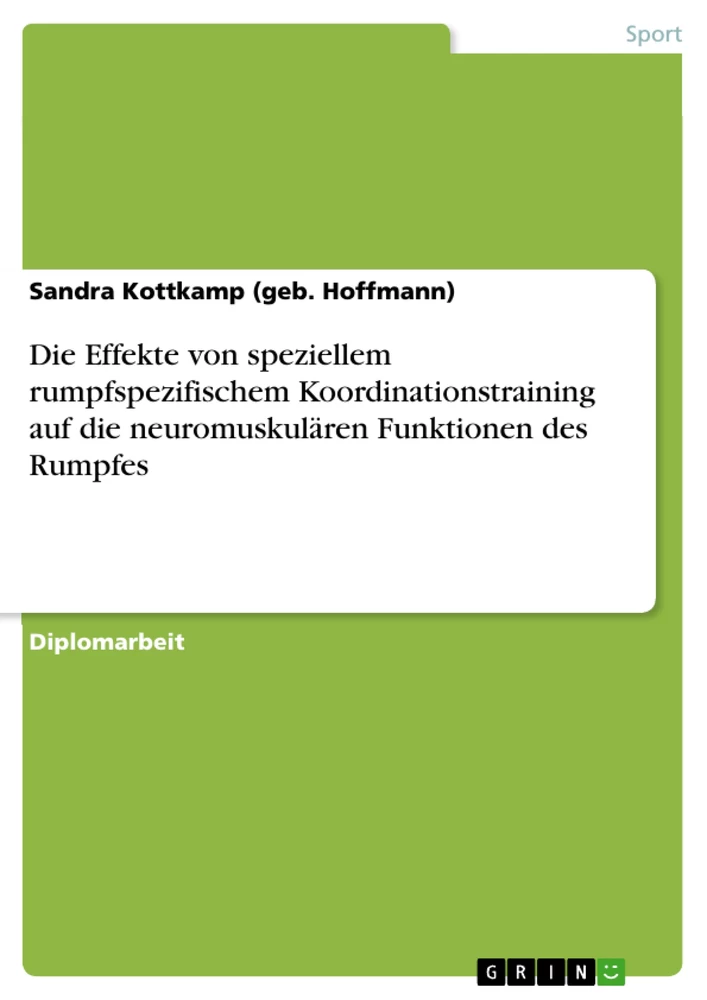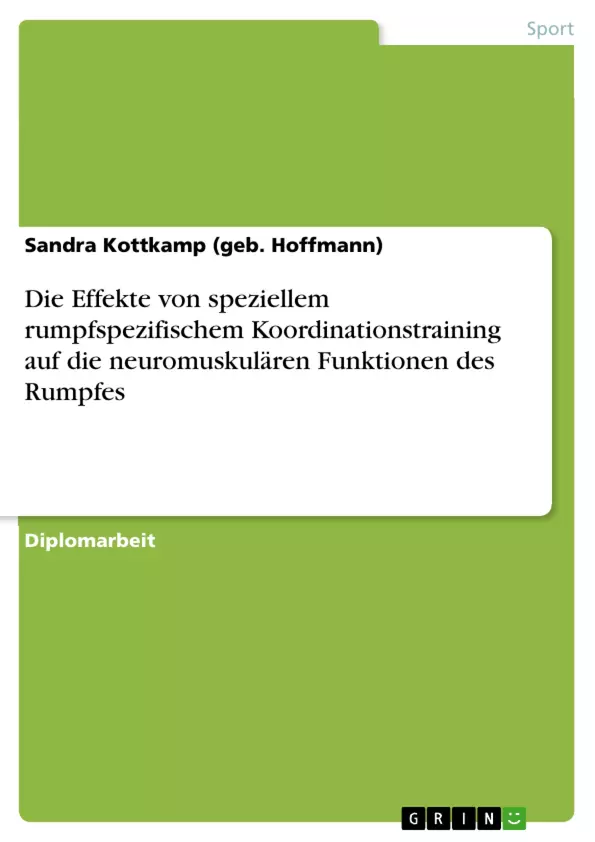Zum Koordinationstraining wurden in der Vergangenheit, im Gegensatz zum Kraft- und Flexibilitätstraining, nur wenige wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt. Roth (2001) bestätigt dies mit der Aussage, dass „dem hohen Stellenwert des Koordinationstrainings eine noch weitgehend unterentwickelte theoretische Grundlegung gegenüber steht. Klar ist nur, dass im Koordinationstraining die koordinativen Fähigkeiten verbessert werden sollen. Für die konkreten Inhalte von Koordinationstraining, sowie für die Frage wie viele und welche koordinativen Einzelfähigkeiten zu definieren und voneinander abzugrenzen sind, existiert bereits keine eindeutige, allgemein verbindliche Antwort mehr“ (S.16).
Dies führt dazu, dass Koordinationstraining in der Praxis häufig vernachlässigt wird (vgl. Schnabel et al., 1998, S. 225).
Heitkamp fällt dazu auf, dass Krafttraining in fast allen Sport- und Fitnesstrainingsprogrammen zu finden ist, Koordinationstraining aber nur vorrangig im Techniktraining spezieller Sportarten1 (vgl. Heitkamp, 2000, S.1).
Auch in der Sporttherapie und im gesundheitsorientierten Breitensport2 kommt Koordinationstraining nur eingeschränkt zur Anwendung. Es fehlt hier an wissenschaftlich fundierten Trainingskonzepten sowie an adäquaten Tests zur genauen Erfassung koordinativer Qualitäten und Fähigkeiten die es ermöglichen würden Koordinationstrainingsprogramme gezielter steuern und die Effekte dieser Programme exakter dokumentieren zu können.
Nur über die genaue Erforschung von Trainingseffekten kann Koordinationstraining auch in diesem Bereich eine größere Bedeutung bekommen, da nur über fundierte theoretische Grundlagen Trainer und Trainierende den Sinn von Koordinationstraining verstehen können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Themenfindung
- 2 Theoretische Grundlagen zum Thema Koordination
- 2.1 Begriffsbestimmungen der Koordination
- 2.2 Koordinative Leistungsvoraussetzungen
- 2.3 Koordinationstraining
- 2.4 Koordinationstests
- 3 Empirische Untersuchung
- 3.1 Methodik
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Effekte von speziellem rumpfspezifischem Koordinationstraining auf Rumpfbeweglichkeit, Rumpfmaximalkraft und auxotonische Rumpfkoordination
- 4.2 Effekte von speziellem rumpfspezifischem Koordinationstraining auf Beweglichkeits- und Maximalkraftdysbalancen
- 4.3 Entwicklung der Haltungskontrolle der Wirbelsäule durch sechswöchiges spezielles rumpfspezifisches Koordinationstraining
- 4.4 Vergleich der Effekte von speziellem rumpfspezifischem Koordinationstraining und isometrischem Krafttraining
- 4.5 Charakteristische zeitliche Trainingseffekte durch spezielles rumpfspezifisches Koordinationstraining und isometrisches rumpfspezifisches Krafttraining auf die Entwicklung der Rumpfbeweglichkeit, der Rumpfmaximalkraft, der auxotonischen Rumpfkoordination und der Haltungskontrolle
- 4.6 Korrelation von auxotonischem Koordinationsniveau, Beweglichkeit und Maximalkraft
- 4.7 Ergebnisse der EBF-Item-Auswertung
- 5 Diskussion
- 5.1 Rumpfbeweglichkeit
- 5.2 Beweglichkeitsdysbalancen
- 5.3 Rumpfmaximalkraft
- 5.4 Maximalkraftdysbalancen
- 5.5 Auxotonische Rumpfkoordination
- 5.6 Haltungskontrolle
- 5.7 Korrelation von Koordinationsniveau, Beweglichkeit und Maximalkraft
- 5.8 Erholungs-Belastungs-Fragebogen
- 5.9 Kritische Betrachtung der Methodik
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
- 7 Literaturverzeichnis
- 8 Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Untersuchung der Auswirkungen eines speziellen Rumpfspezifischen Koordinationstrainings auf verschiedene neuromuskuläre Funktionen des Rumpfes.
- Die Effekte des Trainings auf die Rumpfbeweglichkeit, Rumpfmaximalkraft und auxotonische Rumpfkoordination werden analysiert.
- Die Studie untersucht die Auswirkungen des Trainings auf Beweglichkeits- und Maximalkraftdysbalancen.
- Die Entwicklung der Haltungskontrolle der Wirbelsäule durch das sechswöchige Training steht im Fokus.
- Die Effekte des speziellen Rumpfspezifischen Koordinationstrainings werden mit denen des isometrischen Krafttrainings verglichen.
- Die Arbeit analysiert die charakteristischen zeitlichen Trainingseffekte auf verschiedene Parameter wie Rumpfbeweglichkeit, Rumpfmaximalkraft, auxotonische Rumpfkoordination und Haltungskontrolle.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und erläutert die Problemstellung sowie die Themenfindung. Kapitel 2 widmet sich den theoretischen Grundlagen des Themas Koordination, wobei verschiedene Begriffsbestimmungen, koordinative Leistungsvoraussetzungen, Koordinationstraining und Koordinationstests beleuchtet werden. Kapitel 3 beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung.
In Kapitel 4 werden die Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt, die die Effekte des speziellen Rumpfspezifischen Koordinationstrainings auf verschiedene Parameter wie Rumpfbeweglichkeit, Rumpfmaximalkraft, auxotonische Rumpfkoordination, Beweglichkeits- und Maximalkraftdysbalancen, Haltungskontrolle und den Vergleich mit isometrischem Krafttraining beleuchten.
Kapitel 5 diskutiert die Ergebnisse der Untersuchung ausführlich und analysiert die Ergebnisse im Kontext der Literatur. Kapitel 6 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsansätze.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Rumpfspezifisches Koordinationstraining, neuromuskuläre Funktionen, Rumpfbeweglichkeit, Rumpfmaximalkraft, auxotonische Rumpfkoordination, Haltungskontrolle, Beweglichkeits- und Maximalkraftdysbalancen, isometrisches Krafttraining, empirische Untersuchung, Trainingseffekte.
Häufig gestellte Fragen
Welche Effekte hat spezielles Rumpf-Koordinationstraining?
Das Training verbessert die neuromuskulären Funktionen, insbesondere die Rumpfbeweglichkeit, die Rumpfmaximalkraft und die auxotonische Koordination.
Kann Koordinationstraining muskuläre Dysbalancen reduzieren?
Ja, die Untersuchung zeigt positive Effekte auf die Verringerung von Beweglichkeits- und Maximalkraftdysbalancen im Bereich des Rumpfes.
Wie unterscheidet sich Koordinationstraining von isometrischem Krafttraining?
Während Krafttraining primär auf Muskelzuwachs zielt, fokussiert Koordinationstraining auf das Zusammenspiel der Nerven und Muskeln sowie die Haltungskontrolle der Wirbelsäule.
Was ist auxotonische Rumpfkoordination?
Dabei handelt es sich um die Fähigkeit, Bewegungen unter sich ändernden Spannungsverhältnissen der Muskulatur präzise zu steuern, was für die Stabilität im Alltag und Sport essenziell ist.
Warum wird Koordinationstraining in der Praxis oft vernachlässigt?
Häufig fehlen wissenschaftlich fundierte Trainingskonzepte und adäquate Tests, um die koordinativen Fähigkeiten exakt zu erfassen und den Fortschritt zu dokumentieren.
- Quote paper
- Sandra Kottkamp (geb. Hoffmann) (Author), 2002, Die Effekte von speziellem rumpfspezifischem Koordinationstraining auf die neuromuskulären Funktionen des Rumpfes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10766