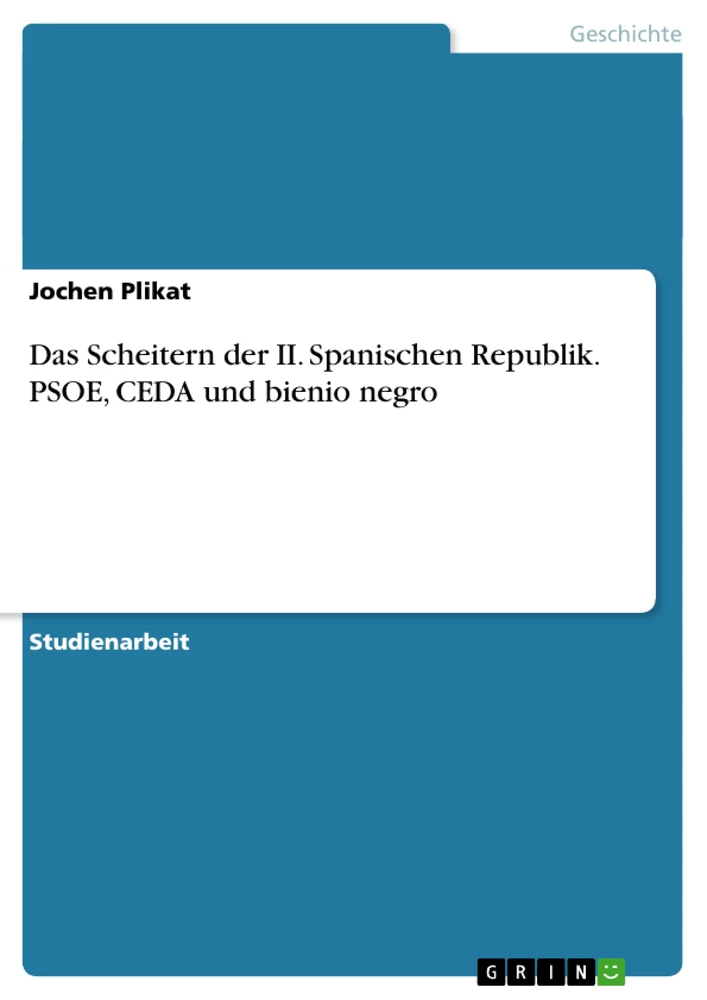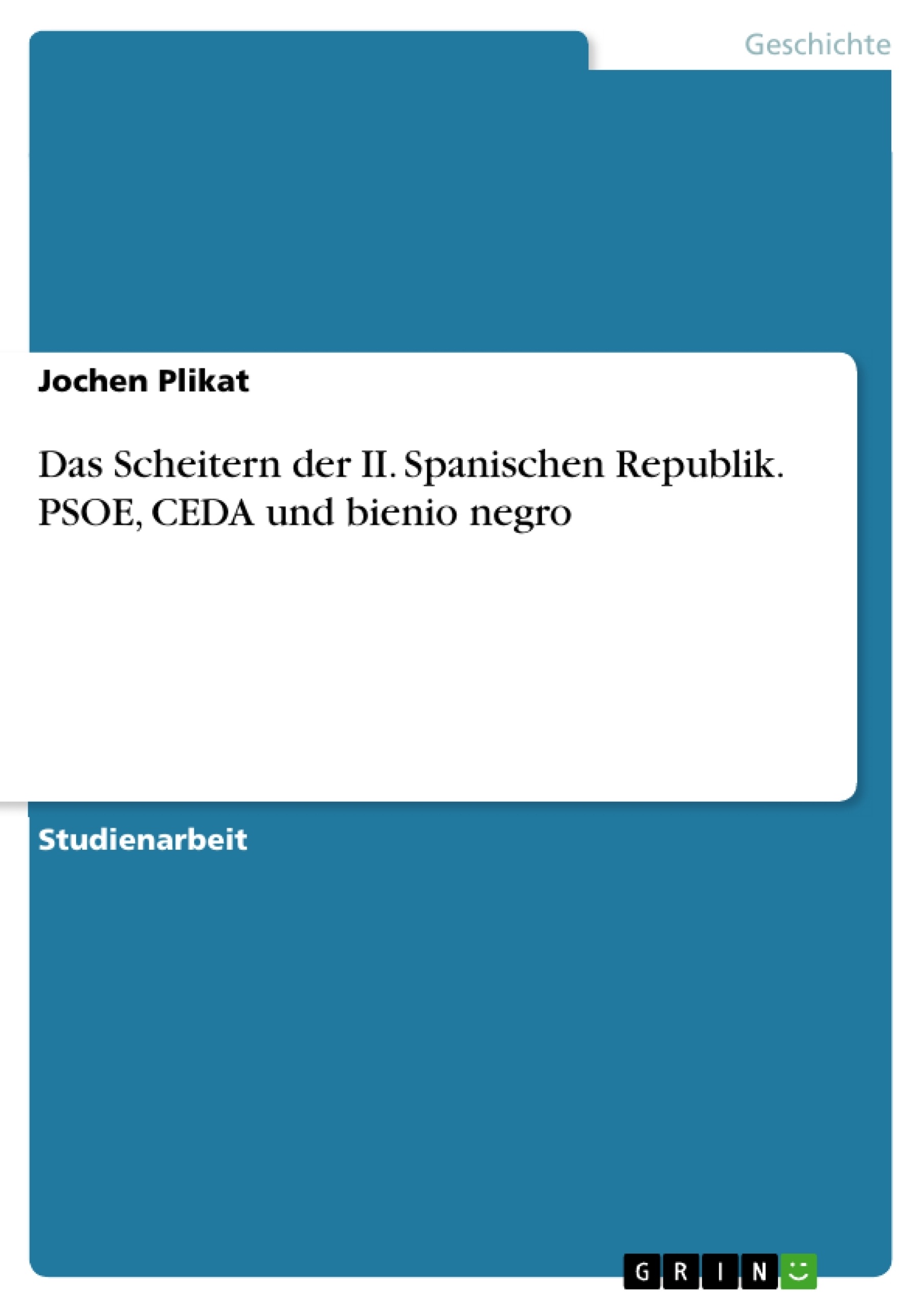Was führte zum Untergang der Zweiten Spanischen Republik und zum Ausbruch des blutigen Bürgerkriegs? Diese Frage, die Spanien bis heute beschäftigt, steht im Zentrum dieser intriguing Analyse. Im Fokus stehen die zentralen Akteure und deren ideologischen Wandlungen, insbesondere die Rolle der sozialistischen PSOE und der rechtskonservativen CEDA. Die Analyse beleuchtet die politischen Strömungen, die zur Radikalisierung der spanischen Gesellschaft in den 1930er-Jahren führten. Die Untersuchung der PSOE zeigt, wie sich die Partei von einer anfänglich gemäßigten, republikfreundlichen Kraft zu einer revolutionären Bewegung wandelte, beeinflusst von der Weltwirtschaftskrise und der gescheiterten Agrarreform. Die Studie analysiert die ideologische Entwicklung anhand der Parteiprogramme von 1931 und 1934 und zeigt die zunehmende Distanzierung von der Republik. Die Ereignisse des Oktober 1934, insbesondere der Aufstand in Asturien, dienen als Kristallisationspunkt, um die Eskalation der politischen Spannungen zu verdeutlichen. Die Analyse der CEDA unter Führung von José María Gil Robles zeigt ein von Anfang an tiefes Misstrauen gegenüber dem republikanischen Modell. Die CEDA nutzte ihre parlamentarische Macht, um sozialreformerische Ansätze zu sabotieren und Schlüsselpositionen im Militär mit antirepublikanischen Offizieren zu besetzen. Die Rolle von Gil Robles, seine Taktik der legalen Machtübernahme und seine Beziehungen zum Militär werden detailliert untersucht. Abschließend wird die Frage erörtert, inwieweit die Handlungen und Entscheidungen der PSOE und der CEDA zum Scheitern der Republik beigetragen haben. Die Arbeit leistet einen Beitrag zum Verständnis der komplexen Ursachen des Spanischen Bürgerkriegs und der politischen Zerrissenheit Spaniens in jener Zeit. Die Analyse der spanischen Geschichte, der politischen Parteien, des spanischen Bürgerkriegs, der PSOE, der CEDA, der Zweiten Republik und der Oktoberrevolution von 1934 bietet einen umfassenden Einblick in die damaligen Ereignisse. Das Augenmerk liegt dabei auf den politischen Programmen und deren Auswirkungen auf die polarisierte Gesellschaft sowie auf den Schlüsselfiguren wie Largo Caballero und Gil Robles, deren Handeln die Republik nachhaltig prägte und letztendlich zu ihrem Fall führte. Die Untersuchung der Agrarreform und der Rolle des Militärs komplettieren das Bild einer gescheiterten Demokratie am Rande Europas. Die Arbeit ist somit unverzichtbar für alle, die sich mit der spanischen Geschichte und den Ursachen des Bürgerkriegs auseinandersetzen möchten.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
2.1. Die gemäßigte Haltung bis 1933
2.2. Die Radikalisierung von 1933/1934
2.3. Die Radikalisierung des PSOE im Spiegel der Parteiprogramme von 1931 und 1934
2.3.1. Das Programm des PSOE vom 11. Juli 1931
2.3.2. Das Programm des PSOE ab Januar 1934
3. Die "Oktoberrevolution" von 1934
4. Die Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA)
5. Schlussbetrachtung
6. Quellen und Literatur
1. Einleitung
Die Geschichte der II. Spanischen Republik lässt sich - bei aller Problematik der Periodisierung von Geschichte - zeitlich recht präzise umreißen und in drei beziehungsweise, rechnet man die Zeit des Bürgerkriegs mit, vier Phasen einteilen.
Die erste Phase beginnt mit dem Sieg des republikanischen Parteienbündnisses bei den Gemeinderatswahlen am 12. April 1931. In mehreren großen Städten wird die Republik ausgerufen. Alfons XIII. verlässt Spanien. Nachdem das republikanisch-sozialistische Wahlbündnis auch die Parlamentswahlen vom 28. Juni gewinnt, tritt am 9. Dezember eine republikanische Verfassung in Kraft[1]. Die wechselnden linksliberalen Regierungen unter Manuel Azaña nehmen in den folgenden zwei Jahren einige der drängendsten Probleme in Angriff: die ungelöste Agrarfrage, die Trennung von Kirche und Staat, die Frage nach der Rolle des Militärs im Staat und die Autonomieregelungen für die nationalen Minderheiten. Obwohl fast alle Reformansätze auf halbem Wege scheitern, wird diese erste Phase in der spanischen Historiographie allgemein als "bienio de reformas" (Doppeljahr der Reformen) oder auch "bienio social-azañista" bezeichnet.
Die zweite Phase beginnt mit dem Machtwechsel im Dezember 1933. Begünstigt durch mehrere Faktoren gelingt es dem rechten Bündnis CEDA unter José María Gil Robles, die Mehrheit der Sitze im neuen Parlament zu gewinnen. Neuer Regierunschef wird Alejandro Lerroux vom Partido Radical, der mit Unterstützung der CEDA regiert. Bis Ende 1935 kommt es zu einer Vielzahl von Regierungsumbildungen. Während dieser Zeit werden die unter Azaña verabschiedeten Reformgesetze verschleppt, ergänzt und somit entschärft oder, besonders nach der Regierungsumbildung im Mai 1935 und der Ablösung des sehr tatkräftigen Agrarministers Giménez Fernández, ganz zurückgenommen. In der Literatur finden sich verschiedene Bezeichnungen für diese zweite Phase: "bienio rectificador", "bienio restaurador", "bienio radical-cedista" und, dies das verbreitetste Etikett für diese Zeit, "bienio negro" (schwarzes Doppeljahr).
Von der "Volksfrontwahl" im Februar 1936, bei der die Linke erneut eine große parlamentarische Mehrheit erringen kann, bis zum pronunciamiento und damit Ausbruch des Bürgerkrieges am 18. Juli 1936 lässt sich eine dritte Phase abgrenzen. Manuel Azaña bildet ein linksrepublikanisches Kabinett, das aber kaum über gesellschaftlichen Rückhalt verfügt: neben den ohnehin republikfeindlich eingestellten Anarchosyndikalisten haben nach den Enttäuschungen des "bienio negro" inzwischen auch die Sozialisten das Vertrauen in die Republik verloren und wollen Spanien zur Revolution führen. Und die Rechte rüstet sich, nachdem es dem CEDA-Führer Gil Robles misslungen ist, sich der Republik mit legalen Mitteln zu bemächtigen, fast unverhohlen zum Staatsstreich.
Die vierte Phase schließlich umfasst die Zeit des Bürgerkriegs, der nach fast drei Jahren am 1. April 1939 mit dem Zusammenbruch der Republik, dem Sieg Francos und der Errichtung einer katholisch-reaktionären Diktatur endet.
Der Forschungsstand über die spanische Geschichte der zweiten Republik und des Bürgerkriegs ist inzwischen, besonders seit mit dem Ende des Franco-Regimes die Archive geöffnet wurden, außerordentlich gut. Ein Großteil der Literatur liegt allerdings nur in spanischer oder englischer Sprache vor. Besonders hingewiesen werden soll an dieser Stelle auf die grundlegenden Arbeiten von Edward E. Malefakis[2], von Paul Preston[3] (mit ausführlichem Quellen- und Literaturverzeichnis) sowie auf die Bände 9 und 12 der unter der Leitung von Manuel Tuñón de Lara entstandenen "Historia de España"[4].
Fragt man nach den Gründen für das Scheitern der spanischen Republik und für den Ausbruch des Bürgerkriegs, so stößt man sowohl im Gespräch mit Spaniern als auch in der Geschichtsschreibung nicht selten auf psychologisierende Erklärungsansätze. Der konservative Salvador de Madariaga spricht beispielsweise in seinem über mehrere Jahrzehnte hinweg entstandenen Werk "Spanien" von der "absoluten Art des spanischen Charakters, der die tief wurzelnde Ursache aller spanischen Wirren"[5] sei. Aber auch für einen sonst so differenziert urteilenden Autoren wie Manuel Azaña scheint dieser Faktor eine Rolle zu spielen:
Der spanische Charakter machte das zu einem heftigsten Sturm der Leidenschaften, was an sich ein gar nicht so neues politisches Problem war, als dass man es nicht schon anderswo gesehen hätte, und ein gar nicht so schwieriges, als dass es nicht in den Griff zu bekommen gewesen wäre.[6]
Bernhardt Schmidt hat sich in seinem Buch "Spanien im Urteil spanischer Autoren" mit diesem bis heute sehr hartnäckigen Klischee beschäftigt und auf der Grundlage literarischer Quellen nachgewiesen, dass das sogenannte "Spanienproblem" - "die Unterstellung, dass Spanien - ‘der Spanier’ - 'schon immer' anders sei" - in erster Linie ein Mythos ist, der ablenkt "von dem sozialen Sachverhalt, dass das Land im Jahrhundert der Aufklärung und dem des Liberalismus im Vergleich zu einigen europäischen Ländern unterentwickelt war (...)."[7]
In der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass die spanische Republik nicht an einer diffusen Andersartigkeit des "Nationalcharakters" ihrer Bürger scheiterte, sondern vielmehr an greifbaren strukturellen Problemen, die der "Niña Bonita", wie die junge Republik von ihren Anhängern zärtlich genannt wurde, von Anfang an das Leben schwer machten. Diese Erblasten waren wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Natur, hatten aber sehr starke politische Auswirkungen, was in letzter Konsequenz das Scheitern des republikanischen Modells verursachte.
Spanien war in den 1930er-Jahren ein Land mit, im Vergleich zu den meisten anderen europäischen Ländern, archaischen sozioökonomischen Strukturen. Die wichtigsten Ziele der Republik waren daher eine demokratisch-liberale Verfassung, eine Militärreform, die Entmachtung der Kirche und die Schaffung eines laizistischen Bildungssystems sowie, dies vor allem ein Zugeständnis an die sozialistischen Alliierten, die Lösung der drängenden Agrarfrage.
Nach dem Machtwechsel im Dezember 1933 radikalisierte sich die ohnehin schon stark polarisierte politische Landschaft während des "bienio negro" zusehends. Die bürgerlich-republikanische Basis verlor ihren Einfluss, während verdeckt oder offen antirepublikanische Gruppierungen an beiden Enden des Parteienspektrums erstarkten. Die gleichen zentrifugalen Kräfte wirkten aber auch innerhalb der Parteien, die der Republik gegenüber bisher zwischen Kooperationsbereitschaft und Ablehnung geschwankt hatten. Dies gilt besonder für die sozialistische Partei PSOE (Partido Socialista Obrero Español) und für das rechte Parteienbündnis CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas).
Das zentrale Ereignis während des "bienio negro" war im Bewusstsein der Spanier der von Sozialisten, in Asturien auch von Anarchisten und Kommunisten getragene Aufstand im Oktober 1934. Er soll daher in dieser Arbeit als Kristallisationspunkt dienen, um die politische Entwicklung der zweiten Republik mit besonderer Berücksichtigung der "schwarzen Jahre" darzustellen. Weiterhin soll die Auseinandersetzung zwischen dem PSOE und der CEDA in den Mittelpunkt gerückt werden. Laut Paul Preston ist hier sogar der Hauptgrund für den Zusammenbruch der Republik zu sehen[8].
Die chronologisch angelegte Arbeit wird daher im ersten Teil vor allem die Entwicklung des PSOE bis 1934 fokussieren. Im zweiten Teil werden die Ereignisse von Oktober 1934 in Asturien ins Zentrum der Betrachtung gerückt, während der Schwerpunkt des dritten Teils die Entwicklung der CEDA ab diesem Zeitpunkt bis Ende 1935 sein wird. In einer Schlussbetrachtung wird dann erneut die Frage nach den Gründen für das Scheitern der Zweiten Republik gestellt.
2. Der Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
2.1. Die gemäßigte Haltung bis 1933
Der 1879 gegründete PSOE verfolgte in den 1920er-Jahren und in den ersten beiden Jahren der Republik ausgesprochen republikanische Ziele. Die klassenlose Gesellschaft galt zwar als erstrebenswertes Fernziel - die Mittel, um es zu erreichen, sollten aber gewaltfrei sein. Selbst während der für die Linke euphorischen Jahre 1917-1920 hatten die Sozialisten eher den Schulterschluss mit republikanischen und katalanischen Gruppen als mit der Dritten Internationalen gesucht. Diese Haltung setzte sich in der UGT (Unión General de Trabajadores, die sozialistische Gewerkschaft) und dem PSOE in der Zeit der Diktatur Primo de Riveras (1923-1930) fort. Der damals 56jährige Francisco Largo Caballero, der eine klassische Karriere als Gewerkschafts- und Parteifunktionär hinter sich hatte, stieg nach dem Tod des Gewerkschaftsführers Pablo Iglesias 1925 an die Spitze der UGT auf. Während die Kommunisten und Anarchosyndikalisten nach Wegen suchten, um die Diktatur zu stürzen, kollaborierten die Sozialisten mit Primo de Rivera - Largo Caballero war ab 1925 Mitglied des Staatsrats. Als der Diktator 1930 den Weg freimachen musste, galten der neuen Regierung Berenguer die Sozialisten als eine der Stützen für die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung:
Trotz der schweren Krise auf dem Arbeitsmarkt hat die Sozialgesetzgebung [der Ära Primo de Rivera] die sozialistischen Arbeiter dazu veranlasst, Aufrufen zur Erhebung zu widerstehen, und ihre Anführer dazu gebracht, eine Kooperation mit aufrührerischen und umstürzlerischen Bewegungen abzulehnen.[9]
Die Sozialisten setzten diese gewaltfreie Politik bis zum Sturz der Monarchie fort, und die Stimmen ihrer Anhänger lieferten einen entscheidenden Beitrag zum Wahlsieg der republikanisch-sozialistischen Parteienkoalition sowohl bei den Gemeinderatswahlen vom 12. April 1931 als auch bei den Parlamentswahlen vom 28. Juni 1931.[10]
Mit der Gründung der Republik machte sich in der Partei eine fast enthusiastische Bereitschaft zur Mitarbeit im Staat breit. Eine innerparteiliche Gruppierung unter der Führung von Julián Besteiro vertrat zwar die Ansicht, kein Sozialist sollte Regierungsmitglied werden, da dies mit den Zielen der Partei unvereinbar sei; ansonsten setzte sich aber weitgehend die Linie von Largo Caballero durch, der nun die Chance gekommen sah, mit demokratisch-republikanischen Mitteln die sozialen Probleme Spaniens zu lösen. Im Februar 1932 sollte die Parteizeitung El Socialista schreiben:
In Wirklichkeit gibt es keine politische Gruppierung oder Klassenorganisation, die optimistischer als die unsere ist.[11]
Gegen die revolutionäre Unruhe der Anarchosyndikalisten setzten die Sozialisten Geduld und Durchhaltevermögen. Als sich im Mai 1932 der von der anarchistischen Gewerkschaft CNT (Confederación Nacional de Trabajo) getragene Streik von Sevilla über ganz Spanien auszuweiten drohte, unterstützte die Zeitung El Obrero de la Tierra, das Organ der sozialistischen Landarbeitergewerkschaft FNTT (Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra) die Regierung Azaña:
Es gibt Momente, in denen es notwendig wird, an einem Kampf teilzunehmen, nicht für höhere Löhne oder kürzere Arbeitstage, sondern um Ideale zu verteidigen. Dann ist man zu jedem Opfer bereit. Ist jetzt solch ein Moment gekommen? Wir sagen nein! Jetzt da die Republik wiederhergestellt ist, ein demokratisches System, das uns reichlich Möglichkeiten zur Entwicklung innerhalb des gesetzlichen Rahmens gibt, haben alle von uns Arbeitern die Pflicht, sie zu stärken. Dies kann erreicht werden durch eine Vergrößerung des nationalen Wohlstands, durch Erfüllung unserer Pflichten bei der Arbeit und durch die Vermeidung von Streiks, wo immer das möglich ist.[12]
Die Arbeiterschaft war gespalten in einen anarchistischen Flügel klassisch bakuninscher Ausrichtung, dessen Führung seine Anhänger durch permanente Aktionen, Streiks und Aufstände zur Revolution führen wollte[13], und einen sozialistischen Flügel, dessen Führung, wie man hier sieht, die spontane Erhebung ablehnte und die Arbeiter immer wieder zu Disziplin, Durchhaltevermögen und Zusammenarbeit mit der republikanischen Regierung anhielt. Es ist erstaunlich, mit wie wenig sich die Sozialisten trotz ihres enormen Einflusses in dieser Phase zufriedenzugeben schienen. Im Hinblick auf das Agrarreformgesetz, das im September 1932 verabschiedet werden sollte, wurden die Arbeiter von vornherein vor zu hohen Erwartungen gewarnt. Lucio Martínez Gil, Generalsekretär der FNTT, äußerte sich hierzu im März 1932 in einer Rede:
Eine Agrarreform kann nicht in einem oder zwei Jahren vollendet werden.[14]
Als sich aber abzeichnete, dass Parlament und Bürokratie nach dem alten Sprichwort "obedecemos pero no cumplimos"[15] (wir gehorchen zwar, aber wir halten uns nicht daran) die Geduld der Arbeiter missbrauchten und Reformansätze systematisch verschleppten und sabotierten, wurden die gemäßigten Positionen der Anfangszeit allmählich aufgegeben.
2.2. Die Radikalisierung von 1933/1934
An der Haltung der Gewerkschaftszeitung El Obrero de la Tierra lässt sich ablesen, dass sich ab 1933 in den Reihen der Sozialisten von der Basis her wachsende Unzufriedenheit breitmachte. Angesichts der schleppenden Umsetzung des Agrarreformgesetzes vom September 1932 bedauerte man inzwischen, dass das Gesetz nicht gleich in den ersten Monaten der Republik per Dekret verabschiedet worden war. Zum ersten Mal wurde von führenden Sozialisten Kritik am Institut für Agrarreformen (IRA, Instituto de Reforma Agraria) und seinem Leiter Domingo (Partido Radical-Socialista) geäußert.
Die ohnehin nach wie vor katastrophalen Lebensbedingungen der Landarbeiter verschlechterten sich 1933 noch einmal spürbar. Auf dem spanischen Arbeitsmarkt zeichneten sich immer deutlicher die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise ab, da Tausende von Emigranten[16] durch den drastischen Anstieg der Arbeitslosigkeit in den benachbarten Ländern zur Rückkehr nach Spanien gezwungen waren. Die schlechte Ernte von 1933 verschärfte die Lage weiter; die Macht der Landbesitzer wuchs, da sie Arbeiter, die als Sozialisten galten, bei der Vergabe von Arbeit systematisch benachteiligen konnten. Die FNTT unterstützte die Regierung Azaña zwar weiterhin, äußerte aber immer deutlichere Kritik an deren zögerlichem Kurs. In ihrer Gewerkschaftszeitung wurde daran erinnert, dass der Geduld der Landarbeiter Grenzen gesetzt waren:
Es wird katastrophal sein, sollten die Massen den Glauben daran verlieren, dass sie ihre Lage mit legalen Mitteln verbessern können.[17]
Die nur unbefriedigenden Fortschritte in der Agrarfrage und die Regierungskrise im Sommer 1933 erinnerten die Sozialisten daran, dass sie von plötzlichen Machtverschiebungen in der Regierung überrascht werden könnten:
Wir müssen alarmiert sein angesichts der Möglichkeit, dass eine erneute Regierungskrise uns überraschen könnte - so wie das bei der letzten der Fall war - bevor die Agrarreform umgesetzt ist.[18]
Die Unzufriedenheit mit den Zugeständnissen, die das IRA an die Landbesitzer machte, wuchs. Im Spätsommer 1933 tauchte in der sozialistischen Presse zum ersten Mal die Bezeichnung für diese Institution auf, die später zum Slogan werden sollte:
Dieses erbärmliche Institut, das sich, statt Institut für Agrarreform, eher Institut für Anti-Agrarreform nennen sollte.[19]
Die Regierung Azaña geriet im Sommer und Herbst 1933 von beiden Seiten immer stärker unter Beschuss. Die Rechte erhöhte den ideologischen Druck auf die Regierung, indem sie eine antisozialistische Kampagne lancierte. Republikanische Kreise von konservativen Republikanern wie Miguel Maura bis hin zu Radikal-Sozialisten wie Gordón Ordax drängten daraufhin auf eine Beendigung der sozialistischen Mitarbeit in der Regierung. Die Sozialisten, mit rund 1,1 Mio. Mitgliedern in Partei und Gewerkschaft zahlenmäßig die stärkste politische Gruppierung des Landes[20], kündigten Azaña ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit auf. Largo Caballero verkündete vor einer begeisterten Arbeiterschaft in Madrid:
Wir haben unsere Verpflichtungen den Republikanern gegenüber für nichtig erklärt. (...) Wir müssen kämpfen, bis wir das jetzige System in eine sozialistische Republik umgewandelt haben.[21]
Die Regierung Azaña wurde Anfang September von einer auf die bürgerlichen Parteien gestützten Regierung unter Alejandro Lerroux abgelöst. Sozialistische und kommunistische Jugendverbände trugen daraufhin in Madrid den Protest auf die Straße. Aber auch in den Cortes, dem Parlament, hatte diese Regierung kaum einen Rückhalt; sie stürzte nach nur knapp drei Wochen. Neuer Premierminister wurde Martínez Barrio, der Stellvertreter von Lerroux. Er hatte den Auftrag, eine Übergangsregierung zu bilden, die Cortes aufzulösen und Neuwahlen auszuschreiben.
Es galt ein Wahlgesetz, das die republikanischen Parteien verabschiedet hatten, um eine Zersplitterung der Parteienlandschaft zu verhindern: in jedem Wahlkreis erhielt die stärkste Partei oder das stärkste Wahlbündnis 80% der Sitze, die diesem Wahlkreis zustanden, während sich die anderen Parteien die restlichen 20% der Sitze teilen mussten. Offensichtlich waren große Koalitionen im Vorteil, wovon das republikanisch-sozialistische Parteienbündnis ja 1931 profitiert hatte. Jetzt waren die Sozialisten aber mit Azañas "Acción Republicana" zerstritten; die Parteien der Linken traten einzeln an, während die Rechte ein Wahlbündnis formiert hatte[22].
Die Parlamentswahlen vom 19. November brachten einen erdrutschartigen Sieg des rechten Parteienbündnisses CEDA: sie kam auf 115 Sitze und wurde damit zur stärksten Partei im neuen Parlament. Zweitstärkste Kraft wurde die Radikale Partei des Alejandro Lerroux, der in Folge mit Unterstützung der CEDA mehrere Regierungen bilden sollte. Die republikanische Linke verlor dagegen den Großteil ihrer Sitze, davon allein der PSOE 54.[23]
Neben dem in dieser Situation für die Rechte günstigen Wahlgesetz spielten noch andere Faktoren eine Rolle für den Ausgang der Wahl. Im November 1933 wurden zum ersten Mal in der Geschichte Spaniens auch die Frauen zu den Urnen gerufen. Wie groß Ihr tatsächlicher Einfluss auf den Wahlsieg der Rechten gewesen ist, bleibt allerdings umstritten; das gleiche gilt auch für den Wahlboykott der Anarchosyndikalisten[24].
Die spanische Linke hatte die politische Entwicklung in Deutschland, besonders seit dem 30. Januar 1933, mit wachsender Besorgnis verfolgt. Mit dem Wahlsieg der CEDA sah sie nun auch in Spanien die Gefahr eines faschistischen Regimes heraufziehen. Die ideologische Wende der Sozialisten, die sich schon im Sommer und Herbst abgezeichnet hatte, wurde nun mit aller Deutlichkeit vollzogen. Dies sollte von großer Tragweite sein[25], wechselte doch mit den Sozialisten eine der bis dahin wichtigsten Stützen der Republik ins antirepublikanische Lager. Die Gewerkschaftszeitung der FNTT, El Obrero de la Tierra, wandelte sich zu einer Tribüne für Agitation und Propaganda. Nach einem Führungswechsel in der Gewerkschaft titelte das Blatt im Februar 1934:
Wir erklären, dass wir für die Revolution sind![26]
Largo Caballero setzte jetzt immer deutlicher auf revolutionäre Rhetorik. In einer Rede vor der sozialistischen Jugendorganisation am 20. April 1934[27] schob er jede Mäßigung beiseite:
Dinge von solcher Tragweite werden sich in Spanien ereignen, dass die Arbeiterklasse zur Rechtfertigung ihrer zukünftigen Aktionen klar Stellung beziehen mussZu einem gegebenen Zeitpunkt wird sich das Proletariat ohne Frage erheben und einen heftigen Schlag gegen seine Feinde ausführen. Sie sollen nicht sagen, wir seien unzivilisierte wilde Tiere, nur weil unsere Taten dann ihren jetzigen Taten entsprechen werden. Und die, deren Herzen jetzt unerbittlich sind, sollen dann nicht überrascht sein, wenn wir nutzlose Gefühlsduselei beseite geschoben haben. Wenn die Arbeiterklasse erst einmal an der Macht ist, können sie keine Waffenruhe von denen erwarten, denen jetzt eine Anstellung verwehrt wird und deren Kinder deswegen sterben müssen.[28]
Es gab allerdings auch innerparteilichen Widerstand gegen diese deutliche Abkehr von der Republik. Julián Besteiro, der sich ja in der Anfangszeit der Republik gegen eine zu enge Zusammenarbeit der Sozialisten mit der Regierung ausgesprochen hatte, plädierte nun für die Beibehaltung einer gemäßigten sozialreformerischen Position. Nach einem kurzen und heftigen Machtkampf um die Parteiführung im Januar 1934 setzte sich allerdings der radikale Parteiflügel um Largo Caballero durch. Besteiro und seine Anhänger wurden entmachtet. An die Spitze des einflussreichen El Obrero de la Tierra stieß ein junger militanter Sozialist, Ricardo Zabalza.
2.3. Die Radikalisierung des PSOE im Spiegel der Parteiprogramme von 1931 und 1934
2.3.1. Das Programm des PSOE vom 11. Juli 1931
Die Partei zeigte sich in der prorepublikanischen[29] Euphorie des Jahres 1931 in einem äußerst gemäßigten Licht. In neun Artikeln wurden die Grundanliegen der sozialistischen Politik formuliert. Der PSOE verteidigte ein parlamentarisches System (Art. 3) mit einer in Bezug auf Einzelfragen möglichst offen formulierten Verfassung (Art. 1), garantierte die Einhaltung der individuellen Persönlichkeitsrechte (Art. 2), die Gleichberechtigung der Geschlechter und das Scheidungsrecht (Art. 5). Den meisten Raum nahm Art. 4 ein, in dem die Grundzüge der Arbeits- und Sozialpolitik formuliert wurden, zum Beispiel die Anerkennung von Gewerkschaften und ihre Beteiligung an betrieblichen Entscheidungen (Abs. b). In den Absätzen d und e wurde auf die Dringlichkeit der Agrarfrage hingewiesen, die in einem "tief sozialistischen Sinn" gelöst werden sollte. Die Artikel 6 und 7 richteten sich gegen den Einfluss der katholischen Kirche. Während Art. 6 die "Trennung von Kirche und Staat und Vertreibung der religiösen Orden und Kongregationen und Beschlagnahmung ihres Besitzes." forderte, sprach sich Art. 7 für ein laizistisches Bildungswesen aus. Weiterhin bekannte sich der PSOE zu einer Unterstützung der Autonomiebestrebungen der nationalen Minderheiten (Art. 8). In Art. 9 schließlich wurde eine Erhöhung der Kapitalertragssteuer gefordert.
Der PSOE formulierte hier gemäßigt sozialistische Forderungen. Es fällt der moderate Ton in Bezug auf die Agrarfrage auf: hier wurde vor allem auf die Dringlichkeit dieses Problems hingewiesen - kein Wort aber von revolutionären Maßnahmen. Während das ganze Programm also mit Zurückhaltung - dies sicher im Hinblick auf den republikanischen Koalitionspartner - formuliert ist, fällt die außergewöhnliche Schärfe von Art. 6 auf. Mit dieser Maximalforderung war dem PSOE von Anfang an die offene Feindschaft der in Spanien sehr mächtigen katholischen Kirche sicher, und der katholisch-raktionären politischen Rechten wurde eine Steilvorlage für ihre aggressive antimarxistische Propaganda geliefert.
2.3.2. Das Programm des PSOE ab Januar 1934
Die oben dargestellte Radikalisierung des PSOE lässt[30] sich am neuen Parteiprogramm vom Januar 1934 deutlich ablesen. In zehn Artikeln wurde ein politisches Programm skizziert, das in seiner Tragweite weit über das von 1931 hinausging. Die Erfahrungen und Enttäuschungen aus fast drei Jahren Republik haben sich hier niedergeschlagen: statt offenen Formulierungen, die Kompromissbereitschaft signalisiert hätten, überwog eine harsche Tonart, und es waren mehrere Spitzen auch gegen die republikanischen Parteien eingebaut. Aber sehen wir uns das Programm im Einzelnen an.
In Art. 1 wurde deutlich, dass die Sozialisten von nun an revolutionäre Ziele verfolgen würden. Anstelle eines grundsätzlichen Bekenntnises zu den demokratischen Institutionen stand die Absichtserklärung, das nach wie vor drängende Agrarproblem, den gordischen Knoten des Landes, ein für alle Mal zu lösen:
Alle Ländereien Spaniens werden zu Staatseigentum erklärt werden.
Latifundien würden auf kollektive Bewirtschaftung umgestellt. Ausgenommen von dieser Maßnahme sollten lediglich Minifundien bleiben. Auch Art. 2 beschäftigte sich mit der Landwirtschaft: angesichts der bisher schleppenden Umsetzung von Landerschließung durch Bewässerung wurde ein großangelegtes Finanzierungsprogramm für die dringend nötigen "obras hidráulicas" (Bau von Bewässerungsanlagen) angekündigt. Hierzu würde der "größtmögliche Teil der nationalen Finanzrücklagen" verwendet. Erstaunlich ausführlich wurde in Art. 3 die Reform des Bildungswesens angesprochen. Der Zugang zu den Hochschulen sollte fortan nach einem strengen Leistungsprinzip geregelt werden; er würde denjenigen verwehrt, "von denen es in der Universität zur Zeit wimmelt und die kein anderes Verdienst haben, als dass sie aus einer ökonomisch privilegierten Situation stammen." Art. 4 kündigte die selben antiklerikalen Maßnahmen an, wie das schon im Programm von 1931 der Fall war - jetzt aber in einem noch schärferen Ton. Diesmal wurden auch Gründe genannt: die Monopolstellung der katholischen Kirche stehe dem "Minimum an Gewissensfreiheit, die in einem zivilisierten Staat verlangt werden kann" entgegen und "der auf barbarische Weise unnachgiebige Eifer der spanischen Katholiken, die trotz der Trennung von Kirche und Staat zur Beibehaltung des religiösen Fanatismus hinführen würden" sei ohnehin allgemein bekannt. In Art. 5 und 6 wurde die Auflösung und ein grundlegend anderer Neuaufbau der Streitkräfte und der Guardia Civil angekündigt. Ihre Schaltstellen sollten von denen besetzt werden, die eine "wirklich loyale Bindung zum neuen System" bewiesen hätten. Auch der Verwaltungsapparat sollte überprüft werden, wie Art. 7 ankündigte - besonders jene Beamten, "die wegen ihrer Abneigung gegen das System dieses auf die eine oder andere Art sabotiert" hätten. Vor revolutionären Maßnahmen in der Industrie schreckt der PSOE aber noch zurück, wie in Art. 8 deutlich wird. Es sollte lediglich eine "Verbesserung der moralischen und materiellen Lage der Industriearbeiter angestrebt werden", während man vor einer Kollektivierung wegen der "Gefahr des Scheiterns" vorerst Abstand nahm. Im am knappsten formulierten Art. 9 wird eine Steuerreform, besonders der Kapitalertragssteuer und der Erbschaftssteuer, angekündigt. Art. 10 schließlich entspringt der tiefen Unzufriedenheit der Sozialisten mit der schleppenden Umsetzung der Reformgesetze der ersten beiden Jahre: alle im Programm aufgezählten Punkte würden "schnell per Dekret umgesetzt". Und, da dieses "revolutionäre Programm nicht die Zustimmung dessen bekommen würde, der jetzt die Präsidentschaft der Republik innehat, würde die Absetzung desselben aus seinem Amt erfolgen."
Es hatte sich schon im Vorfeld der Novemberwahl 1933 (als der PSOE sich weigerte, ein Wahlbündnis einzugehen) gezeigt, dass Realitätssinn und taktisches Gespür nicht zu den Stärken der Sozialisten zählten. Mit diesem Programm aber konnte die gesamte Rechte schwarz auf weiß ihre schlimmsten Alpträume nachlesen. Es konnte nichts anderes als die politische Isolation der Sozialisten bewirken. Die erbittertste Feindschaft der wichtigsten Machtfaktoren im Staat war ihnen gesichert: neben der Kirche wussten nun auch Verwaltung, Armee, Guardia Civil, Landeigentümer und sogar Staatspräsident Niceto Alcalá Zamora, was sie bei einer sozialistischen Machtübernahme zu erwarten hätten. Die Distanzierung von der republikanischen Mitte und die scharfe Rhetorik gegen die Rechte führte aber nicht zum Schulterschluss mit den Anarchosyndikalisten, dem anderen, ebenfalls sehr einflussreichen Flügel der Arbeiterbewegung: In deren Augen blieben die Sozialisten, die sie sich ja gegen die Kollektivierung des industriellen Sektors aussprachen, eine mutmaßlich "konterrevolutionäre" Partei.
3. Die "Oktoberrevolution" von 1934
Obwohl José María Gil Robles mit der CEDA im November 1933 einen überwältigenden Wahlsieg errungen hatte, musste er mit Rücksicht auf die linksrepublikanischen Parteien zunächst auf eine Beteiligung an der Regierung verzichten. Die sozialen Spannungen im Land vergrößerten sich 1934 unter den verschiedenen Regierungen Lerroux weiter. Die Landreformgesetze wurden nicht umgesetzt oder durch durch Ergänzungen ausgehöhlt. Die Arbeitslosigkeit stieg weiter an; Streiks waren an der Tagesordnung, zuletzt hatte es im Juni einen von der UGT und der CNT getragenen Generalstreik gegeben. Gil Robles sah Anfang Oktober einen günstigen Moment gekommen, um die Regierung zu stürzen und eine Beteiligung seiner Partei an einer neuen Regierung zu fordern. Staatspräsident Alcalá Zamora hatte eine heikle Entscheidung zu treffen: Gil Robles hatte eigentlich einen legitimen Anspruch auf eine Regierungsbeteiligung - die Parteien der Linken würden dies allerdings als Kriegserklärung auffassen. Lerroux wurde schließlich beauftragt, ein Kabinett mit drei weniger prominenten CEDA-Ministern zu bilden[31]. Die UGT rief einen Tag später, am 5. Oktober, ihre Anhänger in ganz Spanien zum Generalstreik. Die Streikbewegung ergriff vor allem die Städte, da die Landarbeiter von den Nachwirkungen ihres Streiks im Juni noch zu geschwächt waren. Der Streik verlief überall gewaltfrei; lediglich an drei Punkten Spaniens kam es zu einer bewaffneten revolutionären Bewegung: in Barcelona, in Madrid und in der Minenregion Asturien.
In Barcelona hatte innerhalb der katalanischen Linken die kleine, aber straff organisierte nationalistische Gruppierung Estat Català um Dencás die Oberhand gewonnen, da sie über die Escamots verfügte, eine gut bewaffnete militärische Truppe. Dencás drängte den gemäßigten Präsidenten der katalanischen Regionalregierung, Lluis Companys, zur Unabhängigkeitserklärung. Dieser gab am 6. Oktober nach und rief am frühen Abend vom Balkon der Generalitat aus den "Estado Catalán de la República Federal Española" aus. Die katalanische Autonomie sollte von kurzer Dauer sein: ohne die Unterstützung der in Katalonien traditionell sehr starken CNT hatte der Aufstand viel zu wenig Rückhalt unter den Arbeitern. Und als sich der katalanische Garnisonskommandant, General Batet, mit dessen Unterstützung Companys gerechnet hatte, auf die Seite der Regierung Lerroux stellte, sanken die Aussichten auf ein militärisches Gelingen der Erhebung auf Null. Noch vor Tagesanbruch wurde die Generalitat gestürmt und Companys verhaftet.[32]
In Madrid leitete Largo Caballero persönlich den Aufstand - und bewies damit vor allem eines: "that his bark was worse than his bite."[33] Die Arbeiter waren trotz monatelanger revolutionärer Rhetorik und des Aufbaus von sozialistischen Milizen schlecht vorbereitet. Die einzige für sie bestimmte größere Waffenlieferung war einen Monat zuvor in Asturien in die Hände der Polizei gefallen. Andere Lieferungen wurden an den streng bewachten Zufahrtsstraßen abgefangen. Die Erhebung in Madrid blieb schließlich auf einige Straßenschlachten und einen Plan zur Sprengung des Innenministeriums beschränkt, dessen Ausführung die Polizei verhinderte.
Während die Erhebungen in Barcelona und Madrid nach wenigen Stunden niedergeschlagen wurden, kam es in Asturien zu einer revolutionären Bewegung, die einen Wendepunkt in der Geschichte der Zweiten Republik markieren sollte[34].
Im Unterschied zu Katalonien hatte sich in der Bergbauregion, trotz aller ideologischer Gegensätze und nicht zuletzt unter dem Eindruck der Entwicklung in Deutschland und Österreich, eine erstaunliche Kooperationsbereitschaft unter den wichtigsten Arbeiterorganisationen - UGT, CNT, Kommunisten[35] und Trotzkisten - gebildet. Diese auf Betreiben von Largo Caballero gegründete "Alianza Obrera" (Arbeiterallianz) hatte in den Bergdörfern Revolutionskomitees ins Leben gerufen, die auf die Beteiligung von CEDA-Ministern an der neuen Regierung hin unter dem Slogan UHP (Uníos, Hermanos Proletarios - Vereint Euch, proletarische Brüder) unverzüglich den Generalstreik erklärten. Im kommunistisch dominierten, hoch in den Picos de Europa gelegenen Mieres sowie in Sama de Langreo und Pola de Lena gelang am 5. Oktober die Überwältigung der Zivil- und Sturmgardeeinheiten. Von dort aus marschierten die Aufständischen in Richtung der 80.000 Einwohner zählenden Provinzhauptstadt Oviedo, die am nächsten Tag von etwa 8.000[36] mit Gewehren und Dynamit bewaffneten Minenarbeitern eingenommen wurde. Ein Komitee aus Sozialisten und Kommunisten wurde gebildet, das streng darauf bedacht war, Plünderungen, Ausschreitungen gegen die Zivilbevölkerung und blinde Racheakte zu verhindern[37]. Dennoch wurden in den folgenden zwei Wochen von den Aufständischen etwa 40 Personen getötet - die meisten von ihnen Priester. Die Repression sollte hingegen über 1000 Todesopfer fordern.
In Madrid fürchtete man indessen, dass der für die Wiederherstellung der Ordnung in Asturien zuständige General López Ochoa nicht hart genug durchgreifen würde - dem humanistischen Freimaurer eilte der Ruf voraus, gegen Arbeiter milde vorzugehen. Gil Robles drängte daher darauf, die Niederschlagung dem kurz zuvor ins Kriegsministerium berufenen General Franco zu übertragen. Alcalá Zamora, Lerroux und die liberaleren Kabinettsmitglieder lehnten dies zwar ab - es waren aber schließlich doch die Generäle Franco und Goded, die in ihrer Funktion als Berater des Kriegsministers Diego Hidalgo die Operation leiteten. Sie beschlossen, die in Afrika stationierten maurischen Einheiten (regulares) und die Fremdenlegion (tercio) in Asturien einzusetzen - besonders die Mauren waren für ihre Grausamkeit berüchtigt. Sie gingen am 8. Oktober in den Häfen Avilés und Gijón von Bord. Da das Komitee von Oviedo den CNT-dominierten Komitees der Küstenstädte misstraut und ihrem Abgesandten einen Waffennachschub verweigert hatte, war der Widerstand hier schnell gebrochen. Die Aufständischen wussten ab dem 9. Oktober, dass der Aufstand in ganz Spanien gescheitert war und sie sich komplett in der Defensive befanden. Angesichts dieser hoffnungslosen Lage und um unnötiges Blutvergießen und eine Zerstörung Oviedos zu verhindern, plädierte der sozialistische Anführer González Peña für eine Kapitulation. Die Minenarbeiter wollten aber mit dem Mut der Verzweiflung weiterkämpfen - und bedrohten González Peña zeitweise sogar mit der Hinrichtung wegen "Feigheit". Nur mit Mühe konnte er eine Sprengung der Kathedrale verhindern. Am Abend des 12. Oktober hatte López Ochoa ganz Oviedo bis auf den Bahnhof eingenommen.
Inzwischen hatten sich die regulares und der tercio an die Rückeroberung der Begdörfer gemacht. Das Oberkommando über diese Einheiten hatte Colonel Yagüe Blanco, ein Vertrauter Francos. Er ließ seine Soldaten mit äußerster Brutalität vorgehen. Mieres, wo der Aufstand seinen Anfang genommen hatte, wurde am 18. Oktober von den Regierungstruppen eingenommen. Die nun einsetzende Repression wurde von den Legionären, den Mauren und der Guardia Civil mit bisher ungekannter Grausamkeit durchgeführt. In Oviedo kam es zu Massenerschießungen von Gefangenen. Um Informationen über vermutete Waffenverstecke zu bekommen, wurde ein Folterkommando unter der Leitung eines gewissen Polizeimajors Doval aufgestellt[38].
Genaue Zahlen über die Opfer des Aufstandes liefert Tuñón de Lara: er nennt 1051 Tote Aufständische und 284 Tote auf Seiten der Armee sowie 30.000 Verhaftungen[39]. Auch so prominente Politiker wie Largo Caballero, Companys und Azaña saßen in Haft.
Die politische Auseinandersetzung um die Bestrafung der Aufständischen beschäftigte die spanische Öffentlichkeit in der Folgezeit wie kein anderes Thema. Die CEDA drängte auf strengste Verurteilung der Beteiligten. Auf ihr Betreiben wurde am 9. Oktober die Todesstrafe wieder eingeführt. Die rechte Presse lancierte eine Kampagne über die angeblichen Gräueltaten der Aufständischen. In welchem Maße Gil Robles versuchte, den Aufstand zur endgültigen Beseitigung seiner politischen Gegner zu instrumentalisieren, zeigt die Behandlung des früheren Ministerpräsidenten und Vorsitzenden der linksrepublikanischen Acción Republicana, Manuel Azaña: er hatte sich am 4. Oktober zufällig in Barcelona aufgehalten, war aber an dem Aufstand in der Generalitat nachweislich in keinster Weise beteiligt. Dennoch wurde er, obwohl er als Abgeordneter Immunität genoss, verhaftet, und die rechte Presse druckte falsche Berichte über seine angebliche Verstrickung in die Rebellion. Erst nach drei Monaten Haft wurde die gegenstandslose Anklage fallengelassen.
Insgesamt wurden in Zusammenhang mit dem asturischen Aufstand 30 Todesurteile verhängt, von denen allerdings nur zwei vollstreckt wurden. In den parlamentarischen Auseinandersetzungen um die Vollstreckung der Urteile drängten Gil Robles auf Strenge, Lerroux und Alcalá Zamora jedoch auf Milde - sie wollten einer weiteren Polarisierung des Landes gegensteuern und konnten mit der Tatsache argumentieren, dass die Beteiligten am Aufstand von General Sanjurjo im August 1932 auch nicht hingerichtet worden waren. Daher kam Companys mit einer Haftstrafe davon, Largo Caballero wurde freigelassen.
Die Beurteilungen der Oktoberrevolte sind so verschieden wie die politischen Überzeugungen ihrer Chronisten. Sie wirft die Frage nach der Rechtmäßigkeit von Widerstand allgemein auf - der in diesem Falle juristisch eindeutig den Tatbestand des Hochverrats erfüllte -, was im Rahmen dieser Arbeit nicht näher diskutiert werden soll und kann. Nur soviel:
Salvador de Madariaga urteilt angesichts der relativen Milde in den Strafprozessen gegen die Aufständischen:
Deshalb stelle ich fest, dass das Vorgehen der Regierung damals beweist, daß die Argumente[40], mit denen die sozialistisch-katalanistisch-anarchistische Kombination die Rebellion von 1934 zu rechtfertigen suchte, nichtig, falsch und scheinheilig sind.[41]
In der linken Geschichtsschreibung wurde der Kampf der asturischen Minenarbeiter hingegen zum Gründungsmythos der späteren Volksfront. Gerald Brenan schreibt:
Das Scheitern der Aufstände in Barcelona und Madrid war eine Schande; der Kampf der asturischen Bergarbeiter jedoch war eine Heldentat, die die Bourgeoisie entsetzte und die gesamte spanische Arbeiterklasse begeisterte. Man kann darin wohl die erste Schlacht des Bürgerkrieges sehen.[42]
Eine überraschende Position bezog Manuel Giménez Fernández, zur Zeit des Aufstandes frischgebackener CEDA-Agrarminister, am 12. Oktober 1934 gegenüber den Mitarbeitern seines Ministeriums:
Die Unruhen, die gegen den Staat ausgebrochen sind, haben nicht der auf der Seite der Rebellen angefangen, sondern auf unserer Seite, denn der Staat selbst hat sich viele Feinde geschaffen, indem er dauerhaft all seinen Bürgern gegenüber seine Pflichten vernachlässigt hat.[43]
Wie im folgenden Kapitel zu sehen sein wird, sollten solch besonnene, selbstkritische Töne aus den Reihen der CEDA die Ausnahme bleiben.
4. Die Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA)
Als Reaktion auf die Gründung der Republik hatte die katholische Organisation Acción Católica 1931 die Partei Acción Popular gegründet. Diese trat vor allem gegen die antiklerikalen Elemente der Republik ein. Es wurde zwar ein Sozialprogramm formuliert; die ohnehin geringen reformerischen Bestrebungen der Partei wurden aber von ihren Geldgebern, hauptsächlich Großgrundbesitzern, erstickt. An die Spitze der Partei wurde der junge José María Gil Robles berufen, der bis dahin Redaktionsmitglied der von den Jesuiten kontrollierten Zeitung Debate gewesen war . Es wurde für ihn eine Hochzeit mit der Tochter des Grafen Revillagigedo, damals einer der reichsten Männer Spaniens, arrangiert. Die Hochzeitsreise ging nach Deutschland. Fasziniert von der nationalsozialistischen Bewegung, besuchte Gil Robles unter anderem den Nürnberger Parteitag. Als die Nationalsozialisten allerdings eine antikirchliche Politik zu verfolgen begannen, orientierte sich Gil Robles fortan eher an Dollfuß. Der österreichische Korporativstaat sollte sein Leitkonzept für die Umgestaltung Spaniens werden - sein politischer Stil hingegen erinnerte weiterhin sehr stark an die Nationalsozialisten[44].
Als sich Anfang 1933 - nach dem enormen Prestigeverlust der Regierung Azaña in Zusammenhang mit der Repression des Casas Viejas-Aufstandes[45] - abzeichnete, dass Alcalá Zamora die Cortes in absehbarer Zeit auflösen und Neuwahlen ausschreiben könnte, nahm Gil Robles die Bildung einer Blockpartei in Angriff, um das bestehende Wahlgesetz optimal ausnützen zu können. Er schloss der Acción Popular mehrere kleine Gruppierungen aus dem rechten politischen Spektrum an und gründete mit ihnen die Confederación Española de Derechas Autónomas, kurz CEDA. Das im Februar 1933 verkündete politische Programm[46] entsprach weitgehend dem der Acción Popular: die Interessen der katholischen Oberschicht sollten gewahrt werden. Die Agrarpolitik der Partei orientierte sich an konservativen, auf Privateigentum basierenden Richtlinien, sozialistische und laizistische Gesetze sollten bekämpft werden. Die CEDA bekannte sich zur Republik, forderte aber ein korporatives System, "das dem organischen Wesen der Gesellschaft entsprechen soll." (Art.. II., Abs. 3)
Für die Linke war die CEDA mit ihrer uniformierten Jugendorganisation JAP (Juventud de Acción Popular), ihren Aufmärschen, ihrem Führerkult (Gil Robles war der 'Jefe', dem von seinen Anhängern Unfehlbarkeit zugeschrieben wurde) und ihrem ständestaatlichen Programm die Verkörperung des Faschismus schlechthin[47], was die heftige Reaktion der Linken auf die Regierungsumbildung am 4. Oktober 1934 erklärt und zum unmittelbaren Auslöser der Erhebung wurde.
Nach den Parlamentswahlen Ende 1933, aus denen die CEDA als Siegerin hervorging[48], bildete Alejandro Lerroux von der Radikalen Partei eine von der CEDA gestützte Regierung - der erste Schritt, so glaubte Gil Robles, auf seinem unaufhaltsamen Aufstieg zur Macht[49]. Er gab zwar vor, sich an geltendes Recht zu halten - seine eigentlichen Pläne ließen sich aber schon 1933 an zahlreichen öffentlichen Stellungnahmen ablesen. Die Rechte hatte bereits 1932 bei der Niederschlagung der Sanjurjo-Revolte gelernt, dass gegen den Repressionsapparat des Staates kaum etwas auszurichten war. Gil Robles' Taktik bestand daher darin, auf legalem Wege die Macht an sich zu bringen, um den Staat anschließend nach seinen Vorstellungen umzugestalten. Kurz vor den Wahlen hielt er vor seinen Anhängern eine Rede:
Wir müssen vorwärts gehen zu einem neuen Staat. Wen interessiert es schon, wenn dabei Blut vergossen wird? Wir müssen endlich Nägel mit Köpfen machen, darauf kommt es an. Um dieses Ideal zu erreichen, werden wir uns nicht von überlieferten Vorstellungen zurückhalten lassen. Demokratie ist für uns nicht das Ziel, sondern ein Mittel, das wir zur Eroberung des neuen Staates benutzen. Wenn dieser Moment gekommen ist, werden die Cortes klein beigeben, oder wir werden sie von der Bildfläche verschwinden lassen.[50]
Und am 19. Dezember, einen Tag nach der ersten Regierungsbildung durch Lerroux, erklärte er in den Cortes:
Heute werde ich die Bildung von Regierungen der Mitte ermöglichen; morgen, wenn die Zeit kommt, werde ich die Macht einfordern und ich werde eine Verfassungsreform durchführen. Falls wir die Macht nicht erhalten, falls die Ereignisse zeigen, dass eine rechtsgerichtete Entwicklung der Politik nicht möglich ist, wird die Republik die Konsequenzen bezahlen. Dies ist keine Drohung, sondern eine Warnung.[51]
Stark vereinfacht lässt sich die Machtkonstellation der folgenden 10 Monate, während derer die CEDA auf eine Regierungsbeteiligung warten musste, auf drei Hauptpole reduzieren: Gil Robles, der darauf drängte, den jeweils nächsten Schritt auf dem Weg zur Macht zu tun und für den die Zusammenarbeit mit der Radikalen Partei nichts weiter als Mittel zum Zweck war[52] ; Alejandro Lerroux, der die CEDA durch eine Regierungsbeteiligung zu zähmen hoffte und damit in seiner eigenen Partei die Entstehung eines dissidenten linken Flügels um Martínez Barrio provozierte; Staatspräsident Alcalá Zamora, der beiden tief misstraute und mit seinem persönlichen, zum Teil eigenwilligen Politikstil das Ansehen der Republik zu retten versuchte.
Azaña war mit einer gestärkten Machtposition aus der Sanjurjo-Rebellion im August 1932 hervorgegangen: einen Monat später verabschiedeten die Cortes sein Agrarreformgesetz, für das er so lange gekämpft hatte. Auf ähnliche Art und Weise profitierte die CEDA davon, dass sich ihre politischen Gegner in ihrem Umsturzversuch im Oktober 1934 als Republikaner diskreditierten. Gil Robles versuchte alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die ihm die Revolte zur Schwächung der Linken geliefert hatte: die sozialistischen Casas del Pueblo wurden geschlossen; mehrere Gewerkschaftszeitungen wurden verboten. Gil Robles drängte auf harte Bestrafung aller Beteiligten und auf Vollstreckung der Todesurteile, von denen aber schließlich fast alle durch den mäßigenden Einfluss von Alcalá Zamora in Haftstrafen umgewandelt wurden.
Es wurde Gil Robles im nachhinein immer wieder zugute gehalten, dass er im Herbst 1934, als scheinbar der günstigste Moment gekommen schien, keinen Staatsstreich durchführte und weiter die legalistische Taktik verfolgte. Tatsache ist, dass er schon am 19. Oktober 1934 bei Franco, Fanjul und anderen Generälen die Möglichkeiten einer vom Militär gedeckten Machtübernahme sondierte. Diese teilten ihm aber mit, dass sie nicht über die für einen solchen Schritt notwendigen Kräfte verfügten[53].
Die CEDA bestand aber nicht nur aus Männern, die öffentlich erklärten, einen Ständestaat errichten zu wollen, und heimlich Putschpläne schmiedeten. Mit Manuel Giménez Fernández stellte die Partei einen Agrarminister, der mit seinem Katholizismus einen sozialpolitischen Auftrag verband. Der Professor für kanonisches Recht an der Universität Sevilla und spätere Bartolomé de Las Casas-Experte glaubte, Azañas Agrarreformgesetz durch einige kleine Nachbesserungen für die Landeigentümer akzeptabel machen zu können. Während der ersten drei Monate seiner Amtszeit ergriff er zwei Gesetzesinitiativen, von denen die erste (5. November 1934) die Vertreibung von yunteros (Subpächtern) von besetzten Grundstücken verhindern sollte - die Vorlage wurde im letzten Moment im Parlament von den Monarchisten blockiert, aber schließlich Ende Dezember verabschiedet. Die zweite Initiative war ein Dekret, das am 2. Januar 1935 verabschiedet wurde und Ausdruck des politischen Spagats war, den Giménez Fernández zwischen seinen konservativen, Privateigentum respektierenden Überzeugungen und seiner Einisicht in die Dringlichkeit einer Neuverteilung des spanischen Agrarlandes vollziehen musste. Es besagte, dass das IRA (Agrarreforminstitut) statt Enteignungen - für die der Staat zu diesem Zeitpunkt keine angemessenen Entschädigungen hätte bezahlen können - vorläufige Besetzungen vornehmen sollte. Später sollte auf Grundlage eines neuen Gesetzes eine endgültige Lösung gefunden werden.
Während der Agrarminister mit diesen vorläufigen Regelungen auf vergleichsweise geringen Widerstand in den Cortes stieß, formierte sich auf seine Initiative zu einer dauerhaften Neuregelung der Pachtgesetzgebung hin eine parlamentarische Front, die aus Monarchisten, Agrariern und dem rechten Flügel der CEDA bestand und seine Vorlagen erbittert bekämpfte oder durch Zusätze in ihr Gegenteil verdrehte[54].
Als im März 1935 zwei am Oktober-Aufstand beteiligte Sozilisten hingerichtet werden sollten, Lerroux und Alcalá Zamora aber eine Begnadigung in Betracht zogen, provozierte Gil Robles erneut eine Regierungskrise. Er wollte offensichtlich die Gelegenheit nutzen, um die Position der CEDA auszubauen. Giménez Fernández bekleidete nach der Regierungsumbildung seinen Ministerposten nicht mehr. Das Agrarministerium fiel stattdessen Nicasio Velayos von der Agrarpartei zu, die die Interessen der Großgrundbesitzer vertrat - womit jede Aussicht auf eine gerechtere Landverteilung in weite Ferne rückte.
In der neuen Regierung, die am 6. Mai 1935 gebildet wurde, stellte die CEDA fünf Minister. Gil Robles selbst wurde Kriegsminister. Eine seiner ersten Maßnahmen war es, die Schlüsselstellen der militärischen Hierarchie mit bekanntermaßen antirepublikanischen Generälen zu besetzen (die 1936 die Protagonisten des pronunciamiento sein sollten): Franco wurde Generalstabschef; Fanjul, dem man das Bonmot nachsagte, dass "alle Parlamente der Welt nicht einen spanischen Soldaten wert" seien, wurde Staatssekretär, und Goded, der in die konspirative Unión Militar Española involviert war, wurde Generalinspekteur und Chef der Luftwaffe. Gil Robles betrieb die Ersetzung von republikanisch gesinnten Offizieren durch Reaktionäre während seiner gesamten Amtszeit konsequent weiter und führte eine Reihe von Maßnahmen durch, die alle auf eine Stärkung des Militärs abzielten und es vor allem als innenpolitisches Machtinstrument gegen eventuelle Aufstände der Arbeiterschaft ausbauten: so wurden beispielsweise in Asturien Manöver abgehalten, um bei zukünftigen Erhebungen besser reagieren zu können; General Mola wurde zum Chef der Marokkoarmee ernannt und angewiesen, seine Einheiten für die Unterdrückung von Arbeiterunruhen bereit zu halten[55].
Auch im Agrarsektor wurde nun eine offen reaktionäre Politik betrieben. Unter Agrarminister Velayos wurde im Juli - nachdem die Linke heftig protestiert und schließlich aus dem Parlament ausgezogen war - das "Gesetz zur Reform der Agrarreform" verabschiedet, das das Gesetz von September 1932 praktisch außer Kraft setzte. Es regelte die Bedingungen, unter denen Landenteignungen durchgeführt werden konnten. Ab sofort konnten Großgrundbesitzer die Größe ihrer Ländereien leicht unter die gesetzliche Grenze drücken, ab welcher Enteignungen möglich waren, z.B. durch Überschreibung von Teilen ihres Besitzes an Familienmitglieder. Und falls es doch zu einer Enteignung kam, konnte die Höhe der Entschädigung rechtlich angefochten und letztendlich bis zu einer Höhe des aktuellen Marktwertes erstritten werden. Großgrundbesitzer hatten also fortan die Wahl, sich der Enteignung entweder durch einen legalen Winkelzug zu entziehen oder ihre - oft brachliegenden - Ländereien mit gutem Profit an den Staat zu verkaufen[56]. Außerdem wurde eine Höchstgrenze für den Etat des IRA auf 50 Millionen Pesetas festgesetzt - was bis dahin als Mindestbetrag vorgesehen war. Malefakis schätzt, dass eine mindestens fünf bis sechsmal so große Summe nötig gewesen wäre, um die Reform wirksam umzusetzen[57].
Im Herbst 1935 kam es zu einer neuen Regierungskrise: Mitte September traten zwei Minister der Agrarpartei, Royo Villanova und Velayos, aus Protest gegen eine Autonomieregelung für Katalonien zurück. Gleichzeitig drohte ein Korruptionsskandal um einen belgischen Casino-Betreiber (die Estraperlo-Affäre[58] ), in den die Radikale Partei verwickelt war, an die Öffentlichkeit zu dringen und die politische Karriere Lerroux' zu beenden. Alcalá Zamora ernannte daraufhin Finanzminister Chapaprieta zum Premierminister - er sollte die weitere Zusammenarbeit zwischen Lerroux, der ins Außenministerium wechselte, und Gil Robles sicherstellen. Dieser akzeptierte die Konstellation, weil er zu diesem Zeitpunkt nichts mehr fürchtete als die Auflösung der Cortes, Neuwahlen und einen möglichen Wiederaufstieg der Linken. Aber auch die Regierung Chapaprieta sollte von kurzer Dauer sein: als die CEDA seiner Steuerreform die parlamentarische Unterstützung verweigerte, erklärte er am 9. Dezember 1935 seinen Rücktritt.
Staatspräsident Alcalá Zamora boten sich nun zwei Möglichkeiten: er musste entweder die Cortes auflösen und Neuwahlen ausschreiben oder Gil Robles - der die Macht zum Greifen nahe glaubte und keine weiteren Minderheitsregierungen zu unterstützen bereit war - zum Regierungschef ernennen. Am 11. Dezember musste der 'Jefe' aber erfahren, dass er zu hoch gepokert hatte: Alcalá Zamora teilte ihm mit, dass er ihm den Posten des Premierministers nicht anbieten würde[59].
General Fanjul, Staatssekretär im Kriegsministerium, bot seinem Dienstherrn daraufhin an, die Truppen zur Machtübernahme einzusetzen. Gil Robles' Antwort ist in seiner politischen Autobiographie mit dem programmatischen Titel No fue posible la paz (Frieden war nicht möglich) überliefert:
Heute macht man Militärrevolten nicht wie im 19. Jahrhundert, vor allem wenn man mit einer heftigen Reaktion der Massen rechnen muss...Außerdem werde ich keine Erhebung zu meinen Gunsten versuchen, da mir dies die Kraft meiner demokratischen Überzeugungen und die Abneigung gegen eine Dienstbarmachung der Streitkräfte zugunsten einer politischen Gruppierung verbieten. Falls die um seine natürlichen Befehlshaber versammelte Armee der Meinung ist, dass sie vorübergehend die Macht übernehmen muss mit dem Ziel, den Geist der Verfassung zu retten und einen gigantischen Betrug unter revolutionären Vorzeichen zu vermeiden, werde ich demnach nicht das geringste Hindernis darstellen und alles Nötige tun, damit die permanente Handlungsfähigkeit der Staatsmacht nicht unterbrochen wird.[60]
In der folgenden Nacht berieten die Generäle Fanjul, Goded, Varela und Franco über die Erfolgsaussichten eines Staatsstreichs. Sie kamen zu dem Schluss, dass der Zeitpunkt für eine Erhebung noch nicht gekommen sei. Gil Robles musste am 13. Dezember seinen Posten im Kriegsministerium räumen.
Alcalá Zamora versuchte in der zweiten Dezemberhälfte zwar noch, Neuwahlen zu verhindern, aber die Minderheitsregierungen unter Portela Valladares waren ohne die Beteiligung und parlamentarische Unterstützung der CEDA zum Scheitern verurteilt. Der Staatspräsident löste Anfang Januar die Cortes aus und ließ Neuwahlen ausschreiben.
Die "Volksfrontwahl" vom 16. Februar 1936 sollte das politische Pendel Spaniens nocheinmal nach links ausschlagen lassen, bevor im Juli 1936 das Militär im Schulterschluss mit der politischen Rechten die nie zu den Akten gelegten Putschpläne in die Tat umsetzte.
5. Schlussbetrachtung
Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit war die Frage nach den Gründen für das Scheitern der II. Spanischen Republik. Dabei wurde von der Arbeitshypothese ausgegangen, dass für die zunehmende Radikalisierung der politischen Landschaft jener Zeit zwei Parteien eine entscheidende Rolle gespielt haben: der PSOE und die CEDA. Eine Beschreibung der Ereignisse im Oktober 1934 bot sich zur Strukturierung der Arbeit an.
Wie in der Arbeit erwähnt, hatten die Sozialisten bereits unter der Diktatur Primo de Riveras Bereitschaft zur Mitarbeit im Staat gezeigt. Dies steigerte sich in den ersten beiden Jahren der Republik, als der PSOE in linksrepublikanischen Kabinetten mehrere Minister stellte, zu einer regelrechten prorepublikanischen Euphorie. Die sozialistische Arbeiterschaft stellte hohe Erwartungen an den neuen Staat; da diese mit den Mitteln einer parlamentarischen Demokratie nur allmählich erfüllt werden konnten, wurde sie von ihren Anführern immer wieder zu Mäßigung und Durchhaltevermögen ermahnt. Eine deutliche Radikalisierung der sozialistischen Positionen setzte mit dem Wahlsieg des rechten Parteienbündnisses CEDA bei den Parlamentswahlen im November 1933 ein. Im Laufe des Jahres hatte sich, bedingt durch die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise und die schleppende Umsetzung von Azañas Agrarreformgesetz, die Lage der Arbeiter weiter verschlechtert, was zu einem allmählichen Vertrauensschwund in die Institutionen der Republik, besonders in das IRA, führte. Mit der Machtübernahme durch konservative, teils offen reaktionäre Kräfte schlug auch in den sozialistischen Kadern die prorepublikanische Einstellung in Revolutionsträume um. Dies lässt sich sehr deutlich am neuen Parteiprogramm von Januar 1934 ablesen. In den Folgemonaten wurden eifrig Milizen gebildet und, vor allem vom Parteivorsitzenden Largo Caballero, alle Register der revolutionären Rhetorik gezogen. Als im Oktober mit der Beteiligung von drei CEDA-Ministern an der neuen Regierung die UGT eine faschistische Machtübernahme nahe glaubte, den Generalstreik ausrief und die Arbeiter an einigen Punkten Spaniens zu den Waffen griffen, stellte sich aber heraus, dass die Erhebung miserabel vorbereitet war und zu diesem Zeitpunkt wesentlich mehr schadete als nützte.
Die Erhebung, die in Madrid und Barcelona ein völliges Desaster, in Asturien durch den Schulterschluss von Sozialisten, Anarchisten und Kommunisten eine relativ erfolgreiche, aber isolierte und daher ebenso zum Scheitern verurteilte Aktion war, bestätigte die Ängste des konservativ-katholischen Teils der Gesellschaft vor einer marxistischen Revolution, provozierte massive Sanktionen gegen linke Institutionen, stärkte die politische Rechte und führte zu einer noch tieferen Spaltung Spaniens.
Bei den Sozialisten im Allgemeinen und bei ihrem Parteichef Francisco Largo Caballero im Besonderen bildete sich, wie gezeigt werden konnte, erst ab Ende 1933 eine antirepublikanische Haltung heraus - ab dem Zeitpunkt also, als sie die Rolle der Opposition übernehmen mussten. Eine von konservativen Parteien regierte Republik konnte offensichtlich nicht mehr ihre "Niña Bonita" sein.
Dass sich eine aus einer katholischen Organisation hervorgegangene und von Großgrundbesitzern finanzierte Partei wie die CEDA nicht mit einer linksrepublikanisch-sozialistisch regierten Republik identifizierte, die die Kirche entmachten und die Latifundisten enteignen wollte, lag in der Natur der Sache. Aber auch der Machtwechsel Ende 1933 änderte nichts an dem fundamentalen Misstrauen, das die politische Rechte gegenüber der Republik empfand. Abgesehen von dem sozialreformerischen Flügel um Giménez Fernández betrieb die Partei in enger Kooperation mit Agrariern und Monarchisten systematisch die Sabotage und Demontage von sozialreformerischen Ansätzen; gleichzeitig besetzte sie alle Schlüsselpositionen des Militärs mit offen antirepublikanisch gesinnten Offizieren.
Die zentrale Figur dieser Entwicklung war der Parteiführer Gil Robles, der mit seiner parlamentarischen Mehrheit Regierungen nach Belieben stützen oder stürzen konnte und der seinen Posten als Kriegsminister ab Mai 1935 systematisch zum oben beschriebenen Umbau des militärischen Führungsstabs missbrauchte. Dennoch hat er im Lauf des Jahres 1935 immer wieder öffentlich beteuert, keine Putschpläne zu schmieden. Die Öffentlichkeit war daher tief verunsichert über seine 'wahren Absichten'[61]. Aber selbst die wohlwollendste Beurteilung des CEDA-Führers kann nicht darüber hinwegsehen, dass er, wenn er auch selbst keine konkreten Pläne für einen coup d'état entworfen haben mag, so doch alles tat, um der Armeeführung diesen Weg zu ebnen - und wie sein Brief an Fanjul vom Dezember 1935 zeigt, hätte er keine Sekunde gezögert, sich an die Spitze eines Staatsstreichs zu stellen.
Beide Parteien haben also entscheidend zum Scheitern der Republik beigetragen. Während die Sozialisten sich aber von einer anfänglich entschlossen prorepublikanischen zu einer revolutionären Partei erst wandelten und damit wichtige Anstöße zur weiteren Polarisierung der spanischen Gesellschaft lieferten, war die Haltung der CEDA und v.a. die ihres Anführers Gil Robles, der die Partei als 'Jefe' dominierte, von Anfang an von tiefem Misstrauen gegenüber dem republikanischen Modell geprägt. Dieses Misstrauen bewog Gil Robles dazu, die republikanischen Offiziere der Streitkräfte zu entlassen und ihre reaktionären, gegebenenfalls zu einem Putsch bereiten Teile konsequent zu stärken.
Ohne die solide Vorarbeit von Gil Robles hätte ein in militärischen Dingen vorsichtiger General wie Franco den Putsch im Juli 1936 vermutlich nicht gewagt. Der britische Historiker Sir Raymond Carr sah in dem Wesen und Schicksal der CEDA "one of the keys to the fall of the Second Republic."[62]
Diesem Urteil möchte ich mich auf Grundlage der hier vorgelegten Arbeit anschließen.
Die Gründe für das Scheitern der II. Republik sind natürlich wesentlich vielschichtiger, als es im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden konnte. Für die Überwindung einer anachronistischen Wirtschafts- und Sozialstruktur mit den Mitteln einer parlamentarischen Demokratie hätte beispielsweise die politische Großwetterlage kaum ungünstiger sein können als Anfang der 1930er-Jahre: Die Aussicht auf eine kommunistische oder faschistische Machtübernahme versetzte sowohl die liberale Mitte als auch das jeweils gegnerische politische Lager in Panik und beschleunigte die Radikalisierung der spanischen Parteienlandschaft. Hinzu kam, dass Spanien sowohl auf direktem - über den Einbruch des Außenhandels - als auch indirektem Wege - über die erzwungene Rückkehr von Emigranten, die ihre Anstellungen im Ausland verloren hatten - die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise zu spüren bekam. So erheblich das Eingreifen anderer Mächte, besonders Deutschlands und Italiens, für den Ausgang des Bürgerkriegs sein sollte, so gering war aber deren unmittelbare Einwirkung während der republikanischen Zeit bis 1936[63].
Die politische Krise der II. Spanischen Republik war in erster Linie hausgemacht: neben den in dieser Arbeit näher untersuchten Parteien trugen viele andere Gruppierungen ihren Teil zum Scheitern des parlamentarischen Modells bei - Anarchosyndikalisten im linken, Monarchisten, Karlisten und die Katholische Kirche im rechten Spektrum, um nur die wichtigsten zu nennen.
Manuel Azaña, die herausragende Figur der linksrepublikanischen Mitte, fasst die gut fünf Jahre, die die II. Spanische Republik vor Ausbruch des Bürgerkriegs Bestand hatte, mit den folgenden Worten zusammen:
Was eine normale Entwicklung mit Fortschritten und Rückschlägen sein sollte, wurde ab 1934, zur Verblüffung der Republikaner und jenes Teils der Sozialisten, auf die ich zuvor angespielt habe [des republiktreuen Teils], zu einem blinden Wettlauf in die Katastrophe.[64]
Eine solche "normale Entwicklung" hätte eine solide republikanische Mitte vorausgesetzt, um im freien Spiel der Kräfte demokratisch legitimierte Entscheidungen zu treffen. Hier scheint denn auch der eigentliche Mangel zu liegen, an dem die II. Spanische Republik krankte: der Mangel an Republikanern.
6. Quellen und Literatur
Artola, Miguel 1975: Partidos y programas políticos 1808-1936. II. Manifiestos y programas políticos. Madrid: Aguilar.
Azaña, Manuel 1986: Causas de la guerra de España. Barcelona: Editorial Crítica.
Ballbé, Manuel 1983: Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983). Madrid: Alianza.
Bernecker, Walther L. 1978: Anarchismus und Bürgerkrieg. Zur Geschichte der Sozialen Revolution in Spanien 1936-1939. Hamburg: Hoffmann und Campe.
− 1993: Arbeiterbewegung und Sozialkonflikte im Spanien des 19. und 20. Jahrhunderts. Frankfurt am Main: Vervuert.
− / Pietschmann, Horst 21997: Geschichte Spaniens. Von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Stuttgart: Kohlhammer.
Blinkhorn, Martin 1975: Carlism and Crisis in Spain 1931-1939. Cambridge: Cambridge University Press.
− 1986: Spain in Conflict 1931-1939. London: Sage. Brenan, Gerald 1978: Die Geschichte Spaniens. Übr die sozialen und politischen Hintergründe des Spanischen Bürgerkrieges. 'The Spanish Labyrinth'. Berlin: Karin Kramer.
Carr, Raymond 1980: Modern Spain 1875-1980. Oxford: Oxford University Press.
- 1966: Spain 1808-1939. Oxford: Clarendon Press. Egido León, Ángeles 1984: La política exterior de España durante la II República (1931- 1936). Proserpina 1, 99-144.
García Delgado, José Luís (Hg.) 1988: La II República Española. Bienio Rectificador y Frente Popular, 1934-1936. Madrid: Siglo XXI.
Hofmann, Bert (Hg.) 1995: El anarquismo español y sus tradiciones culturales. Frankfurt am Main: Vervuert.
Jackson, Gabriel 1982: Annäherung an Spanien 1898-1975. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
− 1965: The Spanish Republic and the Civil War. Princeton: Princeton University Press.
Little, Douglas 1985: Malevolent Neutrality. The United States, Great Britain and the Origins of the Spanish Civil War. Ithaka and London: Cornell University Press.
Lozano González, Jesús 1973: La Segunda República. Imágenes, Cronología y Documentos. Barcelona: Acervo.
Madariaga, Salvador de 31979: Spanien. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.
Malefakis, Edward E. 1970: Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain. Origins of the Civil War. New Haven and London: Yale University Press.
Preston, Paul 21994: The coming of the Spanish Civil War. Reform, Reaction and Revolution in The Second Republic. London and New York: Routledge.
Schmidt, Bernhard 1975: Spanien im Urteil spanischer Autoren: kritische Untersuchungen zum sogenannten Spanienproblem: 1609-1936. Berlin: Erich Schmidt.
Tuñón de Lara, Manuel 1981: Historia de España. Tomo IX. La crisis del estado: Dictadura, República, Guerra. Barcelona: Editorial Labor.
− 1985: Historia de España. Tomo XII. Textos y documentos de historia moderna y contemporánea (siglos XVIII-XX). Barcelona: Editorial Labor.
[...]
[1] cf. Lozano González 1973: 466-474.
[2] Malefakis 1970
[3] Preston 21994
[4] Tuñón de Lara 1981
[5] Madariaga 31979: 251. Siehe hierzu auch das in seinem Urteil im Vergleich zu dem Madariagas wesentlich differenziertere epilogartige Kapitel "Reflexionen über die spanische Kultur" in Jackson 1982: 199-214.
[6] Azaña 1986: 29. Ich habe in der vorliegenden Arbeit englische Zitate im Original belassen; original spanische Zitate, auch solche aus englischsprachigen Sekundärwerken, habe ich ins Deutsche übertragen.
[7] Schmidt 1975: 307.
[8] "In fact, (...) the main cause of the breakdown of the Second Republic was the struggle between the PSOE and the legalist Right, particularly the Confederación Española de Derechas Autónomas, to impose their respective views of social organisation on Spain by means of their control of the apparatus of the state." (Preston 21994: 2-3)
[9] Bericht von General Bazán. Zit. nach Malefakis 1970: 318.
[10] Von den 259 Sitzen, die das aus fünf Parteien bestehende linke Wahlbündnis erhielt, entfielen allein 113 auf den PSOE. Cf. García Delgado 1988: 6.
[11] zit. nach Malefakis 1970: 319
[12] 21. Mai 1932, zit. nach Malefakis 1970: 321.
[13] zur anarchistischen Ideologie in der Zweiten Republik cf. Bernecker 1993: 77-83 und Hofmann 1995: 79-108.
[14] El Obrero de la Tierra, 26. März 1932. zit. nach Malefakis 1970: 322.
[15] cf. Brenan 1978: 313.
[16] Genaue Zahlen liegen nicht vor. Zu den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise auf den spanischen Arbeitsmarkt cf. Malefakis 1970: 284 ff.
[17] El Obrero de la Tierra, 1. Mai 1933. zit. nach Malefakis 1970: 324.
[18] El Socialista, 4. Juli 1933. zit. nach Malefakis 1970: 324.
[19] El Obrero de la Tierra, 19. u. 26. August 1933. zit. nach Malefakis 1970: 326.
[20] cf. Tuñón de Lara 1981: 162.
[21] zit. nach Tuñón de Lara 1981: 163.
[22] cf. hierzu Brenan 1978: 332, Anm. 1.
[23] Eine tabellarische Gegenüberstellung der Cortes von 1931 und 1933 findet sich in García Delgado 1988: 6.
[24] cf. hierzu Brenan 1978: 305-306 und Tuñón de Lara 1981: 167-172.
[25] "The change of attitude in the Socialist party was of (...) momentous importance to the history of the Republic (...)". Malefakis 1970: 317
[26] El Obrero de la Tierra, 3. Februar 1934. zit. nach Malefakis 1970: 326-327. Der Kurswechsel vollzog sich allerdings nicht so abrupt, wie Malefakis es darstellt. So veröffentlichte das Blatt noch im April 1934 einen Brief an den Staatspräsidenten, in dem dieser an die Notlage der Landarbeiter erinnert und höflich darum gebeten wird, seinen Einfluss in ihrem Sinne einzusetzen. cf. Tuñón de Lara 1985: 435-436.
[27] Die Zerschlagung der sozialistischen Organisationen Österreichs durch Dollfuß im Februar 1934 hatte die spanischen Sozialisten mit großer Besorgnis erfüllt: sie befürchteten ein ähnliches Schicksal durch Gil Robles, der Dollfuß ideologisch sehr nahe stand.
[28] Largo Caballero, Discursos a los trabajadores, S. 132. zit. nach Malefakis 1970: 327.
[29] cf. Artola 1975: 450-451.
[30] cf. Artola 1975: 452-453.
[31] Die CEDA erhielt die Ministerien für Justiz, Landwirtschaft und Arbeit. cf. Tuñón de Lara 1981: 209, Anm.1.
[32] Brenan äußert die Vermutung, Dencás hätte als agent provocateur den Aufstand angezettelt und seinen escamots gleichzeitig verboten, Companys zu unterstützen. cf. Brenan 1978: 321-322. Dies scheint angesichts seines extrem ausgeprägten katalanischen Nationalismus allerdings wenig plausibel.
[33] Jackson 1965: 149.
[34] cf. Jackson 1965: 153-159.
[35] Die Kommunisten handelten auf Weisung aus Moskau. cf. Carr 1966: 634.
[36] Die Zahlenangaben weichen in der Literatur um mehrere 10.000 voneinander ab. cf. Jackson 1965: 153.
[37] Sieh hierzu die Ächtung von Plünderungen durch das Revolutionskomitee am 9. Oktober 1934. in: Tuñón de Lara 1985: 438.
[38] cf. Preston 21994: 212.
[39] cf. Tuñón de Lara 1981: 200. Malefakis nennt 15.000 bis 20.000 Häftlinge. cf. Malefakis 1970: 342. Brenan spricht von 3000 Toten, davon ca. 300 auf Seiten von Polizei und Militär, sowie von 30.000-40.000 Häftlingen. cf. Brenan 1978: 323.
[40] Nämlich die Prävention einer befürchteten faschistischen Machtübernahme; Madariaga führt hier allerdings nicht mehr die harte Repression an, die ja von der selben Regierung geduldet worden war.
[41] Madariaga 31979: 291.
[42] Brenan 1978: 322.
[43] zit. nach Preston 21994: 178.
[44] Wie z.B. sehr deutlich an der an Hitlers Vorbild orientierten 'Machtergreifungstaktik' oder an den propagandistischen Mitteln, die Gil Robles im Wahlkampf Anfang 1936 einsetzte, zu erkennen ist. cf. Preston 21994: 205-209.
[45] cf. Carr 1966: 625-627.
[46] cf. Artola 1975: 388-400.
[47] Die Falange war eine unbedeutende Splitterpartei und sollte erst im Bürgerkrieg an Bedeutung gewinnen. cf. Bernecker / Pietschmann 21997: 312.
[48] cf. Kap. 1.2.
[49] zur Taktik Gil Robles' cf. García Delgado 1988: 13-14.
[50] zit. nach Brenan 1978: 334.
[51] zit. nach Preston 21994: 128.
[52] Dies zeigt seine Haltung gegenüber den Radikalen während des Estraperlo-Skandals im Herbst 1935. cf. Preston 21994: 195.
[53] cf. Preston 21994: 183. Die Mühe, die die Armee bei der Niederschlagung des asturischen Aufstandes hatte, ist ein Indiz dafür, dass ein Militärputsch 1934 vermutlich gescheitert wäre. cf. Preston 21994: 178. Zur immer wieder heftig diskutierten Frage, ob Gil Robles putschen wollte, siehe Jackson 1965: 172, Anm. 7.
[54] Giménez Fernández hat die katholischen Parlamentarier an einundzwanzig verschiedenen Gelegenheiten ermahnt, dass sie mit ihrem Verhalten die kostbarsten Prinzipien ihres Glaubens verletzten. cf. Malefakis 1970: 352.
[55] cf. Preston 21994: 189-190.
[56] cf. Malefakis 1970: 357-359.
[57] Malefakis 1970: 359.
[58] cf. Tuñón de Lara 1981
[59] cf. Preston 21994: 196-200.
[60] Gil Robles, No fue posible la paz. Barcelona 1968: 357. zit. nach Ballbé 1983: 384.
[61] Diese Frage wurde in der Komödie ¿Quién soy yo? (Wer bin ich?) von Juan Ignacio Luca de Tena sogar für die Bühne thematisiert. cf. Jackson 1965: 172.
[62] Carr 1980: 127-128.
[63] cf. Little 1985 und Egido León 1984.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments über die Zweite Spanische Republik?
Dieses Dokument ist eine Analyse der Geschichte der Zweiten Spanischen Republik, mit besonderem Fokus auf die Jahre des "Bienio Negro" (1933-1935) und die Rolle des Partido Socialista Obrero Español (PSOE) und der Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) beim Scheitern der Republik. Es untersucht die politische Entwicklung, die Radikalisierung der Parteien und die Ereignisse rund um die "Oktoberrevolution" von 1934.
Welche Phasen werden in der Geschichte der Zweiten Spanischen Republik unterschieden?
Es werden im Wesentlichen drei bzw. vier Phasen unterschieden: 1) Die erste Phase, die mit dem Sieg des republikanischen Bündnisses 1931 beginnt und von Reformen geprägt ist. 2) Die zweite Phase ab Dezember 1933, das "Bienio Negro", gekennzeichnet durch einen Rechtsruck. 3) Die dritte Phase von der Volksfrontwahl 1936 bis zum Ausbruch des Bürgerkriegs. 4) Die vierte Phase, der Bürgerkrieg selbst.
Welche Rolle spielte der PSOE in der Zweiten Spanischen Republik?
Der PSOE verfolgte zunächst gemäßigte, republikanische Ziele. Er beteiligte sich an den Regierungen und versuchte, soziale Probleme mit demokratischen Mitteln zu lösen. Nach dem Machtwechsel 1933 radikalisierte sich der PSOE jedoch, misstraute der Republik und strebte eine sozialistische Revolution an.
Was war die CEDA und welche Rolle spielte sie?
Die CEDA war ein rechtes Parteienbündnis, das aus der katholischen Organisation Acción Popular hervorging. Sie trat gegen die antiklerikalen Elemente der Republik ein und forderte einen Korporativstaat. Nach dem Wahlsieg 1933 übte sie erheblichen Einfluss auf die Regierung aus und betrieb eine konservative Politik.
Was war die "Oktoberrevolution" von 1934?
Die "Oktoberrevolution" von 1934 war ein Aufstand, der von Sozialisten, Anarchisten und Kommunisten initiiert wurde, als Reaktion auf die Beteiligung der CEDA an der Regierung. Der Aufstand war in Barcelona und Madrid erfolglos, führte aber in Asturien zu einer revolutionären Bewegung, die von großer Bedeutung für die spätere Entwicklung war.
Welche Ursachen werden für das Scheitern der Zweiten Spanischen Republik genannt?
Das Dokument argumentiert, dass das Scheitern der Republik nicht auf einem diffusen "Nationalcharakter" beruhte, sondern auf greifbaren strukturellen Problemen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Natur. Die Radikalisierung des PSOE und die Ablehnung der Republik durch die CEDA werden als entscheidende Faktoren hervorgehoben.
Was war die Rolle von José María Gil Robles?
José María Gil Robles war der Führer der CEDA. Er nutzte seine parlamentarische Mehrheit, um Regierungen zu stützen oder zu stürzen, besetzte Schlüsselpositionen im Militär mit antirepublikanischen Generälen und betrieb systematisch die Demontage von sozialreformerischen Ansätzen.
Wie unterschieden sich die Parteiprogramme des PSOE von 1931 und 1934?
Das Parteiprogramm von 1931 war gemäßigt und prorepublikanisch. Es verteidigte ein parlamentarisches System und die Einhaltung der individuellen Persönlichkeitsrechte. Das Programm von 1934 war radikal und revolutionär. Es forderte die Verstaatlichung aller Ländereien und die Absetzung des Staatspräsidenten.
Welche Quellen und Literatur werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf eine Vielzahl von Quellen und Literatur, darunter Werke von Miguel Artola, Manuel Azaña, Walther L. Bernecker, Raymond Carr, Edward E. Malefakis, Paul Preston und Manuel Tuñón de Lara.
Wer war Largo Caballero?
Francisco Largo Caballero war ein führender Politiker des PSOE und ein bedeutender Gewerkschaftsführer. Zunächst setzte er sich für eine Zusammenarbeit mit den republikanischen Kräften ein, später radikalisierte er sich und befürwortete eine sozialistische Revolution.
- Quote paper
- Jochen Plikat (Author), 2000, Das Scheitern der II. Spanischen Republik. PSOE, CEDA und bienio negro, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107720