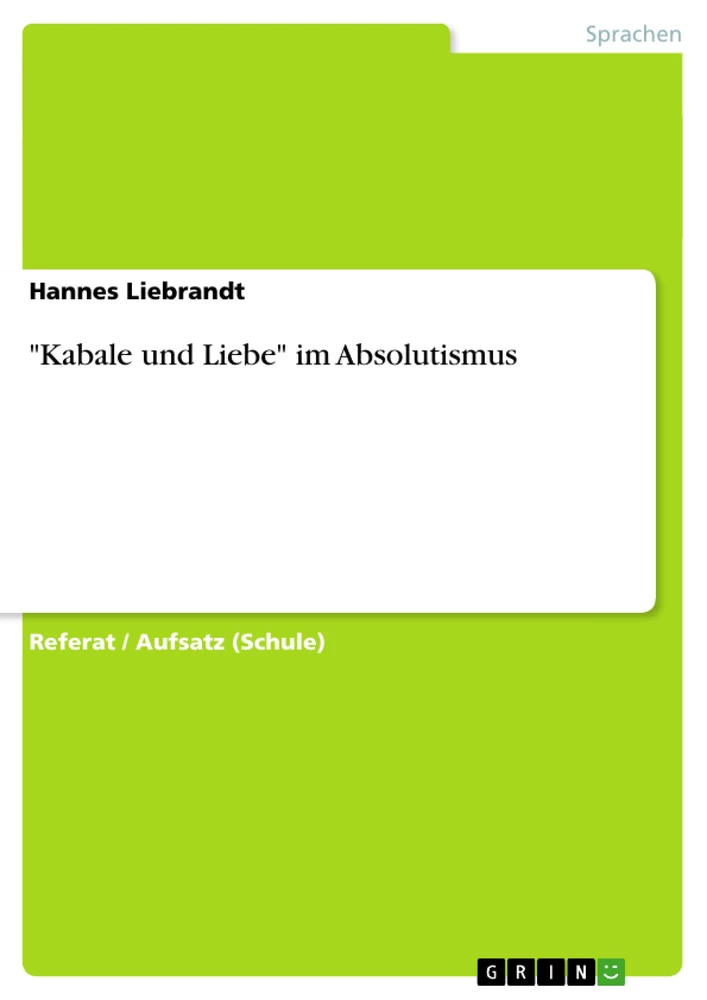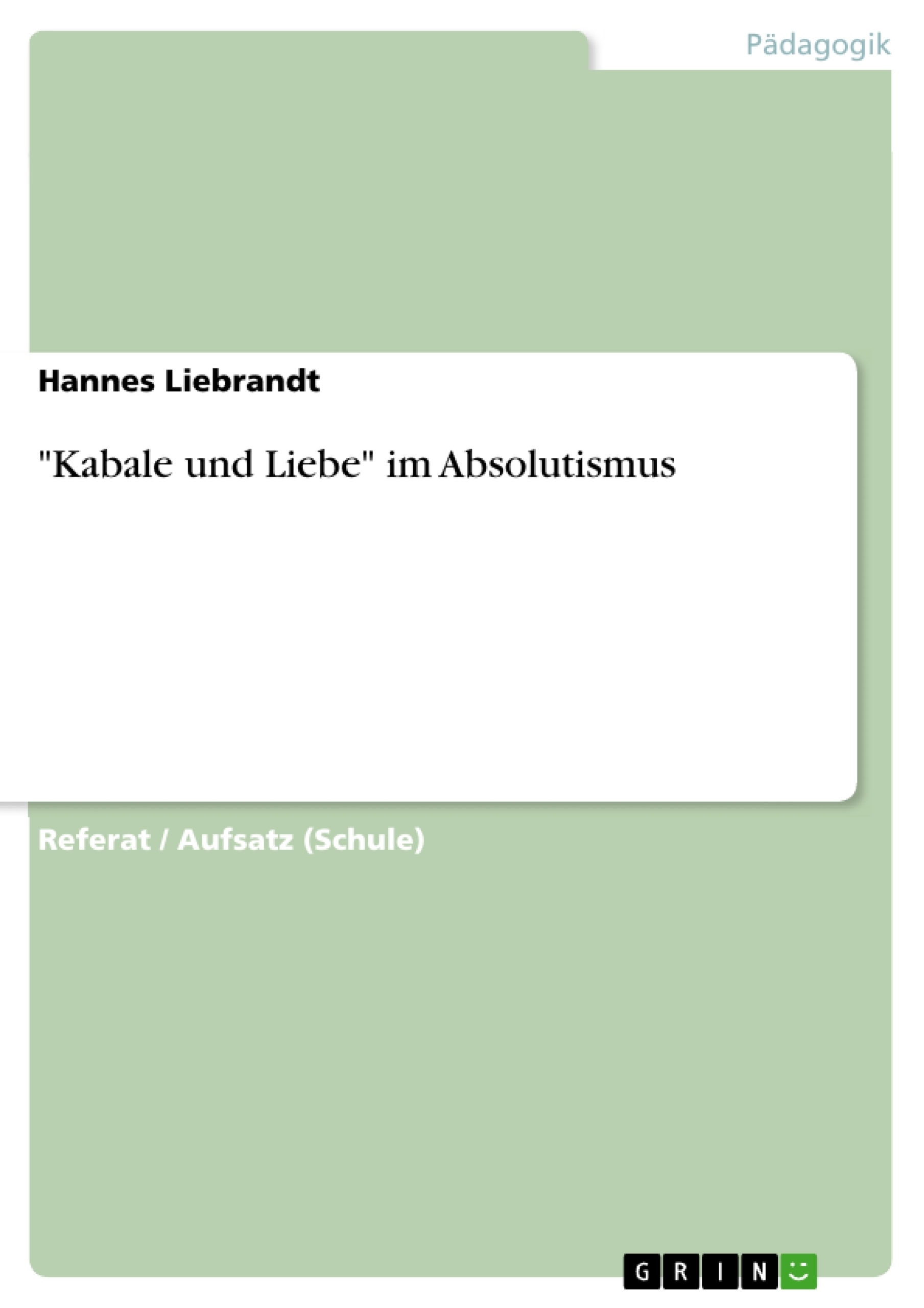Ein gefährliches Spiel aus Liebe und Macht entfacht in Friedrich Schillers "Kabale und Liebe" einen Aufruhr, der die Fundamente des Absolutismus erschüttert. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der adlige Intrigen, korrupte Machenschaften und die unbarmherzige Willkür einer dekadenten Elite das Schicksal zweier Liebender besiegeln. Ferdinand, ein adliger Offizier, und Luise, eine bürgerliche Musikertochter, trotzen den Konventionen ihrer Zeit und entfachen eine leidenschaftliche, aber aussichtslose Romanze. Doch ihre Liebe wird zur Zielscheibe eines perfiden Komplotts, angezettelt von Ferdinands machthungrigem Vater, dem Präsidenten von Walter, der mit allen Mitteln eine standesgemäße Verbindung seines Sohnes erzwingen will. Intrigen, Erpressung und Verrat sind die Waffen in diesem zerstörerischen Kampf, in dem Luise und ihre Familie zu Schachfiguren degradiert werden. Die Veröffentlichung des Dramas im Jahr 1784 entfachte einen Sturm der Entrüstung und machte Schiller zu einem Sprachrohr der aufbegehrenden Bürger. "Kabale und Liebe" ist mehr als nur eine tragische Liebesgeschichte; es ist eine flammende Anklage gegen die Ungerechtigkeit, die Ausbeutung und die moralische Verkommenheit einer Gesellschaft, die am Rande des Abgrunds steht. Erleben Sie, wie Schiller die Verschwendungssucht des Adels, den skrupellosen Soldatenhandel und das verwerfliche Mätressenwesen entlarvt, und die Verzweiflung der Bürgerlichen angesichts der unüberwindbaren Standesgrenzen aufzeigt. Folgen Sie den verworrenen Pfaden der Kabale, die letztendlich zu einem tragischen Finale führen, in dem die Unschuld geopfert und die Liebe verraten wird. Lassen Sie sich von Schillers Sprachgewalt und seiner messerscharfen Kritik an einer verrotteten Ordnung fesseln, und entdecken Sie die zeitlose Brisanz dieses Meisterwerks des Sturm und Drang, das bis heute nichts von seiner Sprengkraft verloren hat. "Kabale und Liebe" ist ein Spiegelbild einer Epoche, in der die Macht des Einzelnen über das Schicksal ganzer Bevölkerungsschichten entschied und die Liebe zur Rebellion gegen ein System wurde, das nur auf Privilegien und Unterdrückung basierte. Ein Muss für alle, die sich für Literaturgeschichte, politische Dramen und die ewige Frage nach Gerechtigkeit und Freiheit interessieren.
„Kabale und Liebe stellt wie kein anderes Stück, einen Dolchstoß in das Herz des Absolutismus dar.“ Erörtere die Aussage des Literaturwissenschaftlers Erich Auerbach.
A) Einleitung und epochenspezifische Merkmale:
„Kabale und Liebe“ ist ein bürgerliches Trauerspiel, welches die Hegemonie und die Willkürherrschaft des Adels zur Zeit des Absolutismus darstellt. Friedrich Schiller (1759- 1805), ein Zeitzeuge des absolutistischen Zeitalters, schuf 1783 mit diesem Drama eines der radikalsten Gesellschaftskritiken des Sturm und Drang vor dem Ausbruch der französischen Revolution. Die gesellschaftspolitischen Differenzen, sowie die Darstellung der gegenseitigen Abneigung zwischen dem Adel und dem Bürgertum, sind die treibenden Kräfte dieses Dramas und verleihen diesem Werk somit den Status einer literarischen Rebellion gegen das absolutistische Obrigkeitsregime. Diese These wird von dem Literaturwissenschaftler Erich Auerbach als „Dolchstoß in das Herz des Absolutismus“ metaphorisiert. In der folgenden Rezension soll dargelegt werden, wie dieses Zitat in „Kabale und Liebe“ zur Geltung kommt.
B) Hauptteil
1. Verschwendungssucht der Adeligen auf Kosten des Bürgertums:
Die Nachahmung französischer Tradition im Allgemeinen und des Schlosses „Versaille“ im Besonderen, führten in weiten Teilen Europas zu der Errichtung von Prunkschlössern, die den Machtanspruch absolutistischer Herrscher gerecht werden sollte. Diese größenwahnsinnige Prunkentfaltung und der Erwerb kostbarer Reichtümer für den Adel haben zu enormen finanziellen Belastungen geführt, welche besonders die Bürgerschicht und die Bauern, in Form von Steuererhöhungen, begleichen mussten.
Entsprechend der Machtdemonstration durch Residenzen, war früher das persönliche Erscheinungsbild, das zur Hervorhebung seiner Reputation von grundlegender Bedeutung war. Das Verlangen nach Anerkennung und Betonung seiner Person war der Grund, weswegen die wohlhabende Oberschicht einen großen Anteil ihres Vermögens in Kleider, Schmuck und Körperpflege investiert hat.
Ein passendes Beispiel und eindeutiger Beleg für diese These ist der Hofmarschall von Kalb, der in einem „reichen aber geschmacklosen Hofkleid“ (I/6 S.21/Z.1f), mit „zwei Uhren und einem Degen, Chapeaubas und frisiert à la Herisson.“ (I/6 S.21/Z.3f) dargestellt wird. Der Hofmarschall, der einen eher niederen Adeligen des fürstlichen Hofes repräsentiert, und schon auf so eine exquisite Garderobe verweisen kann, lässt die Größenordnung der Besitztümer, welche den „großen“ Aristokraten zur Verfügung stehen, nur erahnen. Die Verschwendungssucht mancher Adeligen steigert sich noch in der zweiten Szene des zweiten Aktes, da hier der Lady Milford „unermesslich kostbare Steine“ (II/2 S.32/Z.2) zur Hochzeit geschenkt werden.
2.Geldeintreibung der Fürsten durch Soldatenhandel:
Jedoch erfährt der Leser in dieser Szene auch über die korrupten Methoden der Aristokraten an Geld zu gelangen, welche aber erst durch die Nachfrage Lady Milfords, „was bezahlt dein Herzog für diese Steine“ (II/2 S.31/Z.29) ans Tageslicht geraten. Der Kammerdiener erzählt, dass der Herzog diese Brillanten mit Hilfe des Kopfgeldes von „siebentausend Landskindern“ (II/2 S.32/Z.3) finanziert habe, die durch „ Anwendung von Drohung und Gewalt, Einsatz von Alkohol und Narkotika“[1] dazu genötigt wurden. Durch die Verlautbarung dieser Delikte erfährt die Bevölkerung, dass ihr Machthaber seine eigenen Landsmänner an das Ausland verkauft, um dessen Lebensstandard zu sichern und um sein Mätressenwesen finanzieren zu können. Dieses, von Schiller publizierte Verbrechen gegen die Menschlichkeit, konnte nur in Konflikt mit der absolutistischen Befehlsgewalt geraten. Unwissend über die Intrigen der Adeligen versucht sie sich durch die Frage: „Doch keinen Gezwungenen?“ (II/2 S.32/Z.11) einen Einblick über das Ausmaß der Unterjochung gesellschaftlicher Unterschichten zu machen. Nachdem der Kammerdiener die Skrupellosigkeit und die unmenschliche Behandlung der „Landskindern“ (II/2 S.32/Z.3) offenbart, reagiert Lady Milford vollkommen geschockt und niedergeschlagen: „Gott! Gott! – Und ich hörte nichts? Und ich merkte nichts?“ (II/2 S.32/Z.22,23) Bedingt durch ihre Mätressendasein konnte sie diese Machenschaften nicht wissen, da die Kurtisanen entweder von der Politik ferngehalten, oder diese Verbrechen professionell vertuscht wurden.
Friedrich Schiller sicherte sich mit der Veröffentlichung dieser despotischen Politik den Argwohn absolutistischer Herrscher zu und deswegen ist dieser Aspekt ein Indiz für die These Erich Auerbachs.
3.Anreize und finanzielle Auswirkungen des Mätressenwesen:
Finanziell und ethisch auch nicht unrelevant ist das damals, am fürstlichen Hof praktizierte, Mätressenwesen. Die Vorliebe für junge und attraktive Mädchen war auch zu jener Zeit bei absolutistischen Herrschern weit verbreitet. Deswegen kam es auch nicht selten vor, dass ein König neben seiner Ehefrau mehrere Geliebte in seinem Harem gehalten hat. In „Kabale und Liebe“ wird diese Neigung in mehreren Szenen angesprochen.
Lady Milford, die ihren materialistischen Wohlstand nur dem Mätressenwesen verdankt und dieses in „Kabale und Liebe“ repräsentiert, lebt dadurch in ständiger Abhängigkeit von dem Fürsten. Da die Mätressen normalerweise ein sehr gutes Leben führen, steigen deren Ansprüche an den Fürsten stetig, was wiederum eine finanzielle Belastung nach sich zieht. Ein Zeugnis dafür findet man in der Konversation zwischen der Lady Milford und ihrer Kammerjungfer Sophie (II/1). Lady Milford gibt dort zu verstehen, dass nur ein Fürstentum ihren Anforderungen gerecht werden würde. (II/1 S.29/Z.11f).
Um das oftmals luxuriöse Leben der Kurtisanen zu verdeutlichen, wird die Mätresse mit einem eigenen „Palais“ (II/1 S.28/Z.1) dargestellt. Die Brillanten, die sie zur Hochzeit bekommt (II/2 S.32/Z.2), unterstreichen ihren materialistischen Reichtum und weisen deutlich auf die finanzielle Belastung für die Fürsten hin. Das parasitäre Leben an dem fürstlichen Hof: „Aber den Fürsten werden Sie doch ausnehmen?“ (II/1 S.29/Z.7), sowie der individuelle Nutzen der Mätressen: „Unter allen, die an den Brüsten der Majestät trinken, (...)“ (II/1 S.29/Z.13-14) werden in dieser Szene auch offensichtlich. Ihren ganzen Wohlstand zum Trotz ist die Lady mit ihren Mätressendasein nicht zufrieden. Sie nennt sich und Sophie „Sklavinnen eines Mannes“(II/1 S.30/Z.14) und träumt von einem Mann, aus dessen Mund „Tränen der Liebe schöner glänzen in [ihren] Augen, als die Brillanten in [ihrem] Haar“ (II/1 S.30/Z28ff). Lady Milford, die in dieser Szene noch sehr befehlend mit ihrer Kammerjungfer geredet hat, weiß jedoch sehr wohl ihre gesellschaftliche Stellung als Mätresse einzuschätzen, da sie bei der Unterredung mit Ferdinand (II/3), einen schüchternen, ja sogar devoten Eindruck auf den Leser hinterlässt.
Die Hierarchie ändert sich wieder in der Konversation zwischen Ihr und der bürgerlichen Luise. Sie vertritt nun wieder die Stellung als Ranghöhere, und nutzt ihren gesellschaftlichen Rang, um Luise und ihre Familie zu beleidigen: „die arme Geigerstochter, (...)“ (IV/7 S.84/Z.14-15), „Sehr interessant, und doch keine Schönheit (...)“ (IV/7 S.84/Z.16).
Der, wegen der Eifersucht, innere Hass gegen Luise, treibt Lady Milford in Gefühlsausbrüche (IV/7 S.89/Z.6-15), welche auch die Unzufriedenheit des Mätressendaseins wiederspiegeln. „Die wohl bekannteste und auch als Mutter aller Luder abgestempelte Mätresse war zweifellos Marquise de Pompadour, die mit ihren halben duzend Schlösser das beste Beispiel für einen sozialen Aufstieg der Mätressen abgibt.“[2] Das Mätressenwesen, das in diesem Stück von Lady Milford verkörpert wird, war eine enorme finanzielle Belastung für den Fürsten und somit auch für dessen Bevölkerung. Die Einblicknahme für die Bürger in die Dimensionen der Geldbeträge, hätte sich sehr negativ auf die Gunst des Herrschers auswirken können und somit kann diese Publikation Schillers, der These Erich Auerbachs zugeschrieben werden.
4.Intrigen und Korruption der absolutistischen Herrscher:
Die absolutistische Herrschaftsform lässt sich nicht mit unserer heutigen Demokratie vergleichen. Die vorwiegend unantastbaren Herrscher haben die Politik oftmals korrumpiert und das Leben der Menschen in höher-, minderwertig und sogar wertlos differenziert. Es fanden auch Inhaftierungen von politischen Gegnern und Kritikern statt, die Friedrich Schiller dazu bewogen, dieses Problem auch sehr deutlich in „Kabale und Liebe“ anzusprechen, indem er den Präsidenten und sein Gefolge als Despoten charakterisiert.
Allein die Überschrift des Dramas „Kabale und Liebe“ kann schon als Beleg für die These gewertet werden, da Kabale in dieser Bedeutung als Ersatz für Intrige steht. Der Präsident, der als Popanz der Familie Miller beschrieben wird, ist in diesem Stück die Inkarnation von Korruption und absolutistischer Willkür. Er konnte nur durch die Ausschaltung seiner politischen Gegner: „Wem hab ich durch die Hinwegräumung meines Vorgängers Platz gemacht?“ (I/7 S.23/Z.13-14) und durch Manipulation von Dokumenten: „dass er unsere falschen Briefe und Quittungen angeben (...)“ (III/2 S.59/Z.10) seine Hierarchische Vormachtstellung in diesem Stück erreichen. Sein Regierungsstab besteht ausschließlich aus früheren Freunden, nützlichen Helfern und anderen Lakaien.
Ein dienliches Beispiel für seine Untertanen ist der distinguierte Hofmarschall von Kalb. Dieser hat weder studiert (III/2 S.61/Z.35), noch irgendwelche anderen Qualifikationen vorzuweisen, welche seine Position als Hofmarschall rechtfertigen würde. Die Tatsache, dass der Präsident weder gewählt, noch von „Gottes Gnaden“ für dieses Amt bestimmt wurde, jedoch er trotzdem an die Macht gelangt ist, lässt die Effizienz seiner Methoden erahnen.
Der Präsident ist ein eindeutiger Opportunist, da er sich nicht um das Wohlergehen anderer sorgt, sondern sogar Dritte in den existentiellen Ruin treiben würde, um seine Interessen durchzusetzen. Ein Beleg dafür ist sein Unverständnis und fehlende Toleranz gegenüber der Geliebten seines Sohnes: „Dass er der Bürgerkanaille den Hof macht (...) auch meinetwegen Empfindungen vorplaudert. Das sind lauter Sachen, die ich (...) verzeihlich finde- aber- und noch gar die Tochter eines Musikus.“ (I/5 S.17/Z.24-27) und seine ständigen Bemühungen Luise seinen Sohn abzuraten, diese jedoch meist in Disputationen enden.
Umso größer ist seine Angst vor einer Publikation seiner Machenschaften, welche zweifellos seine politische und gesellschaftliche Dekadenz bedeuten würde. Diese Schwäche macht sich Ferdinand des öfteren von Nutzen, indem er seinem Vater droht „der Residenz eine Geschichte, wie man Präsident wird.“ (II/7 S.52/Z.19-20) zu erzählen. Er würde sogar soweit gehen, seinen Vater „in die Hände des Henkers“ (III/4 S.63/Z.23) zu liefern, um sich gegen dessen Autorität etablieren zu können und sein Leben nach seinen Wünschen gestalten zu dürfen. Die Diskrepanz zwischen dem Präsidenten und Ferdinand ist ein Indiz für deren verschiedene Ansichten über Politik und über die Zukunft Ferdinands. Im Text äußert sich das in Unverständnis des Präsidenten und seines Hofmarschalls: „Er sollte so wahnsinnig sein, und seine Fortune von sich stoßen? Was? (III/2 S.59/Z.2f.)
Die Intrigen des Vaters führen am Ende des Dramas sogar bis zu dem Freitod Ferdinands und dessen Mord an Luise. Die Methoden des Präsidenten um die Beziehung zu beenden, endeten bei Ferdinand in vollkommener Resignation, die bis zu seiner Einsicht der Sinnlosigkeit des weiteren Lebens gereicht hat. ( VI/ 6,7,8) Die Selbsterkenntnis des Präsidenten für seine hinterhältigen Machenschaften ist in diesem Drama nicht vorhanden, da er sogar noch nach dem Tod seines Sohnes die ganze Schuld von sich weißt und den „Satan“ (VI/ letzte Szene S.121/Z.1) Wurm für diese Folgen verantwortlich macht.
5.Darstellung willkürlicher Verbrechen der Regierungen:
Nicht nur die Intrigen dieses Regimes, sondern auch die Willkür, die hier bezeichnend für das ganze Zeitalter des Absolutismus steht, werden von Schiller indirekt angeklagt. Es wurden früher Menschen, wegen ihrer kritischen Einstellung zum Absolutismus, oder auch persönlichen Gelüsten der Herrscher folgend, inhaftiert und ohne Gerichtsverfahren exekutiert. Auf diese Verbrechen wird auch in „Kabale und Liebe“ hingewiesen. Sie besitzen zwar nicht ganz das Ausmaß, welches damals auch vorzufinden war, aber sie zeigen deutlich die Willkür und die Methoden der absolutistischen Interessenspolitik. Infolge dieses Drama wird vernehmlich, dass die Bevölkerung den Herrschern schutzlos ausgeliefert ist. Belegend hierfür ist die Furcht der Familie Miller vor dem Präsidenten und dessen Helfern. Die Ausrufe „sein Vater! Allmächtiger Gott (II/5 S.44/Z.19) und „Der Präsident! Es ist aus mit uns!“ (II/5 S.44/Z.21) verdeutlichen die Angst vor dem Präsidenten. Die willkürlichen Hinrichtungen und Delikte werden durch das Zitat: „Um Himmels willen, Mann! Du bringst Weib und Kind um.“ (II/6 S.49/Z.10 f) von Frau Miller angesprochen.
Des weiteren beschreibt Friedrich Schiller, in der ersten Szene des dritten Aktes, wie die Intriganten auf Seiten der Regierung versuchen, die Liebe zwischen Luise und Ferdinand zu brechen. Wurm, ein verschlagener Diener des Präsidenten, der öfters für solche Pläne konsultiert wird, schmiedet den Plan um die Beziehung zu beenden.
Der Plan sieht vor, Luises Vater grundlos einzusperren und damit Luise zu zwingen einen Brief zu verfassen, in der sie sich zu der Liebe mit Hofmarschall von Kalb bekennt (III/ 1 S.56/Z.13). Die Willkür verdeutlicht sich in der Tatsache, dass sich Herr Miller weder kritisch über das Regime geäußert hat, noch hat er ein Verbrechen begangen, für welches die Inhaftierung zu rechtfertigen wäre. Dieser Anhaltspunkt untergräbt nur die These des Opportunismus und verdeutlicht das kriminelle Potenzial des Präsidenten und seiner Gefolgschaft.
C) Zusammenfassende Aussage und persönliche Stellungnahme:
Abschließend kann man sagen, dass sich die Behauptung von Erich Auerbach, dieses Stück sei ein „Dolchstoß in das Herz des Absolutismus“, bestätigte. Ein Großteil der Werte und Geheimnisse, die der Absolutismus vertrat, wurden durch „Kabale und Liebe“ wenigstens ansatzweise aufgedeckt. Friedrich Schiller hat ein Drama verwendet, um die Folgen der souveränen Macht des Adels im alltäglichen Leben zu schildern. Meiner Meinung nach war es sehr couragiert, in einer Zeit, in der politische Kundgebungen andauernd zensiert wurden und gegen Verbrecher das Motto galt: Abschreckung mit eiserner Konsequenz und jeder Bürger den Neigungen des Herrschers ausgesetzt war, so ein obrigkeitskritisches Drama zu verfassen. Friedrich Schiller, der absolutistische Herrschaft selbst miterlebt hat, war jedenfalls in diesem Werk ein ideologischer Anhänger jener Generation, die sich von den Ketten der absolutistischen Herrschaft lösen wollte und dieses Ziel auch 1789 mit dem Sturm auf die Bastille umsetzten konnte. Die französische Revolution gegen Ende des 18.Jahrhunderts und die Lossagung der meisten Staaten in Europa von der Monarchie oder Diktatur, Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts, ebneten erst den Weg für unsere heutige Demokratie.
Details zur Abgabe:
Luisenburg- Gymnasium Wunsiedel
Schuljahr 2002/2003
Liebrandt, Hannes
Klasse 11b
Hausaufgabe aus dem Deutschen
am 26.03.2003
- LITERARISCHE ERÖRTERUNG -
Verwendete Sekundärliteratur
- Lektürenhilfen Kabale und Liebe, nach Müller, Hans Georg. Stuttgart. Klett, 2000.
- „Mutter aller Luder“, nach Rosenkranz, Stefanie. Hamburg. Stern Spezial Biografie. 2003.
Anmerkungen
Häufig gestellte Fragen
- Worum geht es in der Erörterung zu "Kabale und Liebe"?
- Die Erörterung behandelt die Aussage des Literaturwissenschaftlers Erich Auerbach, dass "Kabale und Liebe" wie kein anderes Stück ein "Dolchstoß in das Herz des Absolutismus" sei. Es wird analysiert, inwiefern das Drama von Friedrich Schiller eine Kritik am Absolutismus darstellt.
- Welche epochenspezifischen Merkmale werden in Bezug auf "Kabale und Liebe" genannt?
- Das Stück wird als bürgerliches Trauerspiel im Kontext des Absolutismus verortet. Es werden die gesellschaftspolitischen Differenzen und die gegenseitige Abneigung zwischen Adel und Bürgertum als treibende Kräfte des Dramas hervorgehoben.
- Wie wird die Verschwendungssucht des Adels in "Kabale und Liebe" dargestellt?
- Die Verschwendungssucht wird am Beispiel des Hofmarschalls von Kalb und Lady Milford gezeigt. Der Hofmarschall wird mit seiner aufwendigen Kleidung und Lady Milford mit ihren kostbaren Steinen als Beispiele für den Prunk und die finanzielle Belastung des Adels dargestellt.
- Welche Rolle spielt der Soldatenhandel in der Geldeintreibung der Fürsten?
- Der Kammerdiener von Lady Milford enthüllt, dass der Herzog die Brillanten mit dem Kopfgeldes von "siebentausend Landskindern" finanziert habe, die zum Militärdienst gezwungen wurden. Dies wird als Korruption und Verbrechen gegen die Menschlichkeit dargestellt.
- Wie wird das Mätressenwesen in "Kabale und Liebe" thematisiert?
- Lady Milford wird als Repräsentantin des Mätressenwesens dargestellt. Es wird gezeigt, dass ihr materialistischer Wohlstand von ihrer Abhängigkeit vom Fürsten abhängt. Ihre hohen Ansprüche an den Fürsten belasten die Finanzen des Landes. Trotz ihres Wohlstandes ist sie mit ihrem Dasein als Mätresse unzufrieden.
- Welche Intrigen und Korruption werden dem absolutistischen Herrscher vorgeworfen?
- Der Präsident wird als Inbegriff von Korruption und absolutistischer Willkür dargestellt. Er hat durch die Ausschaltung seiner politischen Gegner und durch Manipulation von Dokumenten seine Macht erlangt. Sein Regierungsstab besteht aus Freunden und Lakaien. Auch die Angst vor der Veröffentlichung seiner Machenschaften wird thematisiert.
- Wie wird die Willkür der Regierung in "Kabale und Liebe" dargestellt?
- Es wird gezeigt, wie Menschen wegen ihrer kritischen Einstellung oder aufgrund persönlicher Gelüste der Herrscher inhaftiert und exekutiert werden. Die Furcht der Familie Miller vor dem Präsidenten und dessen Helfern wird verdeutlicht. Wurm schmiedet den Plan, Luises Vater einzusperren, um sie zu zwingen, einen Brief zu verfassen. Dies verdeutlicht die Willkür und die Ohnmacht der Bevölkerung.
- Wie lautet das Fazit der Erörterung zu "Kabale und Liebe"?
- Die Erörterung kommt zu dem Schluss, dass die Behauptung von Erich Auerbach, das Stück sei ein "Dolchstoß in das Herz des Absolutismus", zutrifft. Friedrich Schiller habe ein Drama verwendet, um die Folgen der souveränen Macht des Adels zu schildern. Schiller wird als ideologischer Anhänger jener Generation dargestellt, die sich von den Ketten der absolutistischen Herrschaft lösen wollte.
- Welche Sekundärliteratur wurde für die Erörterung verwendet?
- Es wurden "Lektürenhilfen Kabale und Liebe" von Hans Georg Müller und "Mutter aller Luder" von Stefanie Rosenkranz verwendet.
- Arbeit zitieren
- Hannes Liebrandt (Autor:in), 2003, "Kabale und Liebe" im Absolutismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107803