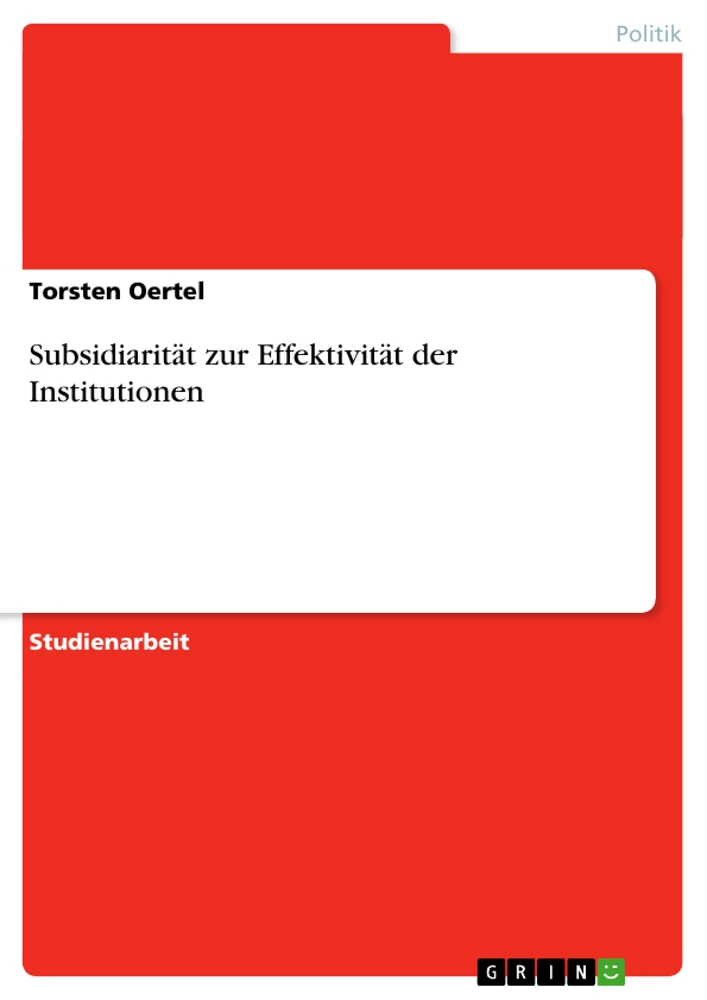Inhaltsverzeichnis
1. Subsidiarität zur Effektivität der Institutionen
Definition
Ziele der EVP (Europäischen Volkspartei) zur Subsidiarität zur Effektivität der Institutionen
2. Forderungen der CDU/CSU für die Subsidiarität zur Effektivität der Institutionen
Maximalforderungen der CDU/CSU
Minimalforderungen und Rückfallpositionen der CDU/CSU
3. Europäische Sicherungs- und Verteidigungspolitik
Definition
Ziele der EVP (Europäischen Volkspartei) zur Europäischen Sicherungs- und Verteidigungspolitik
4. Forderungen der CDU/CSU für die Europäische Sicherungs- und Verteidigungspolitik
Maximalforderungen der CDU/CSU
Minimalforderungen und Rückfallpositionen der CDU/CSU-Fraktion
Literatur
Das folgende Dossier wurde aus Sicht des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Erwin Teufel (CDU) verfasst.
1. Subsidiarität zur Effektivität der Institutionen
Definition
Der 1993 in Kraft getretene Maastrichter Vertrag hat das aus der christlichen Soziallehre stammende Subsidiaritätsprinzip in den EG-Vertrag eingeführt. Das in Artikel 5 EGV niedergelegte Prinzip besagt, dass in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, die Gemeinschaft nur dann tätig wird, „sofern und soweit die Ziele in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können“[1].
Zur Gewährleistung des Subsidiaritätsprinzip wurde dem Vertrag von Amsterdam ein „Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“ beigefügt. Kernpunkte des Protokolls sind u.a. eine kohärente Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität durch alle Organe- d.h. auch durch effektive Institutionen- sowie eine bürgernahe Entscheidungsfindung in der Union.
Ziele der Subsidiarität zur Effektivität der Institutionen sind eine Sicherstellung effizienter, transparenter und demokratischer Entscheidungen.
Ziele der EVP (Europäischen Volkspartei) zur Subsidiarität zur Effektivität der Institutionen
Im April 1976 schlossen sich die christlich-demokratischen Parteien zur „Europäischen Volkspartei“ (EVP) zusammen. Die EVP setzt sich für eine pluralistische europäische Demokratie ein, deren Ziel eine politische, Wirtschafts-, Währungs- und Sicherheitsunion ist. Außerdem wurde im Januar 2001 ein umfangreiches Politikprogramm einer europäischen Werteunion verabschiedet.[2]
Zentrale Forderungen der EVP, der auch die deutsche CDU/CSU Faktion angehört, sind eine Stärkung des Europäischen Parlaments und ein Ministerrat als Staatenkammer im föderativen Aufbau der Europäischen Union.
2. Forderungen der CDU/CSU für die Subsidiarität zur Effektivität der Institutionen
Maximalforderungen der CDU/CSU
Nach der deutschen Verfassungslehre weist das Subsidiaritätsprinzip der jeweils unteren Instanz den Vorrang im Handeln gegenüber der oberen Instanz zu, soweit ihre Kräfte dazu ausreichen. Im staatlichen Bereich hat dieses Prinzip für die Aufgabenverteilung zwischen Gemeinde und Staat, Bund und Ländern Anwendung gefunden.[3]
Wichtig ist daher, das Subsidiaritätsprinzip zur Verteidigung der föderativen Interessen auch im Europarecht für die Aufgabenverteilung zwischen nationaler und supranationaler Ebene zu verankern.
Ein häufiger Vorwurf an die Europäische Union ist, diese sei zu bürokratisch und nicht bürgernah. Entscheidungen entsprächen nicht den regionalen und nationalen Eigenarten. Die CDU/CSU setzt sich daher für einen Europäischen Verfassungsvertrag ein, so dass europäische Entscheidungsabläufe vereinfacht, effektiv und nachvollziehbarer werden. Sie begrüßt, dass durch den Amsterdamer Vertrag die Zahl der Entscheidungsverfahren auf drei verringert wurden, die demokratischen Rechte des Europäischen Parlaments gesteigert und die Mehrheitsentscheidung im Ministerrat in 15 weiteren Politikverfahren eingeführt wurden.
Die CDU/CSU fordert im Weiteren einen europäischen Verfassungsvertrag als „Grundlagenvertrag“ der Union, u.a. auch als Grundlage einer überzeugenden Kompetenzordnung.
Wichtige Punkte sind die Wahrung der nationalen Identitäten sowie das Prinzip begrenzter Einzelzuständigkeiten der Union. In der Folge darf es nicht zu Kompetenzerweiterungen, sondern nur zu präzis formulierten, klaren Kompetenzabrundungen kommen. Hierzu bedarf es im Sinne der nationalen Kompetenzen einfacher Verfahren, um der Union erteilte Kompetenzen zurücknehmen zu können.
Kritisch ist die CDU/CSU gegenüber einem Artikel zu politischen Werten, da der Verfassungsvertrag keine Versprechungen beinhalten, sondern Bereiche festlegen sollte, in denen die Union tatsächlich tätig werden kann. Betreffs der offenen Koordinierung vertritt die Fraktion die Ansicht, dass es sich hierbei um einen informellen Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten mit Blick auf die besten anzuwendenden Methoden geht und nicht um eine weitere Zuständigkeit der Union.
Die CDU/CSU begrüßt das Frühwarnsystem (ex-ante Kontrolle) und dessen Einbindung nationaler Parlamente. Allerdings sähe sie gerne auch ein Klagerecht für Regionen mit Gesetzgebungsbefugnis sowie für jede Kammer nationaler Parlamente. Nationale Parlamente sollten die Möglichkeiten haben, im Rahmen des Frühwarnsystems Verstöße gegen das Subsidiaritätsprinzip rügen zu können. Vorbild ist der französische Conseil Constitutionel, Rechtsklarheit auch vor Inkrafttreten des Rechtsaktes zu ermöglichen.
Um die Wirksamkeit der Kontrolle zu sichern, muss die Rolle der Regionen bei der Kompetenzverteilung stärker berücksichtigt werden, da diese, z.B. die Länder in Deutschland, Staatscharakter haben. Dies ist notwendig, weil die Länder auch auf der nationalen Ebene Kompetenzen ausüben, die sie auf der europäischen Ebene einbringen können müssen. Selbiges gilt für Regionen, Städte und Gemeinden.
Kontrolle der Subsidiarität soll nach Auffassung viel mehr eine Kontrolle der Kompetenz der Union sein. Hierbei muss der Beurteilungsspielraum des nationalen Gesetzgebers bei der Anwendung eines Rechtsaktes Beachtung finden. Das Subsidiaritätsprinzip nach Artikel 5 Absatz 2 EG-Vertrag sollte demnach präzisiert werden, da es sich nicht nur um eine Rechtsnorm handelt, die einer politischen, sondern auch einer Rechtskontrolle unterliegt. Wichtig ist auch hier neben der ex-post die ex-ante Kontrolle unter stärkerer Einbindung der Nationalparlamente.
Die CDU/CSU empfiehlt die Einsetzung einer Kompetenzkammer, welche nach Verabschiedung eines Rechtaktes vor seinem Inkrafttreten ex-ante mit raschen Entscheidungen auftretende Kompetenzfragen aus der Welt schafft. Auch dies entspricht dem französischen Modell des Conseil Constitutionel.
Nach Ansicht der CDU/CSU ist eine Kompetenzkontrolle und nicht nur eine Subsidiaritätskontrolle wichtig. Die Subsidiaritätskontrolle und die öfters aufgetretenen Streite zwischen der Union und den Mitgliedstaaten über die Zuständigkeit zum Erlass eines bestimmten Rechtsaktes bestärken die nationalen Parlamente in ihrer Befürchtung, einem weitgehenden Kompetenzverlust zugunsten der EU ausgesetzt zu sein.
Beim Thema der Subsidiarität sollte es folglich um die Kontrolle dreier Prinzipien gehen: dem Prinzip der Einzelzuständigkeit der Union, dem Subsidiaritätsprinzip und dem Proportionalitätsprinzip, d.h. einer vollen Kompetenzkontrolle. Subsidiarität im Sinne der CDU/CSU soll keine Dezentralisierung, sondern ein Aufbau von unten nach oben sein, der gleichsam alle Kompetenzen genau regelt und die EU die ihr zugelagerten Kompetenzen nach innen und außen stark und transparent vertritt, ohne in die Kompetenzen der anderen einzugreifen.
Bezüglich der Einbindung der Städte und Gemeinden in die Kompetenzverteilung der EU stellt die CDU/CSU fest, dass es bis dato noch keine vertragliche Verankerung deren Selbstverwaltungsrecht im europäischen Vertragswerk gibt. Eine solche Verankerung ist für die Schaffung einer föderativen und subsidiären Struktur unabdingbar, der Ausschuss der Regionen sollte daher gestärkt werden.
Bei der Definition des Subsidiaritätsprinzips sollte in diesem Zusammenhang aufgenommen werden, dass beim Erlass von EG-Regelungen auch die Handlungsmöglichkeiten der Regionen und Kommunen berücksichtigt werden müssen. Zweitens sollten auch Regionen wie der Ausschuss der Regionen ein Klagerecht vor dem Europäischen Gerichtshof erhalten und drittens in der vertraglich verankerten Achtung nationaler Identität auch regionale Gliederungen und kommunale Selbstverwaltung gefasst werden.
Allerdings darf es nicht zum Eingriff der EU in die kommunale Selbstverwaltung kommen, sondern die gesamte Union von der kommunalen Ebene ausgehend aufgebaut sein. Es gilt das Prinzip, dass nur das, was über die Kräfte der unteren Ebene hinausgeht auf europäischer Ebene angesiedelt werden darf.
Bei den Institutionen sieht die CDU/CSU den größten Reformbedarf beim Europäischen Rat. Sie fordert eine Trennung zwischen Exekutiv- und Legislativaufgaben sowie, agiert dieser gesetzgebend, öffentliche Tagungen. Dem Rat sollte überdies ähnlich wie dem Bundesrat mit einem sich halbjährlich wechselnden Vorsitz die Rolle einer Staatenkammer zukommen und das Europäische Parlament in Gesetzgebungsverfahren und Haushaltsfragen eingebunden werden.
Haushaltsfragen sollten künftig nur dem Europäischen Parlament obliegen. Ihm gegenüber sollte die Kommission voll verantwortlich sein, diese zudem gestärkt und ihr Präsident vom Europäischen Parlament gewählt werden. Aufgrund seiner zu erwarteten Größe und mangels benannter Aufgaben und zuletzt auch wegen einer Gefahr, dem Europäischen Parlament ein Konkurrenzmodel entgegenzustellen, befürwortet die CDU/CSU keine Einberufung eines Europäischen Kongresses aus dem Parlament und der gleichen Anzahl nationaler Parlamentsabgeordneter.
Bezüglich des Artikels 308 des EG-Vertrages zur erforderlichen Einstimmigkeit des Europäischen Rates zur Erlassung von Vorschriften zum Tätigwerden der Gemeinschaft im Rahmen des Binnenmarktes fordert die CDU/CSU eine ersatzlose Aufhebung der Generalklausel für die Schaffung neuer Kompetenzen. Grund hierfür sind Blockadegefahren, die aus dem Einstimmigkeitserfordernis rühren. Klare Kompetenzabgrenzungen zwischen europäischer, nationaler und kommunaler Ebene sind hierzu zu begrüßen, da diese den wesentlich den Übergang zu Mehrheitsentscheidungen erleichtern. Abgrenzungen sollten jedoch insbesondere für die Finanz-, Steuer- und Sozialpolitik gelten.
Hand in Hand mit einer Ausweitung des Mehrheitsprinzips fordert die CDU/CSU die Ausdehnung der Mitentscheidung des Europäischen Parlamentes. Dies ist aufgrund der empfohlenen Mehrheitsentscheidung im Rat zur demokratischen Legitimität zwingend notwendig. In der ersten Säule sollte daher die Mitentscheidung des Parlamentes vorzusehen und dessen Legislativwünschen nachzukommen sein. Die Kommission sollte daher legislative Initiativanträge des Europäischen Parlamentes nachdrücklich umsetzen. Außerdem sollten die Sitze im Parlament der jeweiligen Bevölkerungsgröße entsprechen.
Betreffs der Europäischen Kommission befürwortet die Fraktion eine starke Kontrolle des Kommissionspräsidenten. Die Wahl des Kommissionspräsidenten sollte durch das Europäische Parlament auf Vorschlag einer qualifizierten Mehrheit des Europäischen Rates gewählt werden. Da aufgrund der Erweiterung der Union nicht mehr alle Staaten durch Kommissare in der Kommission vertreten sein können, bedarf es sogenannten Junior-Kommissaren, die den Kommissaren beratend zur Seite stehen.
Minimalforderungen und Rückfallpositionen der CDU/CSU
Beim Frühwarnsystem erhebt die CDU/CSU die Minimalforderung, dass jede Kammer der Parlamente der Mitgliedstaaten das Klagerecht beim Europäischen Gerichtshof eingeräumt wird. Überdies sollten alle Kammern in die ex-post und ex-ante Kontrolle erlassener Rechtslinien eingebunden werden, da dieses eine Kompetenzverteilung gewährleistet. Eine allgemeine gerichtliche Kontrolle der Rechtsakte vor Inkrafttreten wird von der Fraktion als sinnvoll erachtet und angeregt.
Länder mit gesetzgebender Befugnis, z.B. die deutschen Bundesländer, sollten bei der Kompetenzverteilung berücksichtigt werden, da diese auch innerstaatliche Befugnisse ausüben. Sind Länder und Regionen nicht an der Kompetenz beteiligt und üben diese keinen direkten Einfluss auf die Union aus, besteht die Gefahr einer schleichenden Kompetenzerweiterung der Union. Allgemeine Ziele der Union dürfen Kompetenz begründend wirken. Die CDU/CSU schlägt hierzu vor, den Ausschuss der Regionen und, in einer Rückfallposition, nicht mittelbar aber langfristig bestimmt auch Kommunen und Gemeinden ein Klagerecht einzuräumen.
Als Kontrollorgan schlägt die CDU/CSU nachdrücklich die Einrichtung einer Subsidiaritäts- bzw. Kompetenzkammer vor. Zur Gewährleistung eines raschen Gesetzgebungsprozesses sollten Verfahren binnen zwei Monaten von insgesamt elf Mitgliedern abgeschlossen werden, jedoch ist die Fraktion was die Verfahrensdauer und Gremiengröße anbelangt flexibel, solange es sich um ein effektiv und schnell arbeitendes Organ handelt. Die Einrichtung einer Kompetenzkammer würde die Effektivität der Kompetenzkontrolle und Subsidiarität, dem Auftrag von Laeken und Nizza sowie die Stärkung der Rolle der Nationalparlamente stärken.
Kontrolle der Subsidiarität, der Proportionalität und der Einzelzuständigkeit der Union lässt sich aus Sicht der CDU/CSU bürgernäher als Kompetenzkontrolle darstellen. Alleine aufgrund der Angst vor einer schleichenden Kompetenzerweiterung der Union ist es unabdingbar, diese drei Kompetenzen zu überwachen. Die Fraktion stellt hierbei zur Diskussion, ob eine solche Kontrolle durch ein parlamentarisch-politisches Gremium während des Gesetzgebungsverfahrens oder durch einen Kompetenzsenat des Europäischen Gerichthofes vor Inkrafttreten des Rechtaktes nach französischen Vorbild erfolgt. Die CDU/CSU befürwortet die zweite Option.
Städte und Kommunen sollten stärkere Mitspracherechte und ein Klagerecht beim Europäischen Gerichtshof Erhalten. Minimalforderung der CDU/CSU ist eine Verankerung des Selbstverwaltungsrechtes in die europäischen Verträge. Eine weitere Einbindung sollte unbedingt anvisiert werden, da erstens die Union kein Eingriffsrecht auf kommunaler Ebene erreichen und die Struktur der Union von kommunaler aufwärts bis zur europäischen Ebene verlaufen sollte. Wichtig ist auch hier ein Organstatus für den Ausschuss der Regionen, der, ausgestattet mit einem Klagerecht, mehr Rechte gewinnt, wenn dieser das Subsidiaritätsprinzip als verletzt ansieht.
Betreffs der europäischen Institutionen fordert die CDU/CSU unbedingte Reformen insbesondere des Rates. Dieser muss wie alle anderen Gesetzgebungsorgane öffentlich tagen und insbesondere angesichts einer sich erweiternden Union Mehrheitsentscheidungen im Rat wie auch der Einwohner ermöglichen. Das Europäische Parlament sollte größeren Einfluss auf die Gesetzgebung ausüben und mehr Verantwortung in der Haushaltspolitik übernehmen.
Langfristig sollte in Erwägung gezogen werden, den Rat wie den Bundesrat zu einer Staatenkammer mit sechsmonatigen Präsidentschaften umzuformen. Die CDU/CSU ist offen, über die Dauer des Vorsitzes wie auch über den zeitlichen Rahmen zu diskutieren. Ebenfalls kompromissbereit ist sie in der Frage, ob der Kommissionspräsident vom Rat vorgeschlagen oder dessen Wahl zustimmen soll. Wichtig ist jedoch, dass dieser vom Europäischen Parlament gewählt wird.
Die CDU/CSU lehnt die Einberufung eines Europäischen Kongresses nicht nachdrücklich ab, betont jedoch, dass einem solchen Kongress Aufgaben zugeteilt werden müssten, ohne dadurch ein Konkurrenzgremium zum Europäischen Parlament zu schaffen.
Die Fraktion ist der Ansicht, den Artikel 308 ersatzlos zu streichen, um Blockaden zu vermeiden. Zumindest sollte in der ersten Säule die Einstimmigkeit auf Entscheidungen von Verfassungscharakter, d.h. Vertragsänderungen, Beitritte, Eigenmittelbeschlüsse und Wahlverfahren, beschränkt werden. Bei finanz-, steuer- und sozialpolitischen Fragen, mindestens aber bei der Harmonisierung indirekter Steuern sind Entscheidungen mit Mehrheit sinnvoll.
Dem Europäischen Parlament sollte unbedingt ein Initiativrecht zugebilligt werden. Die Kommission sollte Initiativanträge des Parlamentes umsetzen, allerdings könnte dies auch im Rahmen eingeschränkten Ermessens erfolgen. Angesichts einer EU-Erweiterung können nicht alle Mitgliedstaaten in der Kommission vertreten sein, so dass man über die Einführung des Amtes von beratenden Junior-Kommissaren verhandeln könnte, falls diesbezüglich Bedarf seitens „kleinerer“ Mitgliedstaaten besteht. Die „großen“ Mitgliedstaaten sollten in jedem Falle angesichts ihrer Bevölkerungsgröße mit Kommissaren vertreten sein.
3. Europäische Sicherungs- und Verteidigungspolitik
Definition
Interessen der Europäischen Sicherungs- und Verteidigungspolitik (ESVP) sind u.a. die Wahrung gemeinsamer Werte, grundlegender Interessen, Unabhängigkeit der Union, schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik für humanitäre Aufgaben sowie Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung und friedensschaffender Maßnahmen.
Souveränitätspolitische Vorbehalte und bündnispolitische Interessen sind nach wie vor die größten Hemmnisse für eine endgültige Verteidigungspolitische Union. Wichtig für die Zukunft der EVSP ist die Entwicklung eines strategisch-sicherheitspolitischen Konzeptes, welches Leitlinien darüber abgibt, wie die Europäische Union auf internationale Krise reagiert. Dies bedarf zudem einer breiten Legitimation und Kontrolle, die durch eine stärkere Involvierung des Europäischen Parlaments erreicht werden kann.
Ziele der EVP (Europäischen Volkspartei) zur Europäischen Sicherungs- und Verteidigungspolitik
Die Europäische Volkspartei, Zusammenschluss aller christlich-demokratischen Parteien der Europäischen Gemeinschaft, der auch die CDU/CSU-Fraktion angehört, fördert auch im Bereich der Europäischen Sicherungs- und Verteidigungspolitik unter Wahrung einer europäischen Wertegemeinschaft die Aktionseinheit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
Die EVP fordert daher insbesondere im Bereich der Sicherheitspolitik einen Ausbau der Union und hat hierzu auf dem Berliner Kongress im Januar 2001 insbesondere zu den Punkten illegaler Waffenhandel und Terrorismusbekämpfung im Rahmen des Politikprogramms „Eine Werteunion“ ihre Standpunkte diskutiert.
Dringenden Handlungsbedarf sieht die EVP beim Aufbau einer gesamteuropäischen Sicherheitsordnung und bei der Schaffung eines verteidigungspolitischen Instrument.[4]
4. Forderungen der CDU/CSU für die Europäische Sicherungs- und Verteidigungspolitik
Maximalforderungen der CDU/CSU
Im Vertrag von Amsterdam wurde deutlich, dass die Westeuropäische Union (WEU) als verteidigungspolitische Komponente der Europäischen Union und als europäischer Pfeiler des Atlantischen Bündnisses (NATO) dienen soll. Die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten der EU und WEU mit der NATO und den Vereinigten Staaten bleibt daher ein vorrangiges Ziel der CDU/CSU-Fraktion. Hierzu leisteten bereits der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl und François Mitterrand 1991 durch die Gründung eines deutsch-französischen Korps ihren Beitrag. Diesem schlossen sich auch weitere Staaten an, so dass 1993 der Eurokorps mit Sitz in Straßburg gegründet werden konnte.[5]
Obwohl die CDU/CSU-Fraktion Maximal- und Minimalforderungen bei Fragen der Europäischen Sicherungs- und Verteidigungspolitik stellt, äußert sich der baden-württembergische Ministerpräsident Erwin Teufel nur am Rande zu Sicherungs- und verteidigungspolitischen Fragen.
Zum Aufbau einer militärischen Aufbautruppe bis 2003 verfolgt die CDU/CSU wie auch die EVP eine Aufstockung des Personals auf 60.000 Soldaten. Ziele dieser Aufstellung sind nicht die Schaffung neuer Streitkräfte, sondern das Vereinigen bereits bestehender Streitkräfte und Strukturen.
Kompetenzen der gemeinsamen Sicherungs- und Verteidigungspolitik sollten sein: grenzüberschreitende Bekämpfung internationaler Kriminalität sowie Terrorismusbekämpfung. Die öffentliche Sicherheit und Ordnung allerdings sollte nach wie vor Sache des jeweiligen Mitgliedstaates bleiben. Sicherung und Verteidigung nach Ansicht der CDU/CSU-Fraktion fällt unter das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit, d.h. gegenseitige Unionstreue, die vereinbart werden sollte. Sicherungs- und Verteidigungspolitik ist demnach Teil der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Zur Sicherung gehört auch die Festlegung der Befugnisse von Europol und einer gemeinsamen europäischen Grenzpolizei.
Europa braucht also zusätzliche Kompetenzen in der Außen- und Sicherheitspolitik. Dies beinhaltet nicht, dass im Inneren Sicherheit und Ordnung Sache der Union sein sollten- im Gegenteil: auch hier sollten Kompetenzen von unten nach oben verteilt werden. Nach „Außen“ fordert die Fraktion allerdings eine überzeugende und durchschlagende Sicherheitspolitik. So kritisiert sie z.B. eine fehlende Präsentation wie sie im Jugoslawienkrieg erfolgte, als jeweils drei Ratspräsidenten, der frühere, derzeitige und spätere, vermittelten und die USA zur Äußerung veranlassten, welches eigentlich die „Telefonnummer“ Europas sei.
Die CDU/CSU fordert daher mit Nachdruck ein starkes Europa. Will man weltpolitisch stark auftreten, bedarf es einer zunehmenden Aufgabenübertragung in puncto Sicherheit und Verteidigung nach Europa. Die Union muss zusammen mit den Mitgliedstaaten über die Instrumente verfügen, den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts tatsächlich zu schaffen. Notwendig ist dazu die Überführung der „dritten Säule“ des Unionsvertrages in die künftige Gemeinschaftskonstruktion.
Für die innere Sicherheitspolitik fordert die Fraktion den Aufbau einer europäischen Grenzpolizei als vorrangige Aufgabe. Dazu gehört die Einrichtung eines Systems zur Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit, integriertes Grenzmanagement und ein Koordinationssystem der Mitgliedstaaten. Anzumerken ist auch, dass im Bereich der Tätigkeiten von Europol, der grundsätzliche Belange wahrnimmt, Kompetenzen an diesen nur einstimmig übertragen werden können.
Grundsätzlich richtig ist das Mitentscheidungsverfahren in Kombination mit qualifizierter Mehrheitsentscheidung im Rat, jedoch sollten bei der Sicherungspolitik nationale Interessen weitgehend berücksichtigt bleiben. Im gesamten Bereich des Strafrechts, das sehr eng mit unterschiedlichen nationalen Rechtstraditionen verknüpft ist, spricht im Übrigen viel dafür, am Einstimmigkeitsprinzip festzuhalten.
Bezüglich der gemeinsamen Verteidigungspolitik ist die CDU/CSU-Fraktion der Ansicht, dass Deutschland innerhalb Europas eine größere außen- und verteidigungspolitische Verantwortung trägt. Hierzu befürwortet sie eine stärkere Rolle, auch innerhalb der Europäischen Union, da das wiedervereinigte Deutschland strategisch und größenmäßig die Mitte Europas einnimmt, ohne allerdings einen deutschen Sonderweg zu unterstützen.
Deutschland soll auch künftig ein berechenbarer, zuverlässiger und verantwortungsbewusster Partner in der internationalen Gemeinschaft sein. In diesem Rahmen muss sich Deutschland im Rahmen der Europäischen Union seiner Mitverantwortung im Rahmen der Friedensarbeit der Vereinten Nationen stellen, aktiv am Ausbau der gesamteuropäischen Kooperation teilnehmen und dazu die Bundeswehr stärken.
Die europäischen Streitkräfte sollten daher unbedingt Beiträge zur militärischen Friedenssicherung in- und außerhalb des NATO-Vertragsgebietes leisten. Als eines der politisch und wirtschaftlich bedeutendsten Gebieten dieser Erde muss die Europäische Union einen Beitrag zur Konfliktverhinderung und Krisenbewältigung leisten und so zu mehr Stabilität nicht nur in Europa, sondern auch in der Welt beitragen. Eine unbedingte Teilnahme an friedensbringenden Missionen der UNO und der NATO sind daher wesentliche Bestandteile einer glaubwürdigen europäischen Friedens- und Verteidigungspolitik.
Deutschland und den anderen Mitgliedstaaten der NATO, die ebenfalls Mitgliedstaaten der EU sind, kommt die wesentliche Aufgabe zu, an Mandaten der Vereinigten Nationen, der OSZE oder unter NATO-Kommando an internationalen Einsätzen zu Krisenvorsorge und Bewältigung teilzunehmen. Zu einer optimalen Zusammenarbeit ist dafür Sorge zu tragen, dass die europäischen Streitkräfte nicht nur optimal ausgebildet, sondern auch hervorragend ausgestattet und mit modernen Gerät ausgestattet sind.
Unbedingte Forderung der CDU/CSU-Fraktion ist die Bildung internationaler und europäischer Verbände zur Wiederherstellung des Weltfriedens.
Das Verhältnis der Europäischen Union zur NATO bedarf einer Stärkung. Hierzu sollte der Hohe Beauftragte der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik an den Sitzungen des NATO-Rates und der NATO-Generalsekretär an Sitzungen des Rates der EU-Außenminister teilnehmen. Durch eine Stärkung der europäischen Verteidigung darf die NATO nichts an ihrer Bedeutung für die kollektive Verteidigung Europas einbüßen.
Vorrangig ist die Schaffung gemeinsamer Verfahren zu politischer Entscheidungsfindung und zur Mobilisierung militärischer Kräfte im EU-Rahmen vor dem Hintergrund bestehender NATO-Strukturen. Mit der Übernahme der WEU-Funktionen durch die Europäische Union sollten alle entsprechenden Mechanismen der förmlichen Zusammenarbeit zwischen EU und NATO auch unter Einbeziehung der Mitgliedstaaten, die nicht NATO-Partner sind, eingeleitet werden. Da die NATO nicht dupliziert werden kann, bedarf es überdies der weiteren militärischen Präsenz der USA in Europa.
Die CDU/CSU-Fraktion befürwortet nachdrücklich die Aufnahme der automatischen Beistandsverpflichtung in den EU-Vertrag. Voraussetzung hierzu ist die volle Integration der WEU in die EU.
Der Krieg im ehemaligen Jugoslawien hat bewiesen, dass die Europäische Union zu gemeinsamen militärischen Handeln befähigt werden muss, um ihre GASP glaubwürdig durchsetzen zu können. Dies bedeutet einen nötigen Ausbau der Verteidigungsfähigkeiten der Union, d.h. eine Aufstockung des Verteidigungsetats, insbesondere der Aufklärungstechnik. Ziel ist der Aufbau europäischer Streit- und Verteidigungskräfte, der durch die Schaffung einer Europäischen Rüstungsagentur begleitet werden könnte.
Minimalforderungen und Rückfallpositionen der CDU/CSU-Fraktion
Bezüglich der Etablierung einer Europäischen Grenzpolizei fordert die CDU/CSU-Fraktion ein System zur Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit, insbesondere nach der sog. „Osterweiterung“ der Union. Die Fraktion unterstützt langfristig die Schaffung einer eigenständigen Europäischen Grenzpolizei, ist aber derzeit als Rückfallposition auch mit einem integrierten Grenzmanagement als Kooperationssystem einverstanden, fordert jedoch mindestens ein einheitliches System der inneren Sicherheitserhaltung.
Die Maximalforderung der CDU/CSU-Fraktion bezüglich der Pfeilerkonstruktion nach dem Vertrag von Nizza ist deren Auflösung unter Beibehaltung spezieller Verfahren der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen. Zumindest sollte es jedoch, falls die Pfeilerkonstruktion beibehalten wird, eine grundsätzliche Annäherung der Instrumente polizeilicher und justizieller Zusammenarbeit an die bewährten Handlungsformen des ersten Pfeilers geben.
Alternativ könnte auch überprüft werden, inwiefern diese Handlungsformen auch im Falle eines Beibehaltung der Pfeilerkonstruktion im Bereich des bisherigen dritten Pfeilers Anwendung finden könnten. Die Fraktion lehnt jedoch strikt eine pauschale Anwendung von Verordnungen und Richtlinien im gesamten Bereich des bisherigen dritten Pfeilers ohne Rücksicht auf die Besonderheiten des nationalen Strafrechts und der Polizeiarbeit ab.
Zu einer effektiven Verteidigungspolitik der Europäischen Union sollte eine auch von der EVP geforderte militärische Aufbautruppe anvisiert werden. Zu diesen europäischen Verbänden verfolgt die CDU/CSU eine Personalaufstockung auf 60.000 Soldaten. Das Vereinen bereits bestehender Streitkräfte sollten bestehende nationale Strukturen mindestens vereint werden.
Für den Falle nationaler Einwände fordert die Fraktion, dass die Mitgliedstaaten- insbesondere die, die auch NATO-Mitglieder sind- ihre Soldaten optimal ausbilden und ausstatten, um aus ihrem Auftrag erwachsene Risiken so gering wie möglich zu halten. Dazu bedarf es einer angemessenen finanziellen Ausstattung der Streitkräfte, um eine Aktionseinheit der europäischen Streitkräfte zu garantieren. Schließlich erteilt die CDU/CSU militärischen Abenteurertum eine deutliche Absage, drängt aber auch auf Einhaltung der sich aus bestehenden Verträgen ergebenden Beistandsverpflichtungen.
Abschließend sollten im Rahmen einer gemeinsamen Sicherungs- und Verteidigungspolitik gemeinsame Werte der Union diskutiert werden, so wie es die EVP im Januar 2001 auf ihrem Berliner Kongress bereits angeregt hat. Hierzu empfiehlt die CDU/CSU insbesondere zu den Punkten illegaler Waffenhandel und Terrorismusbekämpfung einheitliche Werte sowie den Aufbau einer gemeinsamen Sicherheitsordnung als minimale Forderung. Maximalforderung wäre die Schaffung gesamteuropäischer Sicherheitsordnungen und verteidigungspolitischer Instrumente.
Die Zusammenarbeit der Europäischen Union mit der NATO sollte spätestens mit dem aufgehen der WEU in der Union verstärkt werden und in diesem Rahmen alle Mitgliedstaaten umfassen. Sollten Mitgliedstaaten, die nicht NATO-Partner sind, sich nicht an militärischen Aktionen der NATO beteiligen wollen, so können sich diese aus diesen zurückziehen, ohne allerdings die Entscheidungsautonomie der Union in Frage zu stellen. Gespräche über eine förmliche Zusammenarbeit zwischen EU und NATO sind so rechtzeitig einzuleiten, dass die entsprechenden Mechanismen spätestens im Zeitpunkt der Übernahme der WEU-Funktionen durch die EU arbeitsfähig sind. Im Idealfall sollten sich NATO, die WEU und die KSZE in ihrer Verteidigungspolitik ergänzen.
Obzwar die Fraktion die Aufnahme der WEU in den EU-Vertrag und die damit verbundene Beistandsverpflichtung unterstützt, ist sie bereit, diese Verpflichtung nur für die Mitgliedstaaten zu erwägen, die dazu bereit und fähig sind. Eine europäische Verteidigungsfähigkeit umfasst zumindest die Entwicklung von Mechanismen und Instrumenten des militärischen und nicht-militärischen Krisenmanagements einschließlich präventiver Politiken.
Literatur
Algieri, Franco 2002: Die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, in: Europa Handbuch, Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn.
CDU- Christlich Demokratische Union (Hrsg.) 2002: Die Europäische Volkspartei, in: http://www.cdu.de/politik-a-z/europa/kap2_2.htm, Berlin.
Läufer, Thomas (Hrsg.) 2000: Vertrag von Amsterdam, Texte des EU-Vertrages und des EG-Vertrages mit den deutschen Begleitgesetzen, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn.
Weidenfeld, Werner (Hrsg.) 2002: Europa Handbuch, Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn.
Weidenfeld, Werner und Wolfgang Wessels (Hrsg.) 2002: Europa von A-Z, Taschenbuch der Europäischen Integration, Europa Union Verlag GmbH, Bonn.
Alle Angaben beruhen auf der Lektüre von Redebeiträgen des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Herrn Erwin Teufel, in seiner Eigenschaft als Ministerpräsident von Baden-Württemberg und Präsident des Deutschen Bundesrates.
Im Folgenden sind in chronologischer Reihenfolge seine Beiträge als Quellenangaben aufgelistet:
CDU- Christlich Demokratische Union 2002: Der Europäische Konvent, Links in: http://eu-konvent-bw.de, Berlin.
CDU- Christlich Demokratische Union 2002: Parteitag der CDU, in: http://www.cdu.de/politik-a-z/parteitag/sonst-pt13.htm, Berlin
Europäischer Konvent 2002: Europäischer Konvent, Links in: http://european-convention.eu.int/
Teufel, Erwin 2002-03-21/22: Statement von Erwin Teufel, Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, in der Generaldebatte „Erwartungen an die Europäische Union“ bei der Tagung des Konvents zur Zukunft Europas am 21./22. März 2002 in Brüssel, in: http://european-convention.eu.int/docs/speeches/1006.pdf, Sekretariat des Europäischen Konventes, Brüssel.
Teufel, Erwin 2002-04-09: Verfassungsvertrag für die Europäische Union, in: http://register.consilium.eu.int/pdf/de/02/cv00/00023d2.pdf, Europäischer Konvent, Brüssel.
Teufel, Erwin 2002-04-09: Eckpunkte für den Konvent, in: http://register.consilium.eu.int/pdf/de/02/cv00/00024d2.pdf, Europäischer Konvent, Brüssel.
Teufel, Erwin 2002-05-15: Rede von Ministerpräsident Erwin Teufel anlässlich der Sitzung des Landtags am 15. Mai 2002 in Karlsruhe, in: http://www.baden-württemberg.de/sixcms_upload/media/17/rede_teufel_sitzung_landtag_karlsruhe_150502.pdf, Landesregierung Baden-Württemberg, Stuttgart.
Teufel, Erwin 2002-06-06: Rede von Ministerpräsident Erwin Teufel auf dem Europäischen Konvent am 6. Juni 2002, in: http://european-convention.eu.int/docs/speeches/1008.pdf, Sekretariat des Europäischen Konventes, Brüssel.
Teufel, Erwin 2002-06-25: Redebeitrag von Herrn Ministerpräsident Erwin Teufel am 25. Juli 2002 im Rahmen der Anhörung der Zivilgesellschaft; Bereich Regionen und Gebietsörperschaften, in: http://european-convention.eu.int/docs/speeches/1162.pdf, Sekretariat des Europäischen Konventes, Brüssel.
Teufel, Erwin 2002-07-29: Gruppe I „Subsidiaritätsprinzip“ Bemerkungen zu dem ersten Vorschlag für die Schlussfolgerungen, Arbeitsdokument 09 vom 29. Juli 2002, in: http://european-convention.eu.int/docs/wd1/2354.pdf, Sekretariat des Europäischen Konventes, Brüssel.
Teufel, Erwin 2002-07-09: Gruppe I „Subsidiaritätsprinzip“ Eine wirksame Kompetenzkontrolle bei der Rechtsetzung der Europäischen Union, in: http://european-convention.eu.int/docs/wd1/1393.pdf, Sekretariat des Europäischen Konventes, Brüssel.
Teufel, Erwin 2002-10-03/04: Redebeitrag von Herrn Ministerpräsident Erwin Teufel bei der Konventssitzung am 3./4. Oktober 2002, in: http://european-convention.eu.int/docs/speeches/3519.pdf, Sekretariat des Europäischen Konventes, Brüssel.
Teufel, Erwin 2002-11-07/08: Redebeitrag von Herrn Ministerpräsident Erwin Teufel bei der Konventssitzung am 7./8. November 2002, in: http://european-convention.eu.int/ddocs/speeches/5045.pdf, Sekretariat des Europäischen Konventes, Brüssel.
Teufel, Erwin 2002-11-07/08: Redebeitrag von Herrn Ministerpräsident Erwin Teufel bei der Konventssitzung am 7./8. November 2002, Debatte über den Abschlußbericht „Ordnungspolitik“, Sekretariat des Europäischen Konventes, Brüssel.
Teufel, Erwin 2002-11-15: Rede von Ministerpräsident Erwin Teufel bei der öffentlichen Anhörung des Ständigen Ausschusses des Landtags von Baden Württemberg am 15. November 2002 zum Konvent zur Zukunft Europas, in: http://www.eu-konvent-bw.de/files/rede_teufel__151102.pdf, Landesregierung Baden-Württemberg, Stuttgart.
Teufel, Erwin 2002-11-19: Leitlinien für die Ordnung der Kompetenzen wischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten im künftigen Verfassungsvertrag, in: http://register.consilium.eu.int/pdf/de/02/cv00/oo410d2.pdf, Europäischer Konvent, Brüssel.
Teufel, Erwin 2002-12-05/06: Rede von Erwin Teufel bei der Konventssitzung am 5./6. Dezember 2002, in: http://european-convention.eu.int/docs/speeches/6057.pdf, Sekretariat des Europäischen Konventes, Brüssel.
[...]
[1] Läufer, Thomas (Hrsg.) 2000: Vertrag von Amsterdam, Texte des EU-Vertrages und des EG-Vertrages mit den deutschen Begleitgesetzen, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn.
[2] Christlich Demokratische Union (Hrsg.) 2002: Die Europäische Volkspartei, in: http://www.cdu.de/politik-a-z/europa/kap2_2.htm, Berlin, S.1.
[3] Weidenfeld, Werner und Wolfgang Wessels (Hrsg.) 2002: Europa von A-Z, Taschenbuch der Europäischen Integration, Europa Union Verlag GmbH, Bonn, S. 420.
[4] Christlich Demokratische Union (Hrsg.) 2002: Eurokorps, in: http://www.cdu.de/politik-a-z/europa/kap2_2.htm, Berlin, S.5.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Subsidiaritätsprinzip und wie bezieht es sich auf die Effektivität der Institutionen?
Das Subsidiaritätsprinzip, das im Maastrichter Vertrag von 1993 verankert wurde, besagt, dass die Europäische Gemeinschaft nur dann tätig wird, wenn die Ziele der Maßnahmen nicht auf Ebene der Mitgliedstaaten ausreichend erreicht werden können und daher auf Gemeinschaftsebene besser erreicht werden können. Ziel ist die Sicherstellung effizienter, transparenter und demokratischer Entscheidungen.
Welche Ziele verfolgt die Europäische Volkspartei (EVP) bezüglich der Subsidiarität und der Effektivität der Institutionen?
Die EVP, zu der auch die CDU/CSU-Fraktion gehört, setzt sich für eine Stärkung des Europäischen Parlaments und einen Ministerrat als Staatenkammer im föderativen Aufbau der Europäischen Union ein.
Welche Maximalforderungen stellt die CDU/CSU für die Subsidiarität und die Effektivität der Institutionen?
Die CDU/CSU fordert die Verankerung des Subsidiaritätsprinzips im Europarecht zur Verteidigung der föderativen Interessen, einen Europäischen Verfassungsvertrag zur Vereinfachung der Entscheidungsabläufe und die Wahrung der nationalen Identitäten sowie das Prinzip begrenzter Einzelzuständigkeiten der Union.
Was sind die Minimalforderungen und Rückfallpositionen der CDU/CSU bezüglich der Subsidiarität und der Effektivität der Institutionen?
Die CDU/CSU fordert, dass jede Kammer der Parlamente der Mitgliedstaaten das Klagerecht beim Europäischen Gerichtshof erhält und in die ex-post und ex-ante Kontrolle erlassener Rechtslinien eingebunden wird. Sie schlägt die Einrichtung einer Subsidiaritäts- bzw. Kompetenzkammer vor.
Was versteht man unter Europäischer Sicherungs- und Verteidigungspolitik (ESVP)?
Die ESVP umfasst die Wahrung gemeinsamer Werte, grundlegender Interessen, Unabhängigkeit der Union, schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik für humanitäre Aufgaben sowie Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung und friedensschaffender Maßnahmen.
Welche Ziele verfolgt die EVP bezüglich der Europäischen Sicherungs- und Verteidigungspolitik?
Die EVP fördert im Bereich der ESVP die Aktionseinheit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und sieht dringenden Handlungsbedarf beim Aufbau einer gesamteuropäischen Sicherheitsordnung und bei der Schaffung eines verteidigungspolitischen Instrument.
Welche Maximalforderungen stellt die CDU/CSU für die Europäische Sicherungs- und Verteidigungspolitik?
Die CDU/CSU setzt sich für die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten der EU und WEU mit der NATO ein, eine Aufstockung des Personals der militärischen Aufbautruppe auf 60.000 Soldaten und die Bekämpfung internationaler Kriminalität sowie Terrorismusbekämpfung. Sie fordert zudem zusätzliche Kompetenzen in der Außen- und Sicherheitspolitik und den Aufbau einer europäischen Grenzpolizei.
Was sind die Minimalforderungen und Rückfallpositionen der CDU/CSU bezüglich der Europäischen Sicherungs- und Verteidigungspolitik?
Die CDU/CSU fordert ein System zur Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit, unterstützt langfristig die Schaffung einer eigenständigen Europäischen Grenzpolizei, ist aber derzeit als Rückfallposition auch mit einem integrierten Grenzmanagement als Kooperationssystem einverstanden. Sie fordert zudem, dass Mitgliedstaaten ihre Soldaten optimal ausbilden und ausstatten.
Welche Rolle spielt die WEU (Westeuropäische Union) in Bezug auf die EU und die NATO?
Die WEU soll als verteidigungspolitische Komponente der Europäischen Union und als europäischer Pfeiler des Atlantischen Bündnisses (NATO) dienen.
Wie sieht die CDU/CSU die Rolle Deutschlands in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik?
Die CDU/CSU ist der Ansicht, dass Deutschland innerhalb Europas eine größere außen- und verteidigungspolitische Verantwortung trägt, befürwortet eine stärkere Rolle innerhalb der Europäischen Union und unterstützt die Mitverantwortung Deutschlands im Rahmen der Friedensarbeit der Vereinten Nationen.
- Arbeit zitieren
- Torsten Oertel (Autor:in), 2002, Subsidiarität zur Effektivität der Institutionen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107852