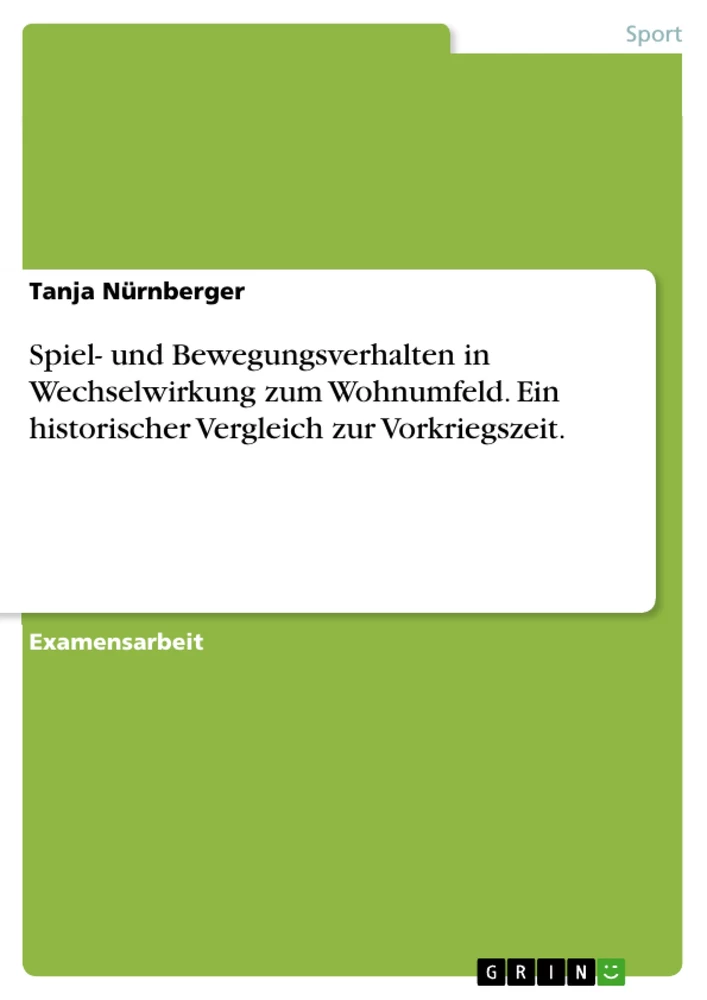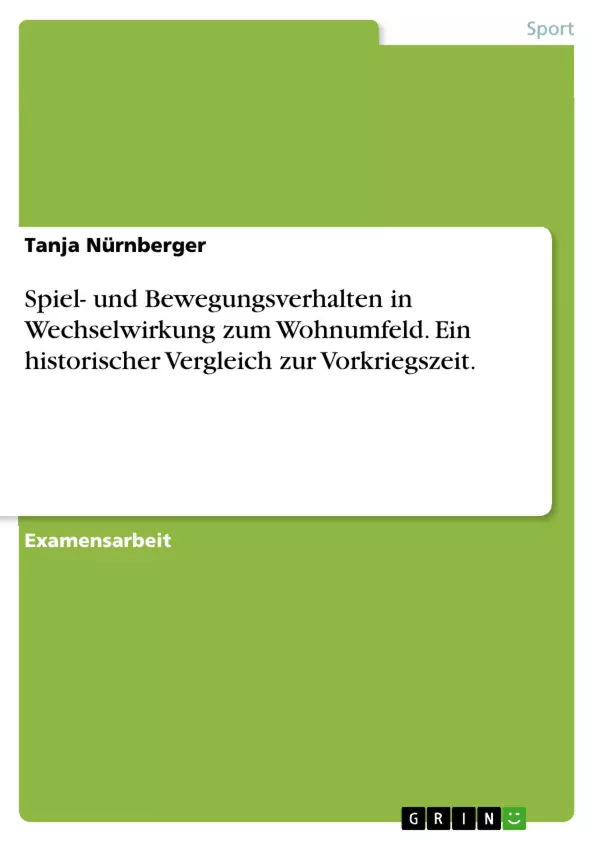„Einzelkindheit – Medienkindheit – Konsumkindheit“ sind Schlagwörter, die zur Kennzeichnung der heutigen Situation von Kindern häufig benutzt werden. Das Spiel miteinander, in der freien Natur also auf dem Rückzug? „Früher war alles besser“ wird einem häufig von den Großeltern vorgetragen. Doch war dem wirklich so?
Die Beantwortung dieser Frage verlangt zum einen eine interessante, gut recherchierte Reise in die Vergangenheit, zum anderen aber auch eine aktuelle Untersuchung über das tatsächliche Freizeitverhalten von Kindern.
Beide Aspekte miteinander in Verbindung zu setzen ist eine spannende Aufgabe, die ich mir als Thema für meine Examensarbeit gesetzt habe. Des weiteren soll eine Antithese zum Vorurteil „Kinder spielen nicht mehr auf der Straße“ entwickelt werden.
In dieser Arbeit wird zunächst die Geschichte der Kindheit und vor allem die Entwicklung des Spiels aufgearbeitet. Dabei wird auf spezifische Unterschiede durch das Wohnumfeld eingegangen, soweit dies durch vorhandene Quellen möglich ist. Mein Hauptaugenmerk werde ich auf folgende interessante Fragenstellungen richten:
Was wurde gespielt?
Wurde überhaupt gespielt?
Wann (in welchem Alter) wurde gespielt?
Welchen Einfluss hatte der geschichtliche Hintergrund beim Spiel?
Hier ende ich bewusst mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts, da die Nachkriegszeit von meiner Kommilitonin1 in ihrer Examensarbeit behandelt wird.
Anschließend folgt die Auswertung meiner empirischen Untersuchung über das Freizeitverhalten von Kindern in Bezug zu ihrem Wohnumfeld. Es soll herausgefunden werden, ob und wie Kinder in der heutigen Zeit die Straße und die Natur als Spielraum nutzen.
Ich zitiere in Form eines erweiterten Kurzbelegs, der bei Rossig / Prätsch2 nachgelesen werden kann. Eine Kopie der entsprechenden Seiten habe ich dem Anhang beigefügt.
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG
- II. THEORETISCHER TEIL
- 1. Kindheit in der Antike
- 1.1. Die Griechen
- 1.2. Die Römer
- 2. Kindheit im Mittelalter
- 2.1. Das 13./14. Jahrhundert
- 2.1.1. Land Bauernkinder
- 2.1.2. Stadt
- 2.1.3. Adel
- 2.2. Das 15. Jahrhundert
- 2.3. Die Renaissance, 1450 – 1550
- 2.4. Das 17. Jahrhundert
- 3. Kindheit in der Neuzeit
- 3.1. Erste Hälfte des 18. Jahrhunderts
- 3.1.1. Geburt und Kindersterblichkeit
- 3.1.2. Spiel und Arbeit
- a) Land Bauernkinder
- b) Stadt Stadtkinder
- 3.2. Zweite Hälfte des 18. Jahrhundert
- 3.2.1. Wandel des Begriffs,Familie’
- 3.2.2. Erziehung
- 3.2.3. Kinderliteratur
- 3.3. Selbstmord von Kindern
- 4. Kindheit im Industriezeitalter
- 4.1. Das 19. Jahrhundert
- 4.1.1. Kinderzimmer
- 4.1.2. Veränderung der Kindersituation
- 4.1.3. Kinderspiele in Köln
- a) Jungenspiele
- b) Mädchenspiele
- 4.1.4. Spiel auf dem Land
- 4.1.5. Schule
- 4.1.6. Vereine
- 4.1.7. Die Philanthropen
- 4.2. Das Kaiserreich (1860 – 1914)
- 4.2.1. Veränderungen im Alltag
- 4.2.1. Kinderspiele
- 4.2.2. Verkehrsunfälle
- 5. Und heute?
- III. DURCHFÜHRUNG DER EMPIRISCHEN STUDIE
- 6. Vorgehensweise
- 6.1. Die Zielsetzung
- 6.2. Der zeitliche Ablauf
- 6.3. Das Erhebungsverfahren
- 6.4. Die Probanden
- 6.5. Die Probleme mit dem Fragebogen
- 6.6. Der Alternativfragebogen
- IV. ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN STUDIE
- 7. Auswertung
- 7.1. Freizeitbeschäftigungen am Nachmittag
- 7.1.1. Aufenthaltsort
- 7.1.2. Freizeitbeschäftigungen im Haus
- a) Stadtkinder
- b) Landkinder
- c) Vergleich Stadt / Land
- 7.1.3. Freizeitbeschäftigungen im Freien
- a) Stadtkinder
- b) Landkinder
- c) Vergleich Stadt / Land
- 7.1.4. Sportvereine und weitere Institutionen
- 7.2. Spielräume
- 7.2.1. Erreichbarkeit (Einschätzung durch Studenten)
- a) Stadtkinder
- b) Landkinder
- c) Vergleich Stadt / Land
- 7.2.2. Nutzung der Spielräume
- a) Stadtkinder
- b) Landkinder
- c) Vergleich Stadt/Land
- 7.2.3. Vergleich zwischen Erreichbarkeit und Nutzung der Spielräume mit Bezug zur Gefährlichkeit des Wohnumfeldes
- a) Stadtkinder
- b) Landkinder
- c) Vergleich Stadt / Land
- 7.3. Spielvergleich früher - heute
- 7.3.1. Spiele
- 7.3.2. Spielzeug
- 8. Fazit
- Entwicklung des Spiel- und Bewegungsverhaltens von Kindern im historischen Kontext
- Einfluss des Wohnumfeldes auf das Spielverhalten
- Veränderungen im Spielverhalten von Kindern in Stadt und Land
- Unterschiede im Spielverhalten von Jungen und Mädchen
- Bedeutung von Spielräumen und deren Verfügbarkeit für Kinder
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Wechselwirkung zwischen dem Wohnumfeld und dem Spiel- und Bewegungsverhalten von Kindern. Durch einen historischen Vergleich mit der Vorkriegszeit werden Entwicklungen und Veränderungen im Laufe der Zeit beleuchtet.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die die Bedeutung des Spiels und der Bewegung für die Entwicklung von Kindern betont. Im theoretischen Teil wird ein historischer Überblick über die Entwicklung der Kindheit und des Spiel- und Bewegungsverhaltens von der Antike bis zur Vorkriegszeit gegeben. Dieser Teil beleuchtet die unterschiedlichen Lebensbedingungen von Kindern in verschiedenen Epochen und die daraus resultierenden Veränderungen im Spielverhalten.
Die empirische Studie untersucht das Spielverhalten von Kindern im Vergleich zwischen Stadt und Land. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass das Wohnumfeld einen erheblichen Einfluss auf das Spielverhalten von Kindern hat. Es wird deutlich, dass Stadtkinder weniger Spielraum haben und sich weniger im Freien bewegen als Landkinder.
Die Arbeit schließt mit einer Diskussion der Ergebnisse und den Schlussfolgerungen, die sich aus der Untersuchung ergeben.
Schlüsselwörter
Spiel- und Bewegungsverhalten, Wohnumfeld, Kindheit, Historischer Vergleich, Vorkriegszeit, Stadtkinder, Landkinder, Spielräume, Freizeitbeschäftigung, empirische Studie.
Häufig gestellte Fragen
Verändert das Wohnumfeld das Spielverhalten von Kindern?
Ja, die Untersuchung zeigt eine deutliche Wechselwirkung. Stadtkinder haben oft weniger freien Spielraum und nutzen seltener die Natur als Landkinder, was ihr Bewegungsverhalten maßgeblich beeinflusst.
Wie unterschied sich die Kindheit im Mittelalter von heute?
Die Arbeit beleuchtet spezifische Unterschiede zwischen Bauernkindern auf dem Land, Stadtkindern und dem Adel im Mittelalter, wobei Arbeit und Spiel oft eng miteinander verwoben waren.
Stimmt das Vorurteil, dass Kinder heute nicht mehr auf der Straße spielen?
Die Arbeit entwickelt eine Antithese zu diesem Vorurteil und untersucht empirisch, inwiefern Kinder die Straße und Natur in der heutigen Zeit tatsächlich noch als Spielraum nutzen.
Welche Rolle spielten Kinderspiele im 19. Jahrhundert in Köln?
Der Text analysiert spezifische Jungen- und Mädchenspiele dieser Zeit und wie die Veränderung der Kindersituation im Industriezeitalter, etwa durch Kinderzimmer und Vereine, das Spielen beeinflusste.
Was sind die Hauptfragen der historischen Untersuchung?
Im Fokus stehen: Was wurde gespielt? Wurde überhaupt gespielt? In welchem Alter wurde gespielt? Und welchen Einfluss hatte der geschichtliche Hintergrund auf das Spiel?
Wie wurde die empirische Studie durchgeführt?
Die Studie nutzte Fragebögen bei Probanden, um Freizeitbeschäftigungen am Nachmittag, Aufenthaltsorte und die Nutzung von Spielräumen im Vergleich zwischen Stadt und Land auszuwerten.
- Citation du texte
- Tanja Nürnberger (Auteur), 2002, Spiel- und Bewegungsverhalten in Wechselwirkung zum Wohnumfeld. Ein historischer Vergleich zur Vorkriegszeit., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10790