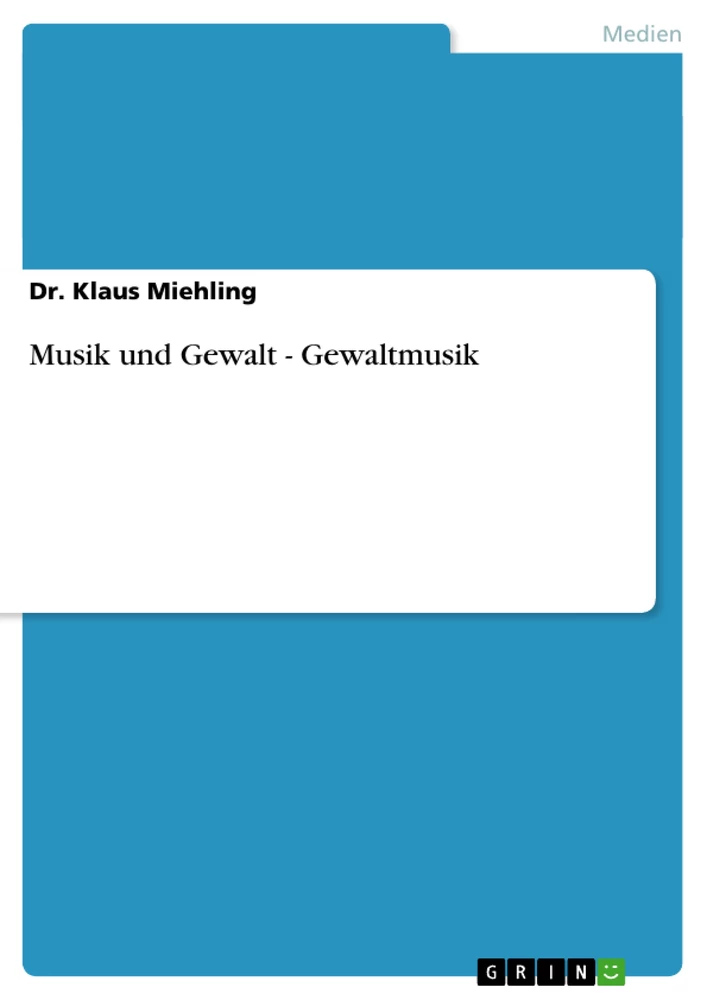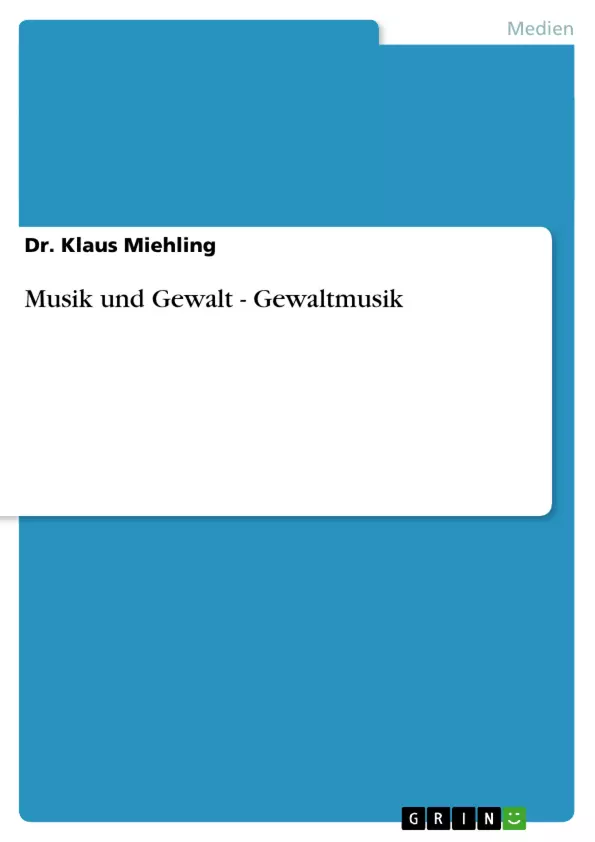Musik spielt in der Diskussion um Gewaltmedien nur eine untergeordnete Rolle. Dass Gewaltvideos sichtbare Gewalt zeigen, ist jedem - ,,einsichtig". Gewalt als akustisches Phänomen dagegen ist abstrakter. Das macht Gewaltmusik aber nicht unschädlicher als sichtbare Gewaltdarstellungen - vielleicht gerade im Gegenteil.
Die in diesem Aufsatz von 2003 formulierten Hypothesen haben sich durch die späteren Arbeiten des Autors bestätigt.
Musik und Gewalt - Gewaltmusik von Klaus Miehling, Freiburg
Schon über ein Jahr ist es her, daß der Erfurter Amoklaufes vom 26. April 2002 mit sechzehn Todesopfern wieder einmal die Aufmerksamkeit auf das Thema „Gewaltdarstellungen in den Medien" lenkte. Das ändert freilich nichts an der Relevanz des Themas, das aber schon damals, unmittelbar nach der Tat von Erfurt, zu einseitig angegangen wurde: vor allem gewaltverherrlichende Videospiele, mit denen sich der Täter beschäftigt hat, waren Gegenstand der Kritik. Aber wer fragte nach der Musik, die der Täter bevorzugt hörte?
In diesem Beitrag möchte ich also nicht über Gewaltvideos schreiben, sondern über eine Gefahr, die sich im Gegensatz zu diesen längst im Alltag etabliert hat: „Gewaltmusik". Diese Gefahr wird kaum als solche erkannt und ist deshalb, wie auch wegen ihrer Omnipräsenz, um so heimtückischer.
Ich verwende im folgenden den Begriff „Gewaltmusik", analog zu dem des „Gewaltvideo"; er läßt offen, welche Musikgattungen in welchem Umfang darunter fallen, und ermöglicht eine Diskussion ohne Vorverurteilung und Verallgemeinerung. Er setzt freilich voraus, daß es in der Tat Musik gibt, die als akustisches Phänomen Gewalt beinhaltet - so wie ein Gewaltvideo sichtbare Gewalt beinhaltet. Daß Gewaltvideos sichtbare Gewalt zeigen, ist jedem - „einsichtig". Gewalt als akustisches Phänomen dagegen kommt sozusagen in einer Verkleidung an unsere Ohren und über diese in unser Gehirn. Das macht Gewaltmusik aber nicht unschädlicher als sichtbare Gewaltdarstellungen - vielleicht gerade im Gegenteil.
„Während Filme und alles Gedruckte daraufhin untersucht werden, ob sie jugendgefährdend sind oder gegen allgemeine Gesetze verstoßen, gilt Musik grundsätzlich als harmlos", schrieb Heinz Buddemeier 1989 (S. 28). Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Zwar gibt es Veröffentlichungen zum Thema (wie die eben zitierte), doch es sind wenige; und die Tatsache, daß sie oft aus dem christlichen oder anthroposophischen Lager stammen, erschwert ihre Akzeptanz bei allen, die diese Weltanschauungen nicht teilen. Schnell wird dann der Inhalt dieser Arbeiten eben als „christlich" oder „anthroposophisch" abgetan. Doch selbstverständlich ist die weltanschauliche Orientierung eines Autors noch kein Beweis für die Unrichtigkeit seiner Thesen. In der Tat sind sogar die beiden genannten Lager gespalten: Während christliche und anthroposophische Autoren bestimmte Musikrichtungen kritisieren, werden andererseits Gottesdienste für genau diese Art von Musik geöffnet, werden an Waldorfschulen Kompositionen in solchen Stilen als Jahresarbeiten hergestellt oder mit solcher Musik unterlegte Stücke als Klassenspiele aufgeführt. Selbst diejenigen Gruppierungen also, von denen ein differenzierter und vorsichtiger Umgang mit der Bilder- und Tonflut der Medien zu erwarten wäre, sind dieser schon zum guten (oder bösen) Teil erlegen.
Um noch einmal auf Erfurt zurückzukommen: macht Gewaltmusik Mörder? Diese Frage ist ebenso zu einfach gestellt, wie die Frage, ob Gewaltvideos Mörder machen. Leider sind es nur solch extreme Ereignisse wie Mord, die in der Öffentlichkeit zu einigem Nachdenken führen; aber Gewalt beginnt natürlich viel früher. So sind angesichts der Erfurter Opfer die schon „traditionellen" Ausschreitungen zum 1. Mai in Berlin, wenige Tage später, in den Hintergrund geraten. Aber wer außer den Tätern selbst würde abstreiten, daß auch die dort ausgeübte Gewalt, die zu Verletzten und großen Sachschäden - vom kostenintensiven Polizeieinsatz ganz zu schweigen - führte, ein nicht hinzunehmendes Problem darstellt? Hier können wir auch den Bogen zurück zur Musik schlagen: In einem Fernsehbericht über diese Ausschreitungen war zu sehen, wie sich die sogenannten Autonomen mit Musik in die richtige Stimmung versetzten, und wie sie später die vollbrachten Taten mit Musik feierten. Dem unbedarften Zuschauer ist das vielleicht gar nicht aufgefallen, weil Musik und gerade Gewaltmusik schon quasi zu einem Ostinato des Fernsehprogramms geworden ist:
Sind nicht gewalttätige Szenen in Spielfilmen häufig mit einer bestimmten Art von Musik unterlegt? Machen nicht sogar ansonsten seriöse Magazin- und Nachrichtensendungen mit aggressiver Musik im Vorspann auf sich aufmerksam? Wird nicht fast jede Sportsendung mit ein- und ausleitendem Schlagzeug- und Elektronikkrach feilgeboten? Ist es nicht in den letzten Jahren üblich geworden, jedes größere internationale Sportereignis mit dem entsprechenden „Song" zu vermarkten, in dem oft mehr geschrien als gesungen wird? Nicht zu vergessen die Werbung - vor allem wenn sie sich an Jugendliche richtet, die damit in eine Rolle gedrängt werden, in der sie den Werbeagenturen offenbar besonders manipulierbar erscheinen.
Immerhin wurde schon in der die Fernsehzeitschrift „HÖRZU" festgestellt: „63 Prozent der Zuschauer fühlen sich von der Filmmusik im Fernsehen belästigt. Zu laut und auch sonst ziemlich daneben" (Heft 28/01, S. 15). Aber hat diese Mehrheitsmeinung irgend etwas bewirkt?
Parameter aggressiver Musik
Daß Musik Gefühle, „Affekte", wie man im Barock sagte, sowohl ausdrücken wie auch hervorrufen kann, weiß jeder, der sich beruflich mit Musik beschäftigt, und auch jedem Musikhörer wird es nach kurzem Nachdenken klar werden. Wen hat Musik noch nie zu Tränen gerührt, und wer hat sich andererseits noch nie über unerwünschte Musik zum unpassenden Zeitpunkt geärgert? Normalerweise aber ist Musik - welcher Art auch immer - so sehr in den Alltag integriert, daß ihre Wirkung gar nicht mehr ins Bewußtsein dringt.
Trotzdem sind wir natürlich in der Lage, einmal danach gefragt, Gefühlsinhalte eines Musikstückes assoziativ zu beschreiben. Und auch Gewaltmusik vermögen wir eigentlich gut zu erkennen. Es bedarf keiner großangelegten wissenschaftlichen Untersuchungen, um festzustellen, daß das Aggressionspotential einer Musik mit bestimmten Parametern zusammenhängt:
+ aggressiv - aggressiv
dissonant/unharmonisch konsonant/harmonisch
extreme Frequenzen (Tonhöhen) mittlere Frequenzen
Rhythmen/Betonungen gegen das Metrum metrisch kongruente Rhythmen/Betonungen
undifferenzierte Rhythmen/Betonungen differenzierte Rhythmen/Betonungen
viele Geräusche/Schlagzeug wenig Geräusche/ohne Schlagzeug
monoton melodiös
verzerrte Klanggebung „natürliche" Klanggebung
aggressive, gespannte Singstimme unaggressive, entspannte Singstimme
schnell langsam
laut leise
Bei den meisten Parametern dieser Liste läßt sich schwer zwischen Komposition und Interpretation trennen. Ein kurzer Kommentar im einzelnen:
dissonant/unharmonisch vs. konsonant/harmonisch: Eine völlig dissonanzlose Musik ist natürlich langweilig. Da unser Gehör aber von Natur aus die Konsonanz gegenüber der Dissonanz bevorzugt (wie der Name schon sagt), wird eine zu dissonante Musik aggressiv wirken; insbesondere, wenn die Dissonanzen nicht in Konsonanzen aufgelöst werden.
-extreme Frequenzen vs. mittlere Frequenzen: Wie in der Harmonik so gilt auch hier das Gesetz des richtigen Maßes.
Rhythmen/Betonungen gegen das Metrum vs. metrisch kongruente Rhythmen/Betonungen und undifferenzierte Rhythmen/Betonungen vs. differenzierte Rhythmen/Betonungen: Auch hier eine Sache der Ausgewogenheit. Ein monotones, undifferenziertes Stampfen wirkt aggressiv, aber auch sehr komplizierte, scheinbar oder tatsächlich chaotische Rhythmen und Betonungen.
viele Geräusche/Schlagzeug vs. wenig Geräusche/ohne Schlagzeug: Der Einsatz des Schlagzeugs (das auch auf elektronischem Wege simuliert werden kann) ist ein bedeutender Faktor in aggressiver Musik. Es wird natürlicherweise mit zuschlagenden Fäusten oder Gegenständen, oder mit Schußwaffen assoziiert.
monoton vs. melodiös: Hier mag die Assoziation des „Primitiven" gegenüber dem „Zivilisierten" eine Rolle spielen. Aggressivität ist nun einmal ein Erbe der Natur und unserer steinzeitlichen Vergangenheit; differenzierte Melodik erfordert dagegen ein gewisses Maß an Zivilisation, und diese kann unkontrollierte und unreglementierte Gewalt nicht zulassen.
verzerrte vs. „natürliche" Klanggebung: Beides kann für natürlich erzeugte Klänge ebenso gelten wie für elektronisch erzeugte. Hier ist vermutlich ein ähnlicher Mechanismus am Werk wie im Falle von Konsonanz und Dissonanz. Auch besteht eine Affinität zum Charakter der Äußerungen eines gewalttätigen Menschen.
aggressive, gespannte vs. unaggressive, entspannte Singstimme: Eine spezielle Ausprägung des Vorgenannten. Wir können alleine am Tonfall etwa einer Begrüßung wie „Guten Tag!" erkennen, ob der Sprecher gut oder schlecht gelaunt, müde oder munter, entspannt oder wütend, mißtrauisch oder nervös ist. Diese Kompetenz des Hörers gilt auch in bezug auf die Singstimme. Er vermag diese Botschaft, bewußt oder unbewußt, zu erkennen, und der Sänger weiß, mit welcher Art der Stimmgebung er welche Botschaft vermitteln kann.
schnell vs. langsam: Dieser Parameter ist für sich alleine wenig aussagekräftig und kann genausogut etwa für fröhlich vs. traurig stehen. Eine bereits aggressive Musik wird aber im allgemeinen an Aggressivität gewinnen, wenn sie schneller gespielt wird.
laut vs. leise: Eigentlich ein sekundärer Faktor; doch es ist charakteristisch für Gewaltmusik, daß sie normalerweise in besonders hoher Lautstärke gesendet und konsumiert wird. Es ist kein Geheimnis mehr, daß davon Gehörschäden ausgehen können, und daß mit der Verbreitung dieser Musik die Zahl der Gehörgeschädigten zugenommen hat. Die große Lautstärke hat außerdem den Nebeneffekt, daß die Musik auch Unbeteiligten, die sich in einiger Entfernung aufhalten, aufgezwungen wird.
An ihren Früchten …
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, Gewaltmusik zu erkennen: an ihrem Umfeld. „An ihren Früchten sollt Ihr sie erkennen", sagt die Bibel (Mt. 7,16), und wo sie recht hat, hat sie recht. Von Gewaltmusik ist anzunehmen, daß ihre Komponisten, Interpreten und Hörer in einem größeren Maß als vom Bevölkerungsdurchschnitt zu erwarten in Gewalt, aber auch in Kriminalität allgemein involviert sind; sind doch auch andere als die sogenannten „Gewaltdelikte" ein Ausdruck von Aggressivität, da sie Gesetze „brechen" (man beachte den sprechenden Ausdruck), und da sie andere Menschen, manchmal auch den Täter selbst (Drogenkonsum), direkt oder indirekt schädigen. Wissenschaftliche Untersuchungen scheinen hierzu weitgehend zu fehlen oder unter Verschluß gehalten zu werden. Aber warum die Augen vor etwas verschließen, was offensichtlich ist?
Ein Teil der Gewaltmusik-Szene wird ganz offen vom Satanismus beherrscht. Das zeigen schon gewaltverherrlichende Texte. Aber auch Interpreten wie Alice Cooper, Jimi Morrison, Jimmy Page, die Gruppen „Kiss" oder „Black Sabbath" bekannten oder bekennen sich zum Satanismus. Satanische Symbole auf Plattenhüllen (umgedrehtes Kreuz, die Zahl 666) beweisen ein übriges. Es geht nicht darum, ob wir an einen Satan glauben oder nicht, sondern um die Erkenntnis, daß diese Musik ihre Hörer zum Bösen bekehren will. Zu diesem Zweck bedienen sich manche Interpreten auch der Methode des „backward-masking"; dabei werden Botschaften, die etwa zur Verehrung Satans oder zu kriminellen Handlungen auffordern, rückwärts gesprochen unter die Musik gemischt. Auf diese Weise sollen die Botschaften in das Unterbewußtsein der Hörer eindringen und um so wirksamer sein. Ob diese Methode funktioniert, ist wissenschaftlich umstritten. Vermutlich ist das, was man an dieser Musik bewußt wahrnehmen kann, weit gefährlicher. Aber auch hier zeigt allein schon der Versuch der Manipulation, welcher Gesinnung die Produzenten und Interpreten dieser Musik sind. Interpreten, die „backward-masking" verwendet haben oder verwenden sind z.B. Pink Floyd, Petra, Queen, Electric Light Orchestra, Black Oak Arkansas, Eagles, Led Zeppelin, Beatles, Kiss („Kings in Satanic Service"), Madonna, Kate Bush (diese Liste nach Buddemeier/Strube 1989, S. 41).
Wenn sich Satanismus und „backward-masking" mit bestimmten Musikrichtungen verbindet, dann liegt es nahe, daß stilistisch ähnliche Musik, auch wenn sie explizit keine satanischen Botschaften enthält, einen vergleichbaren Zweck verfolgt. Ein weiteres Kennzeichen für Gewaltmusik sind gewalttätige Exzesse oder Drogenkonsum ihrer Interpreten; davon ist ja immer wieder zu lesen. Kneif (1982, S. 217f) nennt fünf Rockmusiker, die nachweislich an Drogenmißbrauch starben, und weitere Drogenabhängige dieser Zunft. Er meint, unter Rockmusikern „dürfte es nur ganz wenige geben, die überhaupt keine Erfahrungen mit Drogen haben." (Für die Spitzfindigen: Kaffee oder Alkohol in Maßen sind hier nicht gemeint!) Und in dem mir zugänglich gewesenen (letzten) Band 9 der biographischen Reihe „Idole", sind die Biographien von Alexis Korner, Eric Burdon und den „Animals", Mick Taylor und den „Rolling Stones", Ray Davies und den „Kinks" durchsetzt von Kriminalität, Drogen, Gewalt und sexuellen Exzessen - nicht umsonst ist „Sex, drugs and Rock 'n' roll" zu einem geflügelten Begriff geworden!
Gehen wir von den Interpreten zu den Hörern: Orte, die in besonderem Maße von Gewaltmusik geprägt sind, sind Diskotheken. Es ist bekannt, daß nicht wenige davon Umschlagplätze für Drogen sind. Es ist auch bekannt, daß besonders viele Autounfälle im Anschluß an Diskothekenbesuche passieren, wobei häufig noch im Auto Gewaltmusik gehört wurde. Auch werden Diskotheken von vielen Jugendlichen, wie schon vor zwanzig Jahren (vgl. Mezger 1980), so gewiß noch heute, als Orte für die Anbahnung erotischer oder gar sexueller Kontakte genutzt. Das gehört durchaus hierher, denn der heutigen veröffentlichten Meinung zum Trotz läßt sich doch nicht leugnen, daß die heute als veraltet geltende Sexualmoral unserer Großeltern durchaus einen Sinn hat, der übrigens auch ihren Verächtern zugute käme: die Verhinderung von unerwünschten Schwangerschaften und Geschlechtskrankheiten nämlich; ganz zu schweigen von den psychischen Schäden, wenn der eine Partner eine dauerhafte Beziehung, der andere nur ein schnelles Abenteuer sucht. Frith stellt 1981 fest (S. 25): „Ein Aspekt des Rhythmus der schwarzen Musik - wofür Disco des jüngste Beispiel liefert - ist die eindeutige Äußerung solcher [sc. sexueller] Spannungen und Bedürfnisse. Im Gegensatz zu den westlichen Tanzformen [...] wird in der schwarzen Musik der Körper und damit die Sexualität durch einen direkten körperlichen Beat und einen intensiven emotionellen Sound unmittelbar angesprochen ...". Auch die Art des Tanzens, die in Diskotheken zu beobachten ist, zeigt den Charakter von Enthemmung, Regellosigkeit und Aggression. Schon 1929 erkannte ein Tanzkritiker im Tanz der „schwarzen Musik" Amerikas, aus der später die Rockmusik hervorging (nach Frith 1981, S. 30): „Männer und Frauen, die so tanzen, haben auch die Fähigkeit zur Gewalt". Sogar der Pop- und Rockmusik im weiteren Sinne positiv zugewandte Autoren leugnen den aggressiven Charakter nicht (vgl.o. zur Reihe „Idole"). Paul Garon beschreibt den Blues als „aggressive und kompromißlose Durchsetzung der Allmacht von Begierde und Phantasie im Angesicht aller Unterdrückungen" (Frith 1981, S. 25). Schon Platon sah bekanntlich in bestimmten „harmoniai" („Tonarten", wobei der Begriff nicht mit dem heutigen vergleichbar ist) eine Gefahr für das Gemeinwesen und wollte dieselben verbieten. Wir wissen nicht viel über die Musik der alten Griechen, doch es darf bezweifelt werden, daß ihr Gewaltpotential auch nur entfernt an das heutiger Musik heranreicht - zumindest die heutigen extremen Lautstärken waren damals nicht erzielbar gewesen. Um wieviel sensibler müßten wir da heute auf die Botschaften der modernen aggressiven Musik achten!
Bei und nach Konzerten mit Gewaltmusik kommt es nicht selten zu Ausschreitungen. Selbst harmlosere Dinge, etwa der Zustand, in dem ein Konzertschauplatz hinterlassen wird (man denke an die Müllberge nach der alljährlichen „Love-Parade"), sind verräterisch. Gewaltmusik hat auch bei vielen Sportveranstaltungen ihren Platz. Läßt sich möglicherweise für die letzten Jahrzehnte ein statistischer Zusammenhang zwischen der zunehmenden Verwendung von Gewaltmusik in Fußballstadien und der zunehmenden Gewalt im Umfeld von Fußballspielen feststellen?
Wer all das in diesem Abschnitt Gesagte als Einzelfälle oder Zufälle abtun möchte, der braucht nur Vergleiche mit Konzerten „klassischer" Musik zu ziehen: Ein Opernhaus als Drogenumschlagsplatz? Der Zuschauerraum nach der Aufführung voller Abfall? Eine Häufung von Autounfällen nach „klassischen" Konzertveranstaltungen? Ein „E-Musik"-Künstler, der unter Drogeneinfluß auf die Bühne geht und Hoteleinrichtungen zertrümmert? Spätestens jetzt sollte beim Leser ein Aha-Erlebnis stattgefunden haben.
Ein Indiz für das Gewaltpotential einer Musik ist auch, wie sie sich aufdrängt: Große Lautstärke, die einen weiten Umkreis beschallt, ist hier ebenso zu nennen wie aufgezwungene Präsenz an Orten, die fast jeder aufsuchen muß (Kaufhaus, Supermarkt). Und tatsächlich ist es fast immer eine ihrem Wesen nach aggressive Musik, die in diesen Fällen und an diesen Orten zu hören ist.
„U" und „E"
Wir unterteilen die Musik traditionell in U- und E-Musik. Das sind zu Recht umstrittene Begriffe, aber wir spüren doch, daß die Unterscheidung als solche (Übergänge nicht ausgeschlossen) einen Sinn ergibt; sie würde sonst nicht schon so lange funktionieren. Es wird dem Leser nicht entgangen sein, daß die oben beschriebenen Eigenschaften von Gewaltmusik, ihrer Interpreten und Konsumenten, auf weite Bereiche der U-Musik zutreffen. Oft finden wir hier alle oben genannten Aggressivitätsparameter vereint, während in sogenannter E-Musik kaum mehr als zwei oder drei von ihnen gleichzeitig anzutreffen sind.
Ein gewisses Gewaltpotential, wenn auch weitaus geringer als das der meisten U-Musik, hat in der E-Musik die sogenannte Avantgarde, d.h. die sich an der jeweiligen Spitze der musikalischen Entwicklung fühlenden Arten neuer Musik des 20. Jahrhunderts.
Zweifellos lassen sich die o.g. Parameter noch weiter überdenken, genauer definieren und auch gewichten. So ist „schnell vs. leise" gewiß weit weniger relevant als „verzerrte vs. natürliche Klanggebung", und ein Stück mit zwei gewichtigen Parametern kann aggressiver wirken als ein anderes, das vier weniger gewichtige enthält. Wie bedeutsam die „Klanggestaltung" für die Beurteilung ein und desselben Musikstückes ist (allerdings nur, wenn es sich um ein den Probanden nicht bereits bekanntes Stück handelt), wurde jüngst von Hans-Joachim Maempel in einem Experiment mit Schülern von 12 bis 20 Jahren gezeigt (vgl. die kleine Literaturliste am Ende dieses Beitrags).
Sicher werden wir bei der Beurteilung von Musik, wie auch bei der Beurteilung von Literatur und von Filmen, nicht ohne unser menschliches Empfinden auskommen. Dieses ist es ja schließlich, das von der Musik angesprochen wird. Wenn wir anerkennen, daß Musik Wirkungen auf die menschliche Psyche haben kann, dann wäre es naiv zu glauben, es könne sich nur um positive Wirkungen handeln. Wir müssen auch bedenken, daß es nicht um die Folgen eines einmaligen Anhörens geht, sondern daß Musik mit gewalttätigen Elementen überall auf uns einströmt: im Radio, im Fernsehen, in der Werbung, im Lokal, im Supermarkt, aus dem Walkman des Mitreisenden, aus der Stereoanlage des Nachbarn, im Plattenladen, in Kaufhäusern und Boutiquen. Welchen Anteil diese Massenbeschallung tatsächlich an der Gewalt und Kriminalität in unserer Gesellschaft hat, läßt sich derzeit kaum erahnen. Das darf aber kein Grund sein, die Augen davor zu verschließen - die Ohren jedenfalls sind ihr mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert. Wegsehen ist einfacher als weghören. Auch die besten Ohrenstöpsel, wenn man sie denn zur rechten Zeit parat hat, sind machtlos gegen die oft besonders große Lautstärke von Gewaltmusik, gegen das harte Schlagzeug und gegen die Vibrationen der tieffrequenten Bässe.
Wissenschaftliche Erkenntnisse
War das noch nicht wissenschaftlich genug? Beginnen wir mit dem Versuch an Pflanzen und Tieren. Fernando Salazar Bañol (²1993, S. 45 - 49) berichtet von Untersuchungen, wonach Pflanzen unter Rockmusikbeschallung schlechter gedeihen als unter klassischer Musik. Ich erinnere mich an vergleichbare Experimente, über die in Fernsehsendungen berichtet wurde, einschließlich eines Experimentes mit Ratten oder Mäusen, die unter Rockmusikbeschallung krank wurden und ein aggressives Sozialverhalten entwickelten, während eine mit klassischer Musik beschallte Vergleichsgruppe von dieser Entwicklung verschont blieb.
Und die Übertragbarkeit auf den Menschen? Jedenfalls würde kein neues Medikament beim Menschen zugelassen werden, das sich an Ratten als schädlich erwiesen hat. Aber es gibt auch Untersuchungen, die einen Zusammenhang zwischen Aggressivität und bestimmten Musikvorlieben bzw. Hörgewohnheiten beim Menschen beweisen:
1. Zu den „hoch signifikanten" Ergebnissen einer Studie von Christoph Langenbach (1988, ed. 1994) gehört, daß Jugendliche mit einem „Musikkonsum laut und viel" eine höhere Neigung zu aggressivem Verhalten besitzen als solche mit „Musikkonsum differenziert und leise" (S. 209).
2. Gunter Kreuz schreibt im Abstract seines im Rahmen der DGM-Jahrestagung 2001 gehaltenen Vortrages: „Frühere Befunde legen nahe, daß ein Zusammenhang besteht zwischen persönlichen Dispositionen bei Kindern und Jugendlichen etwa zu allgemeiner Risikobereitschaft und musikalischen Vorlieben für aggressive Musikgenres. Die vorliegende Untersuchung sollte klären, ob solche Zusammenhänge bereits bei jüngeren Kindern im Alter von neun bis zehn Jahren vorhanden sind. [...] Es zeigte sich nach einer Varianzanalyse, daß die 'gefährdeten' Kinder schnellen Pop hoch signifikant bevorzugen." Als „gefährdet" werden hier Kinder bezeichnet, „die aufgrund der Aggressionsdiagnostik einer psychologischen Intervention anempfohlen sind." Und um die traditionelle Aufteilung in „U" und „E" nochmals ins Spiel zu bringen: „Bemerkenswert erscheint schließlich, daß die Bevorzugung einiger komplexer Musikbeispiele mit niedrigeren Aggressionswerten korrelierte." Die verwendeten Stücke werden in diesem Abstract nicht genannt; doch bedeutet das jedenfalls, daß kompositorisch anspruchsvollere Musik, und das ist zumeist E-Musik, von Kindern mit geringer Aggressionsneigung bevorzugt wird.
3. Im Fall der sogenannten Avantgarde innerhalb der E-Musik konnte Klaus-Ernst Behne in einer Studie über Hörertypologien feststellen (1986, S. 157), „daß ... die avantgarde, an sich der 'musikalische Buhmann' der heutigen Jugend schlechthin ..., bei ... harten Rockfans immerhin im mittleren Bereich ... angesiedelt ist!" D.h. während avantgardistische Musik von den meisten Jugendlichen abgelehnt wird, zeigen sich die Liebhaber „harter", also besonders aggressiver Rockmusik, der Avantgarde gegenüber relativ aufgeschlossen.
Gegenargumente
Ein paar Gegenargumente drängen sich zunächst auf. Haben nicht rechte wie linke Diktaturen die hier als aggressiv eingestufte Musik unterdrückt? Haben nicht Nationalsozialisten mit Begeisterung Wagner gehört? Müßte Wagner dann nicht auch zur Gewaltmusik gerechnet werden?
Bei diesen Fragen muß berücksichtigt werden, warum diese Musik jeweils unterdrückt wurde. Es war nur teilweise ihr aggressives Potential, das immerhin erkannt wurde: hätte es sich gegen die Diktatoren selbst richten können; vor allem war es die Herkunft: Jazz wurde von den Nationalsozialisten als „Negermusik" verachtet, und die vom Klassenfeind Amerika herüberdrängende Rockmusik war natürlich in den sozialistischen Ländern unwillkommen. Vergessen wir nicht, daß im Nationalsozialismus auch ein Komponist wie Walter Braunfels als „entartet" galt. Wer seine Musik kennt, wird dies nur auf seine jüdische Herkunft beziehen, nicht aber auf seine Werke, die stilistisch so weit nicht von denen des hochgeschätzten Richard Wagner entfernt sind.
Damit sind wir bei der zweiten Frage: Wagner als Gewaltmusik? Nein, denn es ist gerade die heutige, nie zuvor dagewesene Omnipräsenz der Musik, die in ihrer Masse eine hinreichende statistische Relevanz für die hier vorgebrachten Behauptungen erlaubt. Eine Affinitität einzelner nationalsozialistischer Führungspersönlichkeiten zur Musik Wagners, die vielleicht mehr auf dem Aspekt des Germanentums als auf wirklicher Musikliebe beruhte, ist deshalb nicht ausreichend, um Wagner als Gewaltmusik zu klassifizieren. Allenfalls spricht es gegen eine eventuelle Annahme, Wagners Musik könne im Gegenteil die Menschen zum Guten bekehren. Im übrigen ist nicht bekannt, daß die Kriminalität in Bayreuth zu Zeiten der Wagner-Festspiele signifikant ansteigen würde.
Natürlich kennt jeder irgendwelche Konsumenten von Gewaltmusik, die nicht zu Gewalttätigkeit zu neigen scheinen. Nun, auch der Mörder von Erfurt zeigte keine solchen Anzeichen, wenn man den Aussagen seiner Verwandten und Bekannten glauben darf. Aber auch wenn nur einer von tausend Gewaltmusikkonsumenten durch die Musik zum Gewalttäter würde, wäre das angesichts der Verbreitung dieser Musik schlimm genug. Vor allem aber hat Gewalt viele Gesichter. Wenn man sie in jeder Art von Kriminalität gespiegelt sieht, wie schon oben angedeutet, dann gerät die Tatsache, daß etwa Verkehrsdelikte, Steuerhinterziehung und Versicherungsbetrug heutzutage eine immense Verbreitung haben, in eine auffallende Parallele zur Verbreitung von Gewaltmusik. Die große Schwelle, die Gewaltmusik - möglicherweise - überwinden hilft, liegt zwischen legalem und illegalem Verhalten, weniger zwischen „etwas illegalem" und „sehr illegalem" Verhalten.
Das Recht auf akustische Selbstbestimmung
Es gilt aber auch, diejenigen vor Gewaltmusik zu schützen, die sie nicht hören möchten. Zumindest hier sollte schnell ein Konsens erreichbar sein. Die meisten Raucher akzeptieren heute, daß sie ihren Rauch einem Nichtraucher nicht aufzwingen dürfen. Entsprechendes sollte auch für Musikkonsumenten gelten, und natürlich unabhängig von der jeweiligen Musikrichtung. Dies wird freilich zum Problem, wenn „klassische" Musiker zuhause üben wollen und müssen, oder wenn harmlose Hausmusik gemacht wird. Immerhin dürften die meisten dieser Personen die vorgeschriebenen Ruhezeiten respektieren - was man von Gewaltmusikhörern und Kneipenwirten erfahrungsgemäß selten sagen kann (noch ein Indiz!). Aber hier wird nun eben doch bedeutsam, daß Musik mit einem hohen Aggressionswert eher als Belästigung empfunden wird als Musik mit einem niedrigen Aggressionswert. Hörer von Gewaltmusik scheinen „gewaltfreie" Musik eher ertragen zu können als umgekehrt. Das erklärt sich aus der Sache selbst; und daß eine solche Unterscheidung tatsächlich statthaft ist, wurde inzwischen hinreichend ausgeführt.
Maßnahmen
Folgende Maßnahmen wären geeignet, dem Gewaltpotential bestimmter Musikrichtungen wie auch der Zwangsbeschallung zu begegnen:
Weitere wissenschaftliche Untersuchungen von Musikwirkungen und -präferenzen. Interessant wäre etwa der Vergleich der Musikpräferenzen von Gefängnisinsassen mit den entsprechenden Werten des Bevölkerungsdurchschnitts.
Verbot von Musikbeschallung an der Allgemeinheit zugänglichen Orten.
Walkmanverbot in geschlossenen Räumen; im Zug separate Abteile wie für Raucher.
Beschränkung der erzielbaren Lautstärke von Tonwiedergabegeräten auf „Zimmerlautstärke". Für Geräte, die in größeren Räumen für Vortrags- oder Tanzveranstaltungen benötigt werden, könnte eine Ausnahme gemacht werden. Aber auch hier müßte die maximale Lautstärke weit unter den heute erreichbaren Werten liegen.
Bessere Schalldämmung in und an Gebäuden.
Juristische Anerkennung von Zwangsbeschallung als Eingriff in das Persönlichkeitsrecht und als Körperverletzung.
Kontrolle von Musikaufnahmen vor deren Freigabe und ggf. Kennzeichnung als gewaltverherrlichend oder -fördernd, wie dies bei Filmen und Videospielen längst Praxis ist.
Frühzeitige Aufklärung über Wesen und Ziele von Gewaltmusik in der Schule. Wie dies im einzelnen zu geschehen hat, soll hier nicht diskutiert werden. Nur so viel: Wer vor Drogenkonsum warnt, wird nicht die Schüler im Unterricht Drogen konsumieren lassen. Die heute oft zu beobachtende anbiedernde Art, Gewaltmusik im Unterricht zu behandeln, sei es auch mit ein paar kritischen Begleitworten, ist pädagogisch hochbendenklich.
Wer die hier geforderten Maßnahmen als reglementierungswütig, reaktionär oder gar diktatorisch empfindet, der sei darauf hingewiesen, daß sie nur konsequent auf die Musik anwenden, was auf anderen Gebieten (Filme, Videospiele, Drogen, Tabak) bereits eine Selbstverständlichkeit und gesellschaftlich weitgehend akzeptiert ist.
Dabei verbieten die genannten Maßnahmen niemandem, in angemessener Lautstärke und mit Respekt vor dem akustischen Selbstbestimmungsrecht anderer die Musik seiner Wahl zu hören. Von einem Verbot bestimmter Musik war noch gar nicht die Rede. Auf ein solches Verbot zu verzichten, wäre gleichwohl verantwortungslos, sollte sich der hier anhand zahlreicher Indizien geäußerte Verdacht auf die gewaltfördernde Wirkung bestimmter Musik erhärten.
Doch selbst wenn sich eine derartige Kausalität nicht bestätigen würde, sollten wir uns fragen, weshalb wir Musikrichtungen mit solch unübersehbarer Affinität zu Kriminalität und Gewalt einen solch dominierenden Stellenwert in unserer Gesellschaft einräumen.
Literatur
Behne, Klaus-Ernst: Hörertypologien. Zur Psychologie des jugendlichen Musikgeschmacks = Perspektiven zur Musikpädagogik und Musikwissenschaft 10, Regensburg 1986.
Buddemeier, Heinz und Strube, Jürgen: Die unhörbare Suggestion, Stuttgart 1989.
Buddemeier, Heinz: Bewußtseinslähmende Musik mit negativen Inhalten; in: Buddemeier/Strube a.a.O., S. 13 - 37.
Frith, Simon: Jugendkultur und Rockmusik, Reinbek bei Hamburg 1981.
Glogauer, Werner: Kriminalisierung von Kindern und Jugendlichen durch Medien, Baden-Baden 1991.
- ders.: Die neuen Medien verändern die Kindheit, Weinheim 1993.
Kneif, Tibor: Rockmusik. Ein Handbuch zum kritischen Verständnis, Reinbek 1982.
Kreuz, Gunter: Musikalische Vorlieben und Aggressionen bei Kindern. Abstract unter http://musicweb.hmt-hannover.de/dgm/german/abstracts01.htm
Langenbach, Christoph: Musikverhalten und Wirklichkeit 16- bis 18jähriger Schüler = Studien zur Musik 7, Frankfurt/M. u.a. 1994.
Liedtke, Rüdiger: Die Vertreibung der Stille, München 1985, überarbeitete Neuausg. ebd. 1996.
Maempel, Hans-Joachim: Der Einfluß der Klanggestaltung auf die Beurteilung von Popmusik. Abstract unter http://musicweb.hmt-hannover.de/dgm/german/abstracts01.htm
Mezger, Werner: Discokultur, Heidelberg 1980.
Salazar Bañol, Fernando: Die okkulte Seite des Rock ²München 1993.
Schmidt-Joos, Siegfried (Hg.): Idole. 9: Weg von meiner Wolke: Alexis Korner, Mick Taylor, Eric Burdon, Roy Davis, Frankfurt/M. u. Berlin 1987.
Strube, Jürgen: Besonderheiten einiger Rockplatten und Gruppen; in: Buddemeier/Strube a.a.O., S. 39 - 47.
Dr. Klaus Miehling
Friedrichring 23
D-79098 Freiburg
Tel. 0761/2924698
Fax 01212-5-259-80-538
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Artikel "Musik und Gewalt - Gewaltmusik von Klaus Miehling, Freiburg"?
Der Artikel untersucht die These, dass bestimmte Arten von Musik, die als "Gewaltmusik" bezeichnet werden, ein Aggressionspotential bergen und möglicherweise zu Gewalt und Kriminalität beitragen können. Er argumentiert, dass Musik, ähnlich wie Gewaltvideos, akustische Gewalt beinhalten kann, die unterschätzt wird.
Was versteht der Autor unter "Gewaltmusik"?
Der Autor definiert "Gewaltmusik" analog zu "Gewaltvideo" und lässt offen, welche Musikgattungen darunter fallen. Es geht ihm darum, Musik zu untersuchen, die durch bestimmte Parameter als potentiell gewaltfördernd angesehen werden kann.
Welche Parameter werden im Artikel als kennzeichnend für aggressive Musik genannt?
Der Artikel nennt folgende Parameter: Disharmonie, extreme Frequenzen, Rhythmen gegen das Metrum, undifferenzierte Rhythmen, viele Geräusche/Schlagzeug, Monotonie, verzerrte Klanggebung, aggressive Singstimme, schnelles Tempo, hohe Lautstärke.
Welche Rolle spielt der Satanismus in Bezug auf Gewaltmusik?
Ein Teil der Gewaltmusik-Szene wird offen vom Satanismus beeinflusst. Dies äußert sich in gewaltverherrlichenden Texten und satanischen Symbolen. Es wird auch die Methode des "Backward-Masking" erwähnt, bei der Botschaften rückwärts unter die Musik gemischt werden, um das Unterbewusstsein zu beeinflussen.
Welche Rolle spielt die Lautstärke bei Gewaltmusik?
Hohe Lautstärke ist ein charakteristisches Merkmal von Gewaltmusik. Dies kann zu Gehörschäden führen und zwingt auch Unbeteiligten die Musik auf.
Welche Studien werden im Artikel zitiert, die einen Zusammenhang zwischen Musik und Aggression belegen?
Der Artikel zitiert Studien von Christoph Langenbach, Gunter Kreuz und Klaus-Ernst Behne. Langenbach fand, dass Jugendliche mit lautem und häufigem Musikkonsum eine höhere Neigung zu aggressivem Verhalten haben. Kreuz stellte fest, dass "gefährdete" Kinder schnelle Popmusik bevorzugen. Behne fand heraus, dass Liebhaber "harter" Rockmusik der Avantgarde relativ aufgeschlossen gegenüberstehen.
Welche Gegenargumente werden im Artikel behandelt?
Der Artikel geht auf Gegenargumente ein, wie z.B. die Unterdrückung bestimmter Musikrichtungen in Diktaturen und die Begeisterung der Nationalsozialisten für Wagner. Er argumentiert, dass diese Fälle nicht direkt mit der These der Gewaltmusik vergleichbar sind.
Welche Maßnahmen schlägt der Autor vor, um dem Problem der Gewaltmusik zu begegnen?
Der Autor schlägt u.a. folgende Maßnahmen vor: Weitere wissenschaftliche Untersuchungen, Verbot von Musikbeschallung an öffentlichen Orten, Walkmanverbot in geschlossenen Räumen, Beschränkung der Lautstärke von Tonwiedergabegeräten, bessere Schalldämmung, juristische Anerkennung von Zwangsbeschallung als Eingriff in das Persönlichkeitsrecht, Kontrolle von Musikaufnahmen vor deren Freigabe und frühzeitige Aufklärung in der Schule.
Was ist das Recht auf akustische Selbstbestimmung?
Das Recht auf akustische Selbstbestimmung ist das Recht, nicht zwangsweise mit Musik beschallt zu werden, die man nicht hören möchte. Der Autor fordert, dieses Recht juristisch zu verankern.
Wie unterscheidet sich der Umgang mit Musik im Vergleich zu anderen Medien wie Filmen und Videospielen?
Der Autor kritisiert, dass Musik im Allgemeinen als harmlos gilt, während Filme und Videospiele auf Jugendgefährdung geprüft werden. Er fordert eine ähnliche Kontrolle und Kennzeichnung für Musikaufnahmen, die gewaltverherrlichend oder -fördernd sind.
- Quote paper
- Dr. Klaus Miehling (Author), 2003, Musik und Gewalt - Gewaltmusik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107956