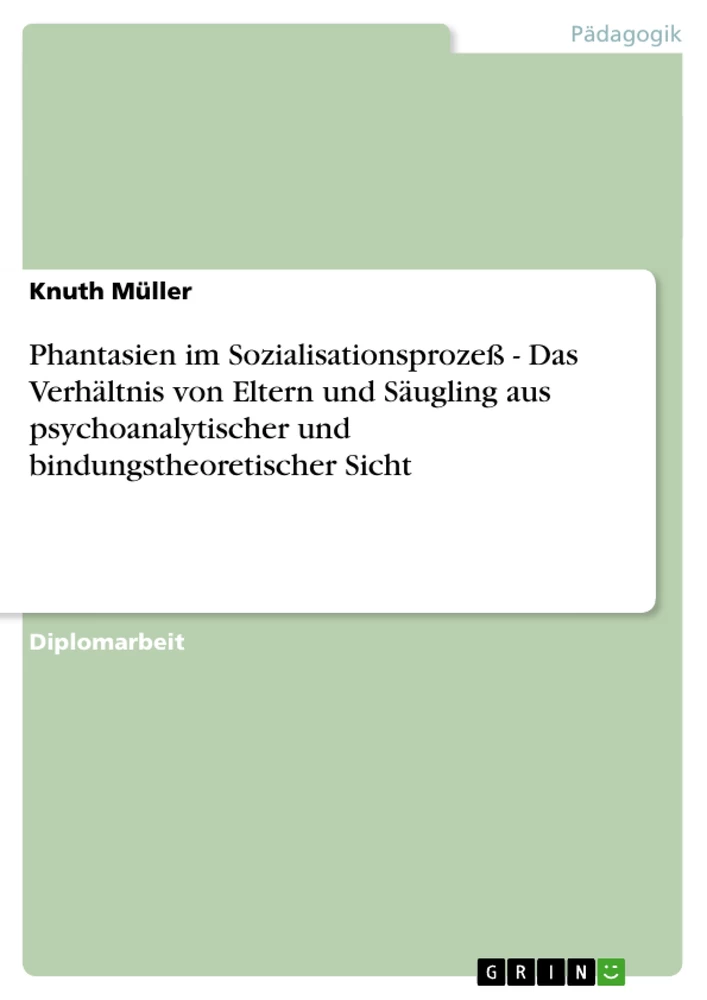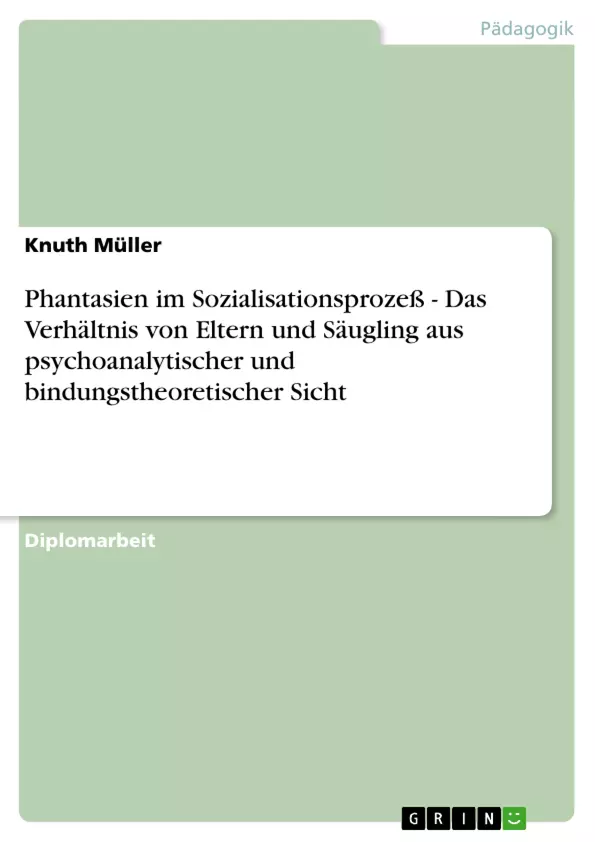Wie kann man sich unbewusste Fantasien vorstellen und welche Auswirkungen haben unbewusste elterliche Fantasien auf das Seelenleben des Kindes? Die vorliegende Arbeit versucht anhand psychoanalytischer und bindungstheoretischer Konzepte der Frage nach der Entwicklung und sozialisatorischen Bedeutung unbewusster elterlicher Fantasien auf Kinder nachzugehen. Das erste Kapitel gibt einen Überblick hinsichtlich „klassischer“ psychoanalytischer Konzepte und beschäftigt sich mit den Grundkonzepten psychoanalytischer Entwicklungspsychologie. Im zweiten Kapitel werden zeitgenössische psychoanalytische Entwicklungskonzepte mit Ergebnissen der modernen Säuglingsforschung in Zusammenhang gebracht. Das psychoanalytische Konzept der „unbewussten Fantasie“ wird im dritten Kapitel theoriegeschichtlich hergeleitet, und es wird das moderne Verständnis von Eltern-Kind-Interaktion und seine sozialisatorischen Implikationen aufgezeigt. Im vierten Kapitel werden drei verschiedene theoretische Ansätze über unbewusste elterliche Fantasien hinsichtlich ihrer sozialisatorischen Bedeutungen für die Eltern-Kind-Interaktion genauer diskutiert (H. E. Richter, Brazelton & Cramer, D. Stern). Während im fünften Kapitel den Grundlagen der Bindungstheorie John Bowlbys nachgegangen, ihre Bedeutung für die Entwicklung unbewusster Fantasien untersucht, sowie Klärungen bezüglich der Frage nach der sozialisatorischen Bedeutung bindungstheoretischer Konzepte für die sozio-emotionale Entwicklung von Kindern aufgeführt werden, schließt die Arbeit mit einem Plädoyer für ein umfassenderes Verständnis und allgemein zugängliches Wissen ob der Wichtigkeit und Bedeutung von unbewussten elterlichen Fantasien auf den sozialisatorischen Prozess von Kindern.
Inhaltsverzeichnis
- I. AUSSAGEN KLASSISCHER PSYCHOANALYSE ZUR THEMATIK.
- 1.1 HISTORISCHER ABRIẞ ZUR ENTSTEHUNG DER PSYCHOANALYSE
- 1.1.1 Biographische Anmerkung zur Person Sigmund FREUDS
- 1.1.2 Die Geburt der Psychoanalyse
- 1.2 GRUNDLEGUNGEN DER PSYCHOANALYSE
- 1.3 DIE FUNKTION DES UNBEWUẞTEN.
- 1.3.1 Die Triebe.
- 1.3.2 Der topographische Ansatz
- 1.3.3 Primär- und Sekundärprozeß.
- 1.3.4 Das Strukturmodell....
- 1.4 ZUSAMMENFASSUNG DER FREUDSCHEN METAPSYCHOLOGIE
- 1.5 DAS PSYCHOANALYTISCHE ENTWICKLUNGSMODELL.
- 1.5.1 Die orale Phase (0-1 1/2 Jahre)
- 1.5.2 Die anal-sadistische Phase (1 1/2-3 Jahre).
- 1.5.3 Die ödipale oder phallische Phase (3-5 Jahre) ..
- 1.5.4 Die Latenzzeit und genitale Phase (ab 5 Jahre) ..
- II. WANDLUNGEN IN DER SICHT VOM SÄUGLING.......
- 2.1 GESCHICHTLICHER ABRIẞ DER ELTERN-KIND-INTERAKTION UND DIE NEUPOSITIONIERUNG
- INFANTILER FÄHIGKEITEN.
- 2.2 ICH-PSYCHOLOGISCHE ANNAHMEN...
- 2.3 OBJEKTBEZIEHUNGSTHEORIEN.
- 2.4 SÄUGLINGSFORSCHUNG UND PSYCHOANALYSE.
- 2.4.1 Die präverbale Kompetenz des Säuglings...
- 2.4.1.1 DANIEL N. STERNS Theorie der Entwicklung des Selbstempfindens...
- 2.4.1.1.1 Das auftauchende Selbst (0-2 Monate).
- 2.4.1.1.2 Die Entstehung des Kern-Selbst (2./3.-7./9. Monat) ..
- 2.4.1.1.3 Das subjektive Selbstempfinden (7./9.-15./18. Monat)
- Exkurs: Entwicklungs- und Interaktionsdimension von Affekten...
- 2.4.1.1.4 Das Empfinden des verbalen Selbst (Beginn mit 15./18. Monat)
- 2.4.2 Kritische Anmerkungen.
- III. DIE ENTWICKLUNG DES PHANTASIEBEGRIFFS IN DER PSYCHOANALYSE IN BEZUG AUF
- DAS VERSTÄNDNIS DER ELTERN-KIND-INTERAKTION.
- 3.1 DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG DES PHANTASIEBEGRIFFS IN DER PSYCHOANALYSE
- 3.1.1 FREUDS Phantasiebegriff...
- 3.1.1.1 Bewußte Phantasien
- 3.1.1.1.1 Bewußte Phantasie und Handeln...
- 3.1.1.2 Unbewußte Phantasien...
- 3.1.1.2.1 Unbewußte Phantasie und Handeln
- 3.1.1.2.2 Übertragung als unbewußte Phantasieäußerung..
- 3.1.1.3 Zusammenfassung..
- 3.1.1.4 Phantasie versus Realität: Eine kritische Anmerkung.…….......
- 3.1.2 Der Phantasiebegriff bei MELANIE KLEIN..
- 3.1.2.1 Kritische Anmerkungen zum KLEINianischen Phantasiekonzept ..
- 3.2 AKTUELLE DISKUSSIONEN UM DAS KONZEPT UNBEWUẞTER PHANTASIEN..
- 3.2.1 Das Phantasiekonzept von MARTIN DORNES.
- 3.2.1.1 Repräsentationen und Phantasien....
- 3.2.2 DANIEL N. STERNS Modell der Säuglingsrepräsentationen als Grundlage eines
- Verständnisses von Phantasietätigkeit...........
- 3.2.2.1 STERNS Repräsentationsbegriff..
- 3.2.2.2 Emergenter Moment.
- 3.2.2.3 Schema-des-Zusammenseins-mit-einem-Anderen
- 3.2.2.3.1 Temporale Gefühlsgestalten bzw. zeitliche Gefühlsform als Grundmodell eines Affekt-
- Schemas
- 3.2.2.3.2 Protonarrative Hüllen..
- 3.2.2.4 STERNS Konzept zur Entstehung von Phantasien .
- 3.2.3 Zusammenfassung von DANIEL N. STERNS Repräsentations-modell.
- 3.2.3.1 Antwort auf einen denkbaren Zwischenruf..
- 3.3 ABSCHLUẞBEMERKUNGEN ÜBER DIE DISKUSSION DES BEGRIFFES UNBEWUẞTE PHANTASIE......91
- IV. DIE SOZIALISATORIS CHE BEDEUTUNG ELTERLICHER PHANTASIEN
- 4.1 ZWEI VORAUSGEHENDE KRITISCHE ANMERKUNGEN
- 4.2 FORMEN ELTERLICHER PHANTASIEN.
- 4.2.1 HORST-EBERHARD RICHTERS frühe Würdigung elterlicher Phantasien.......
- 4.2.1.1 Kleiner geschichtlicher Abriß..
- 4.2.1.2 RICHTERS Verständnis der »Rolle des Kindes«<....
- 4.2.1.2.1 Die Rollen-Skalen...
- 4.2.1.2.2 Die Rolle des Kindes als Substitut für einen Aspekt des eigenen (elter-lichen) Selbst...... 104
- 4.2.1.2.3 Die Rolle des Kindes als Substitut für einen anderen Partner.
- 4.2.1.3 Kritische Anmerkungen...
- 4.2.2 T. BERRY BRAZELTON und BERTRAND G. CRAMER: Imaginäre Interaktion...
- 4.2.2.1 Das Gespenst der Vergangenheit.
- 4.2.2.2 Die Neuinszenierung alter Beziehungsformen...
- 4.2.2.3 Das Kind als Teil seiner Eltern.
- 4.2.2.4 Abschlußbemerkung.
- 4.2.3 DANIEL N. STERNS Theorie der elterlichen Schemata-des-Zusammenseins..
- 4.2.3.1 Der Säugling und die mütterlichen Repräsentationen
- 4.2.3.2 Der Säugling und die väterlichen Repräsentationen...
- 4.2.3.3 STERNS vier klinische Modelle der repräsentationalen Welt.
- 4.2.3.3.1 Das Modell des dominanten Themas
- 4.2.3.3.2 Das Modell der Phaseninadäquatheit oder das ontogenetische Modell
- 4.2.3.3.3 Das Modell der Verzerrungen.
- 4.2.3.3.4 Das Modell der narrativen Kohärenz
- V. BINDUNGSTHEORETIS CHE ASPEKTE ZUM SOZIALISATORISCHEN EINFLUB
- ELTERLICHER PHANTASIEN.
- 5.1 HISTORISCHER ABRIẞ ZUR ENTWICKLUNG DER BINDUNGS-THEORIE.
- 5.2 DEFINITION VON BINDUNG...
- 5.3 ABGRENZUNGEN ZUR PSYCHOANALYSE.
- 5.4 DIE REPRÄSENTATIONALE DIMENSION VON BINDUNG...
- 5.4.1 Innere Arbeitsmodelle von Bindung..
- 5.4.2 Die »Fremde Situation«..
- 5.4.3 Vier Muster der Bindung.
- 5.4.3.1 Sicher gebunden (secure: B).
- 5.4.3.2 Unsicher-vermeidend gebunden (insecure-avoidant: A).
- 5.4.3.3 Unsicher-ambivalent gebunden (insecure-resistant/ambivalent: C)
- 5.4.3.4 Desorganisiert/desorientiert gebunden (disorganized/Disoriented: D)...
- 5.4.3.5 Bindungsmuster der frühen Kindheit: Zusammenfassung und Ergänzung...
- 5.4.4 Die Erfassung elterlicher Bindungsrepräsentationen.
- 5.4.4.1 Das Adult Attachment Interview
- 5.4.4.1.1 Sicher-autonom (free/secure/autonomous: F)
- 5.4.4.1.2 Unsicher-distanziert/Abweisend (dismissing: D) ..
- 5.4.4.1.3 Unsicher-präokkupiert/verstrickt (entangled/enmashed/preoccupied: E).
- 5.4.4.1.4 Unverarbeitetes Trauma (unresolved: U) und »cannot classify« (CC) ..
- 5.4.4.2 Bindungsmuster im Erwachsenenalter: Zusammenfassung.
- 5.5 DER TRANSGENERATIONALE ASPEKT VON BINDUNG....
- 5.5.1 Empirische Studien zur transgenerationalen Übertragung von Bindungsmustern...........159
- Exkurs: Die Erhebung von Bindungsrepräsentationen bei Kindern im Vorschulalter..........\n
- 5.5.1.1 Anmerkungen.....
- 5.5.2 Transgenerationale Übertragungsmechanismen....
- 5.5.2.1 Die mütterliche Feinfühligkeit – maternal attunement/responsiveness.
- 5.5.2.1.1 Die Affektanpassung (»affect attunement<<).
- 5.5.3 Zusammenfassung und kritische Anmerkungen..
- VI. SCHLUBBETRACHTUNG.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht das Verhältnis von Eltern und Säugling aus psychoanalytischer und bindungstheoretischer Sicht und beleuchtet den Einfluss elterlicher Phantasien auf die frühkindliche Entwicklung. Die Arbeit analysiert klassische psychoanalytische Konzepte, insbesondere die Funktion des Unbewussten und die Bedeutung unbewusster Phantasien in der Interaktion zwischen Eltern und Kind. Des Weiteren werden neuere Erkenntnisse aus der Säuglingsforschung und Objekbeziehungstheorien aufgegriffen, um den präverbalen Kompetenzen des Säuglings und der Entstehung von Phantasien im frühen Kindesalter nachzugehen.
- Psychoanalytische Konzepte des Unbewussten und der Phantasie
- Entwicklung des Selbstempfindens im Säuglingsalter
- Die Rolle elterlicher Phantasien in der Sozialisation
- Bindungstheoretische Ansätze zur frühen Entwicklung
- Transgenerationale Übertragung von Bindungsmustern
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet einen historischen Abriss der Psychoanalyse und erörtert die grundlegenden Konzepte von Sigmund Freud, insbesondere die Funktion des Unbewussten, die Triebe und das Strukturmodell der Psyche. Es werden auch die psychoanalytischen Phasen der Entwicklung des Kindes vorgestellt, die von der oralen bis zur genitalen Phase reichen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit Wandlungen in der Sicht vom Säugling und der zunehmenden Bedeutung, die neuere Forschung seiner Fähigkeiten zuschreibt. Es werden die Ansätze der Ich-Psychologie, der Objekbeziehungstheorie sowie der Säuglingsforschung vorgestellt, die den präverbalen Kompetenzen des Säuglings und der Entwicklung seines Selbstempfindens besondere Aufmerksamkeit schenken.
Das dritte Kapitel behandelt die historische Entwicklung des Phantasiebegriffs in der Psychoanalyse und analysiert die Konzepte von Freud und Melanie Klein. Es wird die Debatte um die Funktion und Entstehung unbewusster Phantasien beleuchtet und ein aktueller Ansatz von Daniel N. Stern vorgestellt, der die Rolle von Repräsentationen und Schemata-des-Zusammenseins in der Entwicklung des Säuglings hervorhebt.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der sozialisatorischen Bedeutung elterlicher Phantasien und analysiert verschiedene theoretische Ansätze, die die Rolle elterlicher Repräsentationen und Erwartungen in der Eltern-Kind-Interaktion untersuchen. Es werden Ansätze von Horst-Eberhard Richter, T. Berry Brazelton und Bertrand G. Cramer sowie von Daniel N. Stern vorgestellt, die unterschiedliche Formen elterlicher Phantasien und deren Einfluss auf die Entwicklung des Kindes beleuchten.
Das fünfte Kapitel widmet sich bindungstheoretischen Aspekten des sozialisatorischen Einflusses elterlicher Phantasien. Es werden die Definition von Bindung, die Abgrenzung zur Psychoanalyse sowie die repräsentationale Dimension von Bindung untersucht. Zudem werden verschiedene Bindungsmuster bei Säuglingen und Erwachsenen sowie die transgenerationale Übertragung von Bindungsmustern vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Diplomarbeit sind die Psychoanalyse, Säuglingsforschung, Phantasie, elterliche Repräsentationen, Bindungstheorie, transgenerationale Übertragung und frühkindliche Entwicklung. Die Arbeit greift auf verschiedene theoretische Ansätze zurück, darunter die klassische Psychoanalyse, die Objekbeziehungstheorie, die Säuglingsforschung und die Bindungstheorie. Besondere Aufmerksamkeit wird den Konzepten des Unbewussten, der unbewussten Phantasien, der präverbalen Kompetenz des Säuglings, der elterlichen Schemata-des-Zusammenseins und der transgenerationalen Übertragung von Bindungsmustern gewidmet.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss haben unbewusste elterliche Phantasien auf den Säugling?
Diese Phantasien prägen die Interaktion und können das Kind in bestimmte Rollen drängen, die seine psychische Entwicklung beeinflussen.
Was ist der Unterschied zwischen Psychoanalyse und Bindungstheorie?
Die Psychoanalyse fokussiert auf innere Triebe und Phantasien, während die Bindungstheorie das reale Verhalten und die Sicherheit der Beziehung betont.
Was besagt Daniel Sterns Theorie zum Selbstempfinden?
Stern beschreibt die Entwicklung des Säuglings von einem auftauchenden Selbst hin zu einem verbalen Selbst durch Interaktion mit den Bezugspersonen.
Was sind „innere Arbeitsmodelle“ in der Bindungstheorie?
Es sind mentale Repräsentationen von Beziehungen, die das Kind basierend auf den Erfahrungen mit seinen Eltern entwickelt.
Können Bindungsmuster über Generationen übertragen werden?
Ja, Studien zeigen, dass die Bindungserfahrungen der Eltern (erfasst im Adult Attachment Interview) oft die Bindungssicherheit ihrer Kinder voraussagen.
- Quote paper
- Dipl.-Psych., Dipl.-Päd. Knuth Müller (Author), 1999, Phantasien im Sozialisationsprozeß - Das Verhältnis von Eltern und Säugling aus psychoanalytischer und bindungstheoretischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10800