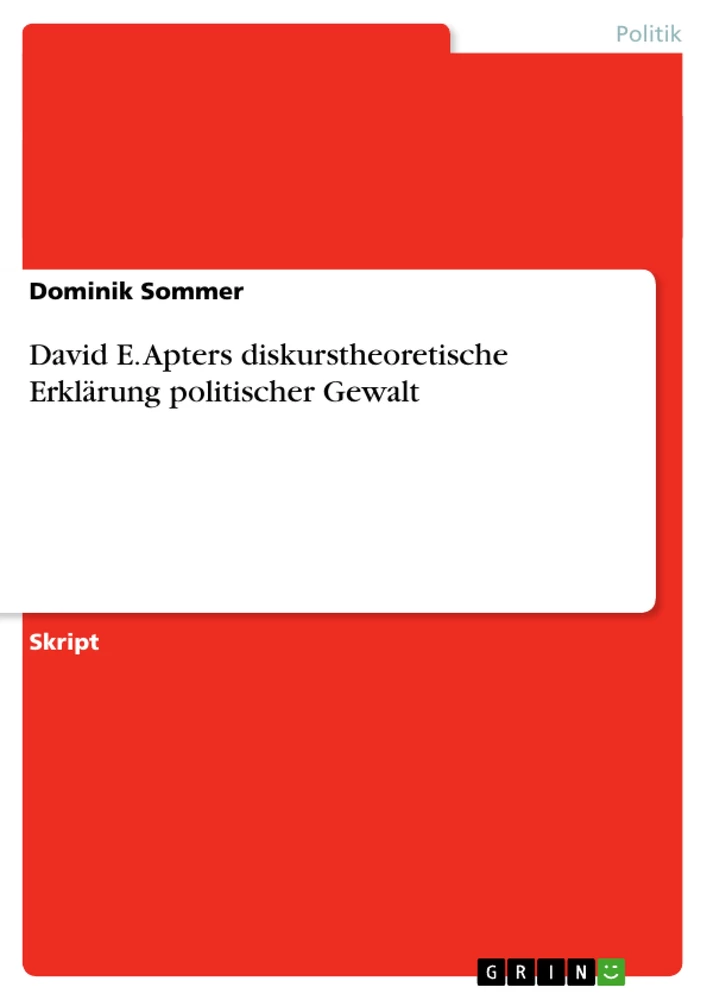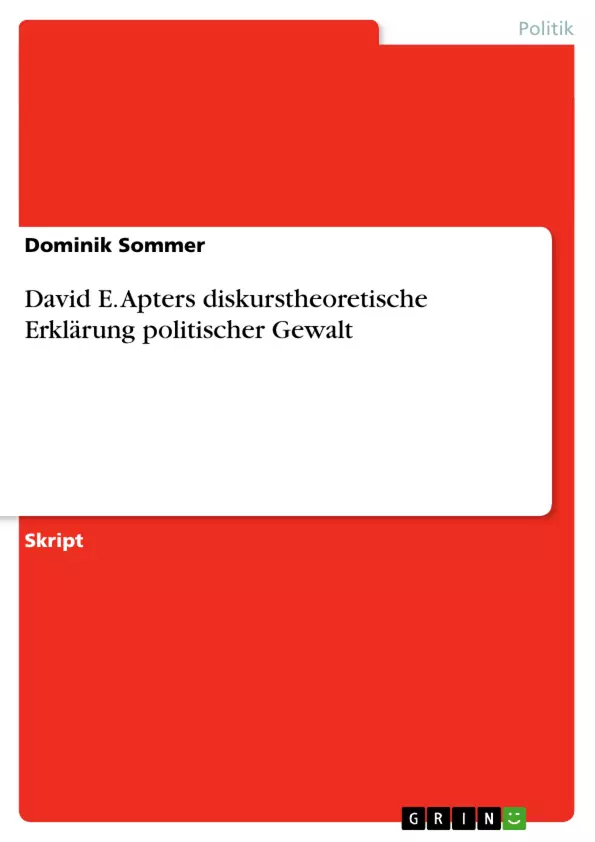David E. Apters diskurstheoretische Erklärung politischer Gewalt
Der nachfolgede Text beinhaltet[1] eine Zusammenfassung von David E. Apters Artikel „Political Violence in Analytical Perspective“[2]. Dieser bietet ein generalisierbares Erklärungsmodell für das Entstehen von politisch motivierter Gewalt auf diskurstheoretischer Ebene. Von der Machtausübung exkludierte gesellschaftliche Gruppen gelangen danach Schritt für Schritt von der antietablierten Mythenbildung durch verbales Geschichtenerzählen über Gegenideologien bis hin zur Gewaltanwendung.
Apters Text ist dabei in sechs Abschnitte gegliedert. Der erste, „Contemplating Violence“, umkreist das Phänomen der politischen Gewalt in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen allgemein beschreibend und macht Andeutungen über Apters diskurstheoretische Marschrichtung. „People do not commit political violence without discourse. They need to talk themselves into it“ (Apter 1997: 2).
Der zweite Teil des Textes, „Analysing Political Violence“ befasst sich mit herkömmlichen theoretischen Ansätzen zur Erklärung politischer Gewalt. Es werden drei Analyseperspektiven, der „diagnostic view“, politische Gewalt als individuelle Pathologie und als soziale Pathologie, unterschieden. Die Diagnostic View-Perspektive begreift Gewalt als rational-intendiertes Handeln jenseits von institutionalisierten und gewaltlosen politischen Mitteln, also die Fortsetzung der Politik mit Gewaltmitteln. Die zweite Perspektive stellt Persönlichkeitsprobleme von Individuen als Erklärung von politischem Gewalthandeln in den Mittelpunkt. Die dritte rekurriert auf soziale Missstände. Politische Gewalt mag hier aus asymmetrischer Machtverteilung und ungleichem Machtzugang, aus Klassenschranken und z.B. aus einer politischen Ökonomie wie dem kapitalistischen Gesellschaftssystem entspringen.
Im dritten Teil des Textes skizziert Apter die Eckpunkte einer diskursiven Erklärung von politischer Gewalt. Diskurs gilt ihm als Grundlage für jeglichen Konflikt. Der Diskurs entwickelt sich aus Geschichten (Mythen) und hierarchisierter Sprache innerhalb einer bestimmten Gruppe (Zelle). Sein Ziel ist die Umdeutung von Werten zur Umsetzung von Interessen. Politische Gewalt dient dabei dort zur Implementierung von Werten, wo marginalisierte gesellschaftliche Gruppen (oder weltgesellschaftlich gesehen Regionen) an der Teilhabe der Macht, die zur Umsetzung ihrer Interessen notwendig ist, exkludiert sind. Apters Überlegungen zur Motivation (i.e. gruppeninterner Legitimation) politischer Gewalt kumulieren in einem modellhaftem Spektrum, an dessen Enden einerseits ‚symbolisches Kapital’ (i.e. Ideologie) und andererseits ökonomisches Kapital (i.e. Prestige, Macht, Wohlstand) als Ziel und Legitimation von Gewalthandeln stehen.
Den Zusammenhang zwischen politischer Gewalt und Diskursbewegungen stellt Apter im vierten Teil seines Textes dar. Er ist im wesentlichen in der Differenz zwischen dem So-sein (Realität) und dem Sein-sollen (Idealität) begründet, durch den politische Gewalt aus der Sicht ihrer Akteure legitimiert und notwendig wird. Die politische Gewalt dient zur Etablierung einer ‚Anti-Historie’ (ebd.: 17), sie ist eine extreme Form des interpretativen Handelns und damit die Fortsetzung eines Diskurses.
In Kapitel fünf werden Beispiele politischer Gewalt am IDM-VEM-Spektrum (Inversionary Discourse Model – Violant-Exchange Model) abgetragen. Nationalsozialismus und neonazistische Bewegungen liegen nahe am IDM-Pol des Spektrums, da sie einen hohen Anteil symbolischen Kapitals besitzen. Ihre Logik legitimiert sich scheinbar wissenschaftlich. Sie rekurrieren auf Rassenunterschiede und ein biologisch-zentriertes Weltverständnis. Neonazismus leugnet Geschichte und speziell den Holocaust. Der doppelte Verlust vom imperialen wilhelminischen Deutschland und Hitler und dem Bedürfnis, zu erobern und Triumphe zu feiern, lässt sie den Wunsch hegen, die aus ihrer biologistischen Sichtweise Schuldigen für den Verlust, z.B. Juden und Zigeuner und aus dem Ausland immigrierte wie Polen, Türken und Iraner auszurotten (ebd.: 19). Der Basquische Nationalismus und die Gewalt in Kolumbien liegen nach Apter hingegen eher am anderen Pol des Spektrums, auf der VEM-Seite, die nach ökonomischem Kapital ausgerichtet ist. Es handelt sich im Kern um Kämpfe um Geld und Macht, im Baskischen Fall als separatistische Bewegung, im Kolumbianischen um die Geldströme aus dem Drogengeschäft.
Im letzten Teil des Textes bindet Apter die oben gewonnenen Erkenntnisse auf die gegenwärtige Situation entwickelter Industrieländer (OECD-Länder) zurück und wagt damit einen Ausblick auf mögliche zukünftige Gewaltformationen in kapitalistisch-postmodernen Gesellschaften. Er geht davon aus, dass der moderne Entwicklungsoptimismus auf dem Versprechen unbegrenzten Wachstums, der Universalisierung des Marktes und weiter ausgedehnten Möglichkeiten sozialen Aufstiegs- und Partizipationschancen an ökonomischen, sozialen und politischen Institutionen basiert. Politische Entwicklung ist nicht ohne wirtschaftliche zu denken. Zwei wesentliche gesellschaftliche Pathologien werden dabei die Ursachen für mögliche gewaltgeladene Konflikte bieten. Einerseits wird die Möglichkeit zur Generierung wirtschaftlichen Wachstums durch „design innovation“ immer weniger Menschen und speziell Funktionseliten vorbehalten sein. Weite Teile der Arbeiterschaft und der Unterschicht allgemein werden marginalisiert werden. Andererseits ist die Mittelschicht bei Verstärkung dieses Symptoms nicht länger in der Lage, diese sozialen Phänomene aufzufangen und wird durch Überbelastung durch ‚growing sozial overhead costs’ (ebd.: 23) überstrapaziert. Die Marginalisierung von Bevölkerungsschichten durch abstrakt denkende und handelnde Funktionseliten führt zur Generierung metaphorischer Begriffe und Geschichten. Hier liegt der Grundstein zu einem neuen Diskurs einer marginalisierten Gruppe, die nicht mehr bereit ist, den Markt als neutralen und objektiven Verteilungsmechanismus anzuerkennen, die jedoch auch vollkommen aus der Perspektivität der herrschenden Funktionseliten herausgetreten, ihren eigenen Mythos pflegt, ihre Geschichten in eine Theorie überführt und am Ende möglicherweise in einem stark ideologisierten und moralisch aufgeladenen inversionary discourse landet.
Ich fand den Text sehr spannend und aufschlussreich. Kernstück des Textes stellt wesentlich die auf S.15 oben zusammengetragene diskurstheoretisch-evolutionäre Überführung von episodenhaften Mythenkonstruktionen hin zu Diskursen mit gesellschaftspolitisch relevanten und letztendlich gewaltfordernden inversionären Diskursinhalten. Der Mythos wird zur Theorie, die Magie zur Logik und die Erzählung zum Text (als Beispiele). Der Urveränderungsgrund aller Dinge liegt diskurstheoretisch betrachtet somit im Gebrauch eines Wortes und dessen Verhältnis zu seinem Inhalt. Auch politische Gewalt kann erst, nachdem sie sich verbal-sprachlich konstituiert hat, überhaupt in Erscheinung treten.
Etwas unklar bleibt die letztendliche Verbindung von sprachlich-diskursiven Verhalten zu physischer Gewalt. Aber sie ist angedeutet: Einerseits ist keine Gewaltanwendung (politisch) denkbar ohne einen vorher sprachlich konstituierten Aggressionsaufbau. Andererseits geht Apter von einem Politik- und Sprachverständnis aus, das von vornherein und auf jeder, wenn auch zwar physisch gewaltfreien, Ebene von Gewalt und Herrschaft durchsetzt ist. Sprache dient so z.B. als Herrschaftsinstrument, das durchaus Gewalt anwendet. Dann jedoch, wenn der Leidensdruck für bestimmte Gruppen zu groß wird und sie durch Marginalisierung auf politisch institutionalisierter Ebene keine Resonanz mehr finden, greifen sie auf politische Gewalt zurück. Apter benutzt hier, ergänzend zu seinem diskurstheoretischen Erklärungsansatz, das Modell sozialer Pathologien, um zu den Ursachen, die erst zu einer diskursiven Formierung führen, vorzudringen.
Literatur
Aper, David E. 1997: Political Violence in Analytical Perspective, in ders. (Hg.): The Legitimization of Violence, New York, 1-32
[...]
[1] David E. Apter lehrt an der Yale University. Wichtige Veröffentlichungen (neben der hier zitierten zu politischer Gewalt): The Politics of Modernisation; Choice and the Politics of Allocation; Against the State; Revolutionary Discourse in Mao`s Republic.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von David E. Apters "diskurstheoretische Erklärung politischer Gewalt"?
Der Text fasst David E. Apters Artikel über politische Gewalt aus einer diskurstheoretischen Perspektive zusammen. Apter argumentiert, dass politische Gewalt durch die schrittweise Entwicklung von Diskursen entsteht, angefangen bei Mythenbildung und Geschichtenerzählen bis hin zu Gegenideologien, die schließlich zur Gewaltanwendung führen.
Wie gliedert sich Apters Artikel?
Der Artikel ist in sechs Abschnitte gegliedert: "Contemplating Violence", "Analysing Political Violence", die Skizze einer diskursiven Erklärung politischer Gewalt, die Darstellung des Zusammenhangs zwischen politischer Gewalt und Diskursbewegungen, Beispiele politischer Gewalt am IDM-VEM-Spektrum (Inversionary Discourse Model – Violant-Exchange Model), und die Rückbindung der gewonnenen Erkenntnisse auf die gegenwärtige Situation entwickelter Industrieländer.
Welche herkömmlichen Erklärungsansätze für politische Gewalt werden in Apters Artikel diskutiert?
Apter unterscheidet drei Analyseperspektiven: die "diagnostic view" (Gewalt als rational-intendiertes Handeln), politische Gewalt als individuelle Pathologie und politische Gewalt als soziale Pathologie (entstanden aus asymmetrischer Machtverteilung, Klassenschranken usw.).
Was ist Apters diskursive Erklärung für politische Gewalt?
Apter sieht Diskurs als Grundlage für jeden Konflikt. Der Diskurs entwickelt sich aus Geschichten (Mythen) und hierarchisierter Sprache innerhalb einer Gruppe. Politischer Gewalt dient der Implementierung von Werten, wo marginalisierte Gruppen an der Teilhabe der Macht, die zur Umsetzung ihrer Interessen notwendig ist, exkludiert sind.
Was ist das IDM-VEM-Spektrum und wie wird es in Apters Analyse verwendet?
Das IDM-VEM-Spektrum (Inversionary Discourse Model – Violant-Exchange Model) dient zur Einordnung verschiedener Formen politischer Gewalt. Nationalsozialismus und neonazistische Bewegungen liegen nahe am IDM-Pol (symbolisches Kapital), während baskischer Nationalismus und Gewalt in Kolumbien eher am VEM-Pol (ökonomisches Kapital) verortet sind.
Welche potenziellen zukünftigen Gewaltformationen sieht Apter in kapitalistisch-postmodernen Gesellschaften?
Apter prognostiziert, dass die Marginalisierung von Bevölkerungsschichten durch Funktionseliten und die Überbelastung der Mittelschicht zu gewaltgeladenen Konflikten führen könnten. Dies könnte zur Generierung neuer Diskurse marginalisierter Gruppen führen, die den Markt als neutralen Verteilungsmechanismus nicht mehr anerkennen.
Was ist die Bedeutung von Mythen und Geschichten in Apters diskurstheoretischem Ansatz?
Mythen und Geschichten bilden die Grundlage für die Entwicklung von Diskursen. Sie werden zur Theorie, Magie zur Logik und Erzählungen zum Text, wodurch die Basis für politische Gewalt gelegt wird, nachdem sie sich verbal-sprachlich konstituiert hat.
Wie erklärt Apter den Übergang von sprachlichem Diskurs zu physischer Gewalt?
Apter deutet an, dass keine politische Gewalt ohne vorherigen sprachlichen Aggressionsaufbau denkbar ist. Er geht von einem Politik- und Sprachverständnis aus, das von Gewalt und Herrschaft durchsetzt ist. Wenn der Leidensdruck für bestimmte Gruppen zu groß wird und sie auf politisch institutionalisierter Ebene keine Resonanz mehr finden, greifen sie auf politische Gewalt zurück.
- Citar trabajo
- Dominik Sommer (Autor), 2003, David E. Apters diskurstheoretische Erklärung politischer Gewalt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108105