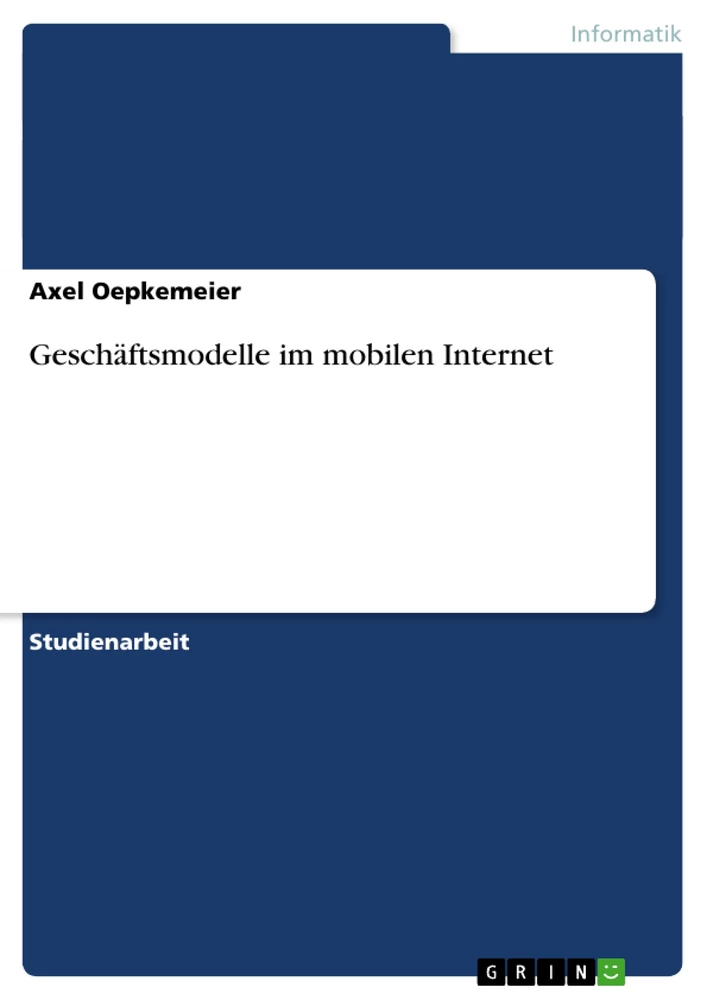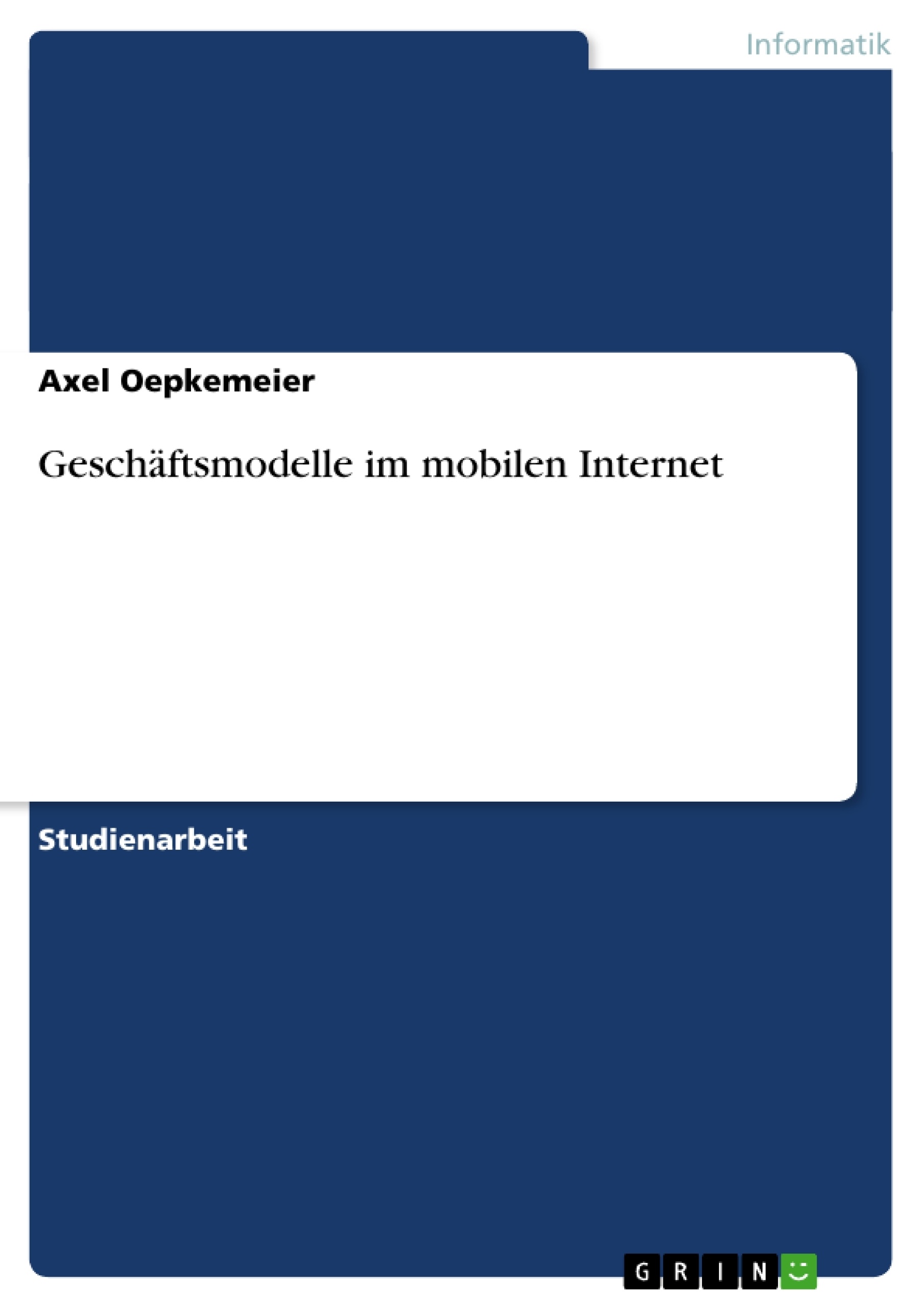Inhaltsverzeichnis
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Definitionen im Marktfeld des mobilen Internet
3. Evolution zellularer Mobilfunknetze
4. Geschäftsmodelle im mobilen Internet
4.1. Begriff des Geschäftsmodells
4.2. Kundennutzen und Wettbewerb über mobile Dienste
4.3. Architektur der Wertschöpfung
4.3.1 Darstellungsarten der Wertschöpfung
4.3.2 Stufen und Beteiligte der Wertschöpfung
4.3.2.1 Netzbetreiber
4.3.2.2 Contentnahe Beteiligte im 3G-Wertschöpfungssystem
4.4. Erlösmodelle
4.4.1. Evolution der Erlösquellen / Revenue Mix
4.4.2 Umsatzbeteiligungen / Revenue Sharing
4.4.3 Pricing und Billing
5. Vorläufer von UMTS
5.1. i-mode in Deutschland
5.2. Erste 3G-Dienste in Japan
6. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Migrationspfad von 2G- zu 3G-Mobilfunknetzen
Abbildung 2: Institutionelle Wertschöpfungskette des mobilen Internet
Abbildung 3: Erweiterte Mobilfunk-Wertschöpfungskette in funktionaler und institutioneller Sicht_
Abbildung 4: Wertschöpfungsnetzwerk des mobilen Internet
Abbildung 5: Beurteilung der Mobilfunknetzbetreiber durch Kooperationspartner
Abbildung 6: Kritische Partnerschaftsdimensionen für Mobilfunknetzbetreiber
Abbildung 7: Erlösquellen mobiler Datendienste
Abbildung 8: Einnahmeströme im mobilen Internet
Abbildung 9: Das i-mode-Geschäftsmodell / Erlösmodell
Abbildung 10: Zusammenhang zwischen Höhe der Umsatzbeteiligung für Content-Anbieter und Gesamtmarktvolumen
Tabelle 1: Zahl der 3G-Mobilfunkkunden in Japan (nach Netzsystem)
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
In der vorliegenden Arbeit wird das Thema „Geschäftsmodelle im mobilen Internet“ behandelt. Nach einer kurzen Beschreibung der technischen Grundlagen sowie der zu erwartenden weiteren Entwicklung der verschiedenen Netzwerktechnologien von der zweiten zur dritten Mobilfunkgeneration, werden die Erfolgsfaktoren von zukünftigen mobilen Datendiensten untersucht. Das Hauptaugenmerk liegt auf den Bestandteilen und Implikationen des Geschäftsmodells. Dabei werden die mobilen Datendienste und deren Inhalte auf einem bewusst hohen Abstraktionsniveau behandelt, um nicht auf de- ren Unwägbarkeiten eingehen zu müssen. In der Mobilfunkbranche wird derzeit ver- sucht, durch zahlreiche Marktforschungsstudien die Konsumentenpräferenzen sowie insbesondere deren Zahlungsbereitschaften bzgl. der zu erwartenden Anwendungen zu eruieren, jedoch solange ein Großteil der Dienste nicht tatsächlich verfügbar ist, kann es keine Bestätigungen der bisherigen Ergebnisse geben.
Zur Architektur der Wertschöpfung, als zentraler Bestandteil eines Geschäftsmodells, werden verschiedene Darstellungsarten vorgestellt. Anschließend werden ausgewählte Beteiligte der Wertschöpfung untersucht. Insbesondere den Mobilfunknetzbetreibern, mit ihrer zentralen Rolle innerhalb der Wertschöpfung, den Content-Anbietern als auch dem Verhältnis dieser Wertschöpfungsstufen untereinander wird besonderes Augen- merk geschenkt. Bzgl des Erlösmodells werden die Quellen der zu erwartenden Ein- nahmeströme im mobilen Internet und deren Aufteilung unter den Beteiligten der Wert- schöpfung diskutiert. Eine Darstellung der ersten Erfahrungen mit zukünftigen mobilen Datendiensten soll diese Arbeit abrunden. An dieser Stelle fließen aktuelle Entwicklun- gen der letzten 8 Monate ein – insbesondere der Überraschungserfolg des japanischen Netzbetreibers KDDI und dessen 3G-Dienste.
2. Definitionen im Marktfeld des mobilen Internet
Die Begriffe wireless commerce, M-Commerce, wireless E-Commerce und viele andere mehr werden in Artikeln, auf Kongressen und in Studien in höchst unterschiedlicher Weise verwendet[1]. Eine sehr häufig zitierte Definition von M-Commerce stammt von Durlacher Research: „ Mobile Commerce is any transaction with a monetary value that is conducted via a mobile telecommunications network.”[2] Mit dieser Definition wird die sehr nahe Verwandtschaft von M-Commerce, als Kurzform von Mobile Commerce, zu E-Commerce (Electronic Commerce) betont. Inzwischen hat jedoch Durlacher von der Verwendung dieses Begriffes wieder Abstand genommen, da dieser in zu unterschiedli- cher Form Verwendung findet[3]. Auch Zobel (2001) versucht den Begriff M-Commerce zu vermeiden, weil dieser von der Begrifflichkeit her zu stark auf die Durchführung von Transaktionen, den Kauf von Waren und ähnliches hindeutet. Wird M-Commerce nur als mobiles Online-Shopping (häufig auch deshalb explizit als mShopping bezeichnet[4] ) verstanden, so würden somit bsw. die mobile Internetnutzung, Videoübertragungen, interaktive Spiele, Nachrichtendienste, Multi-Media-Messaging (MMS) und Location- Based Services (LBS) ausgeblendet.
Eine weiter gefasste Definition von M-Commerce geht auf Ovum Ltd. zurück. Diese soll auch im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit Verwendung finden.
„ M-Commerce wird als entgeltliche Durchführung von Transaktionen bezeichnet, wel- che den Zugang zu Informationen, den Bezug von Waren oder die Inanspruchnahme von Diensten beinhalten, die mittels eines mobilen Telekommunikationsnetzwerks über ein Handy oder andere mobile Endgeräte (PDA, Lap-/Palmtop) getätigt werden. “[5] Inzwischen wird häufig der übergeordnete Begriff „Mobile Business“ bzw. M-Business verwendet. Zobel (2001) versteht unter Mobile Business: „ alle auf mobilen Geräten ausgetauschten Dienstleistungen, Waren sowie Transaktionen. “ Drei Merkmale von M-
Commerce sollen hier hervorgehoben werden: Erstens befinden sich die Endgeräte stets bei ihren Besitzern und sorgen für ständige Erreichbarkeit bzw. Verfügbarkeit. Zweitens steht die Identität des Nutzers durch Telefonnummer und die PIN-Eingabe in der Regel fest. Drittens wissen die Netzbetreiber stets, wo sich ihr Kunde befindet. Es ist daher davon auszugehen, dass die Verwendung eines mobilen Endgerätes für E-Commerce erhebliche Rückwirkungen auf Art, Umfang und Gegenstand der Transaktionen haben wird[6]. Der Begriff des „mobilen Internet“ lässt sich insofern von der Definition von M-
Commerce ableiten, als das die Durchführung von M-Commerce – insbesondere seit der als 2,5G bezeichneten Generation von Mobilfunknetzen – d.h. die Transaktionen auf den mobilen Endgeräten orts- und zeitunabhängig über das Internet abgewickelt wer- den. Das mobile Internet erweitert somit die Nutzung von Services in den Dimensionen Zeit und Raum.[7]
3. Evolution zellularer Mobilfunknetze
Während die zellularen digitalen Mobilfunknetztechnologien der zweiten Generation (in Europa insbesondere GSM und DCS) durch ihre verbindungsorientierte Arbeitsweise in erster Linie für Sprachübertragungen und SMS-Versand geeignet sind, sollen breitban- digere Verfahren in naher Zukunft schnelle Datenübertragungen und echte multimediale Anwendungen ermöglichen. Auf dem Weg von der zweiten zur dritten Mobilfunkgene- ration (bsw. UMTS) sind jedoch noch Systeme der Zwischengeneration zu beachten, welche typischerweise als 2,5G-Systeme bezeichnet werden. Auf die 2,5G-Systeme HSDSC und EDGE soll nur verkürzt eingegangen werden, da diese als nur vorüberge- hend in Erscheinung tretende Technologien kaum eine Bedeutung erlangen konnten.
HSDSC bündelt mehrere GSM-Kanäle – ist somit leitungsvermittelt – und stellt gegen- über GSM mit 9,6 kbit/s eine Bandbreite von 57,6 kbit/s und mehr zur Verfügung[8]. Bei EDGE handelt es sich hingegen um ein paketorientiertes Verfahren, welches jedoch in Deutschland kurz vor Einführung von UMTS keine Chance auf Implementierung mehr hatte.
GPRS ist die einzig bedeutsame Übergangstechnologie zur dritten Mobilfunkgeneration (als 3G – third generation – bezeichnet). Die Übertragung erfolgt paketvermittelt und ist daher gut für TCP/IP-Anwendungen geeignet. Dies ist der eigentliche große technologi- sche Entwicklungssprung schon vor der Einführung von 3G-Netzwerken. Insofern wer- den die Netzbetreiber durch GPRS automatisch zu Internet Service Providern (ISP).
GPRS bietet bei der Datenübertragung eine höhere Ressourceneffizienz, da Kanäle nicht exklusiv für das Senden und Empfangen eines einzelnen Teilnehmers einer Zelle reserviert werden müssen. Das Endgerät ist ständig eingebucht – ein bedeutsamer Vor- teil bei der Realisierung sog. Push-Dienste, welche das „always on“ des Endgerätes voraussetzen um Daten, ohne einen vom Nutzer initiierten Abruf, übermitteln zu kön- nen. Abrechnungstechnisch unterscheidet sich GPRS grundlegend von GSM, da hier nur die tatsächlich übertragenen Daten herangezogen werden (IP-Billing). Als Nachteil von GPRS ist die mangelnde Echtzeitfähigkeit zu erwähnen. Für zeitkritische Anwen- dungen wie Sprachübertragung oder Videokonferenzen eignet sich GPRS daher wenig. Der Begriff UMTS wurde von dem europäischen Standardisierungsgremium ETSI fest- gelegt. Die ITU („International Telecommunications Union“), ein weiteres Normungs- gremium, nutzt für Mobilfunktechnologien der dritten Generation die Bezeichnung IMT-2000; in den USA wurden ähnliche Systeme unter dem Namen CDMA 2000 ent- wickelt. Mitte der neunziger Jahre wurde durch die ITU und die IMT-2000- Spezifikationen die ersten Definitionen zukünftiger universeller Mobilfunkkommunika- tion getroffen. Es wurde festgelegt, welche Anforderungen ein Mobilfunksystem zu
erfüllen hat, um der kommenden Gruppe von Mobilfunksystemen der dritten Generation anzugehören. Der UMTS-Standard, der industrieseitig vom UMTS-Forum (einer Ko- operation von Mobilfunkkonzernen) geprägt wurde, erfüllt diese Rahmenbedingungen. IMT-2000 bildet den übergeordneten weltweiten Standard für 3G-Systeme, zu denen auch UMTS gehört, und soll später alle bisherigen Systeme in einem Universalstandard vereinigen. Als weltweite Entwicklungsinstanz für IMT-2000 wurde die 3GPP (3rd Ge- neration Partnership Project) definiert. UMTS besteht in technischer Hinsicht aus drei funktionalen Einheiten: Dem User Equipment (UE), der UMTS-Luftschnittstelle (UTRAN) und dem Core Network. Auf die UMTS-Systemarchitektur soll hier jedoch nicht weiter eingegangen werden. Bzgl. der Luftschnittstelle haben sich innerhalb der IMT-2000-Norm zwei bedeutende Derivate herausgebildet. UMTS benutzt für die Luft- schnittstelle eine Kombination aus W-CDMA (einer auf CDMA basierenden Entwick- lung von Qualcomm) und TDMA von Ericsson[9]. Der andere Standard CDMA-2000 nutzt ausschließlich das Qualcomm-Verfahren.
Abbildung 1: Migrationspfad von 2G- zu 3G-Mobilfunknetzen[10]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die häufig geäußerte Behauptung, 3G-Netze wären verspätet und erfüllten nicht die an sie gestellten Erwartungen, ist nach Brodsky (2002) auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Netzwerkspezifikation CDMA 2000 1x als Netz der Generation 2,5 bezeichnet wird[11]. ITU definiert 3G-Netze mit einer erforderlichen Bandbreite von 144 kbps sowie 2Mbps bei Indoor-Betrieb bzw. in der sog. Pico-Zelle[12]. Die meisten der inzwischen in Betrieb befindlichen CDMA 2000 1x-Netze erfüllen die 2Mbps-Anforderung nicht[13].
Jedoch wird diese Bandbreite von 2Mbps von den als 3G bezeichneten wideband- CDMA-Netzen (W-CDMA) ebenfalls nicht erfüllt. Eine „common sense“-Definition für 3G-Netze lässt diese auf dem technologischen Paradigma der nächsten Generation (CDMA) basieren, fordert höhere Bandbreiten als bei Netzen der 2. Generation und verlangt einen realistischen Upgrade-Pfad die ITU-Bedingungen zu erreichen oder zu übertreffen. Damit würden alle CDMA 2000- und W-CDMA-Netze zur 3. Mobilfunk- generation gehören.
4. Geschäftsmodelle im mobilen Internet
In der Literatur besteht keine Einigkeit darüber, was ein Geschäftsmodell ist und woraus es besteht bzw. bestehen sollte. Definitionen des Begriffes fallen sehr uneinheitlich aus. Auch werden Geschäftsmodell (business model) und Erlösmodel (revenue model) häu- fig synonym verwendet.
4.1. Begriff des Geschäftsmodells
Ein Geschäftsmodell kann allgemein als „eine modellhafte Beschreibung eines Geschäf- tes“ definiert werden. Nach Stähler (2001) besteht ein Geschäftsmodell „aus drei Hauptkomponenten: Value Proposition, Architektur der Wertschöpfung und dem Er- tragsmodell.“ Die Value Proposition beschreibt den vom Unternehmen gestifteten Nut- zen für Kunden und Partnerunternehmen[14]. Die Architektur der Wertschöpfung ordnet die wirtschaftlichen Akteure mit ihren Rollen auf den verschiedenen Stufen der Wert- schöpfungskette ein, entlang derer der Kundennutzen generiert wird. Im Ertragsmodell, dem dritten Bestandteil, werden die Einnahmen und deren Quellen identifiziert.[15]
4.2. Kundennutzen und Wettbewerb über mobile Dienste
Operationelle Effektivität auf Grund von besserer Technologie wird insbesondere für die Mobilfunknetzbetreiber vermutlich kaum Möglichkeiten bieten, einen Wettbe- werbsvorteil zu erreichen. Vielmehr wird der gebotene Kundennutzen durch mobile
Dienste einen weitaus bedeutsameren Beitrag zur Erlangung eines Wettbewerbsvorteils darstellen[16]. Der Kundennutzen ist vermutlich immer der wichtigste Erfolgsfaktor eines Geschäftsmodells. In der Forschung zum strategischen Management hat sich eine durch Porter (1992) vorgenommene Einteilung in zwei Grundtypen von Wettbewerbsvorteilen durchgesetzt. Danach sind die Vorteile der niedrigen Kosten und die der Differenzie- rung zu unterscheiden[17]. Stärken und Schwächen von Unternehmen hängen letztlich immer mit einem dieser beiden grundlegenden Wettbewerbsvorteile zusammen. Abhän- gig vom Tätigkeitsbereich des Unternehmens leitet Porter daraus drei Strategietypen ab, die jeweils einen grundsätzlich anderen Weg zur Vorteilserlangung darstellen.
- Bei der Strategie der umfassenden Kostenführerschaft werden relative Kosten- vorteile bei der Produktion im Wettbewerb mit homogenen Gütern gegenüber allen Konkurrenten angestrebt. Daraus ergeben sich leicht unterdurchschnittli- chen Preise, evtl. auch eine Preisführerschaft.
- Verfolgt ein Unternehmen dagegen die Strategie der Differenzierung, so ver- sucht es seine Produkte oder Dienste mit signifikanten Merkmalen zu versehen, die von den Nachfragern geschätzt werden. Je mehr Stufen der mobilen Wert- schöpfungskette von einzelnen Unternehmen abgedeckt werden, desto mehr Möglichkeiten bieten sich, speziellen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Mobilfunknetzbetreiber bedienen sich dazu vor allem strategischer Allianzen.[18]
- Bei der Konzentration auf Schwerpunkte, als dritter Strategietyp, handelt es sich um die Anwendung des ersten oder zweiten Strategietyps auf nur ein Segment innerhalb der Branche, bsw. auf nur eine abgrenzbare Käufergruppe, oder eine bestimmte Produktkategorie. Es wird versucht, mittels Kostenführerschaft oder Differenzierung in diesem Zielsegment einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen,
ohne dass das Unternehmen über einen allgemeinen Wettbewerbsvorteil inner- halb seiner Branche verfügt.[19]
Nach Büllingen / Wörter (2000) kommt der Strategie der Kostenführerschaft im Hin- blick auf die langfristig zu erwartenden sinkenden Erlöse für Übertragungsleistungen eine eher geringe Bedeutung zu. Auch die Strategie der Konzentration auf Schwerpunk- te scheint kein sehr erfolgversprechender Weg zu sein, da der Nachfragetrend sowohl bei Privat- als auch bei Geschäftskunden sich eindeutig in Richtung des "One-Stop- Shopping" bewegt, bei dem die Nutzer alle Dienstleistungen aus einer Hand beziehen möchten. Die Wettbewerbsstrategien der Mobilfunkanbieter werden sich daher künftig stärker auf Differenzierungsstrategien ausrichten, zumal die Erweiterung der Mobil- funk-Wertschöpfungskette eine breite Fülle von Möglichkeiten eröffnet, sich gegenüber den Wettbewerbern abzugrenzen. Die Differenzierungsstrategie wird für Netzbetreiber im Marktfeld des mobilen Internet häufig als die zu präferierende Strategie dargestellt, und zwar deshalb, weil die beiden anderen Strategietypen zur Erlangung von Wettbe- werbsvorteilen für Mobilfunknetzbetreiber vermutlich nicht praktikabel sein werden[20].
[...]
[1] Vgl. Zobel (2001), S. 2-4
[2] Diese Definition entstammt dem Mobile Commerce Report von Durlacher Research vom November 1999
[3] Vgl. Durlacher (2001), S. 9: “On the other hand, we use the more classical, operator-oriented definition of data transmission and content & services since m-commerce has been used with varying definitions, so that currently there does not seem to be a common clear understanding of the concept in the market.”
[4] Vgl. Schreiber (2002), S. 155
[5] Vgl. Ovum Ltd.: Mobile E-Commerce, Market Strategies, 2000
[6] Vgl. Büllingen / Wörter (2000), S.3
[7] Bzgl. der Ausführungen in diesem Kapitel vergleiche: Schreiber (2001), Kap. 3.2, 3.3 und Kap. 4, insbesondere die Seiten 49-57, 80-82 und 105-106.
[8] HSCSD wird in Deutschland nur von D2 Vodafone und E-Plus angeboten.
[9] Diese Kombination musste aufgrund eines Patentstreits zwischen den beiden Herstellerunternehmen gewählt werden.
[10] Siehe ITU (2002), S. 8
[11] Die Tatsache, dass das W-CDMA-Netz von NTT DoCoMo immer als das weltweit erste 3G-Netz bezeichnet und alle, bis zu einem Jahr früher, installierten CDMA 2000-Netze fälschlicherweise nur als 2,5G tituliert (mislabeled) werden, wird von Brodsky (2002) auf das Stillschweigen der Netzinfrastrukturlieferanten zurückgeführt um Regierungsbeamte und europäische Geschäftspart- ner der GSM-Industrie und damit W-CDMA-Kunden nicht zu verärgern.
[12] Die Tatsache, dass die versprochene Bandbreite von 2 MBit/s nicht jedem einzelnen User zur Verfügung steht sondern eine „shared ressource“ ist, d.h. unter allen eingebuchten Nutzern einer Zelle geteilt wird, hat sich wohl inzwischen herumgesprochen. Zudem wird dieser theoretische Maximalwert nur bei stationären Geräten, im Endausbau der Netze und ohne Datenstau erreicht werden.
[13] Das einzige Mobilfunknetzwerk welches 2 Mbps liefert ist das der koreanischen SK Telecom und ist eine erweiterte Form des CDMA 2000-Standard mit der Erweiterung „1x EV-DO“
[14] Andere Gliederungen des Begriffs führen an dieser Stelle den Wertbeitrag bzw. die Unique Selling Proposition (USP), der einem Nutzer aus einem bestimmten Angebot entsteht, an. Vgl. Zobel (2001), S. 200
[15] Vgl. Stähler (2001), S. 41ff.
[16] Vgl. Feldmann (2002), S. 2
[17] Vgl. Porter (1992), S. 31-38
[18] Vgl. Büllingen / Wörter (2000), S. 42
[19] Während Porter davon ausgeht, dass ein Unternehmen entweder die Kostenführerschafts- oder die Differenzierungsstrategie, nicht jedoch beide gleichzeitig verfolgen kann, haben empirische Überprüfungen gezeigt, dass Unternehmen auch mit sog. "hybriden Wettbewerbsstrategien" erfolgreich sein können. Bei letzteren werden sowohl Kosten- als auch Differenzierungsvorteile angestrebt. Vgl. Büllingen / Wörter (2000), S. 43
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit über "Geschäftsmodelle im mobilen Internet"?
Diese Arbeit behandelt Geschäftsmodelle im mobilen Internet. Sie untersucht die Erfolgsfaktoren zukünftiger mobiler Datendienste, wobei der Fokus auf den Bestandteilen und Implikationen des Geschäftsmodells liegt. Dabei werden die mobilen Datendienste und deren Inhalte auf einem hohen Abstraktionsniveau betrachtet.
Welche Definitionen werden im Marktfeld des mobilen Internet verwendet?
Es werden verschiedene Begriffe wie wireless commerce, M-Commerce und wireless E-Commerce diskutiert. Die Arbeit verwendet eine erweiterte Definition von M-Commerce von Ovum Ltd., die sich auf die entgeltliche Durchführung von Transaktionen bezieht, welche den Zugang zu Informationen, den Bezug von Waren oder die Inanspruchnahme von Diensten beinhalten, die mittels eines mobilen Telekommunikationsnetzwerks getätigt werden.
Wie hat sich die zellulare Mobilfunknetztechnologie entwickelt?
Die Arbeit beschreibt die Evolution von 2G- zu 3G-Mobilfunknetzen, einschließlich der Übergangstechnologien wie GPRS. UMTS als Mobilfunktechnologie der dritten Generation wird ebenfalls thematisiert.
Was sind die Hauptbestandteile eines Geschäftsmodells nach Stähler (2001)?
Ein Geschäftsmodell besteht aus drei Hauptkomponenten: Value Proposition (Nutzen für Kunden und Partnerunternehmen), Architektur der Wertschöpfung (wirtschaftliche Akteure und ihre Rollen) und Ertragsmodell (Einnahmen und deren Quellen).
Welche Wettbewerbsstrategien werden für Mobilfunknetzbetreiber im mobilen Internet diskutiert?
Es werden die Strategien der Kostenführerschaft, Differenzierung und Konzentration auf Schwerpunkte nach Porter (1992) erläutert. Die Differenzierungsstrategie wird als die zu präferierende Strategie für Netzbetreiber im mobilen Internet dargestellt.
Was sind Value Proposition, Architektur der Wertschöpfung und Erlösmodell?
Die Value Proposition beschreibt den Nutzen, den ein Unternehmen seinen Kunden bietet. Die Architektur der Wertschöpfung ordnet die Akteure und ihre Rollen in der Wertschöpfungskette. Das Erlösmodell identifiziert die Einnahmequellen und deren Verteilung.
Was ist der Unterschied zwischen UMTS und IMT-2000?
IMT-2000 ist der übergeordnete weltweite Standard für 3G-Systeme, zu denen auch UMTS gehört. UMTS ist ein spezifischer Standard, der von dem europäischen Standardisierungsgremium ETSI festgelegt wurde und die Rahmenbedingungen von IMT-2000 erfüllt.
Welche Bedeutung hat GPRS für die Evolution der Mobilfunknetze?
GPRS ist die bedeutsamste Übergangstechnologie zur dritten Mobilfunkgeneration (3G). Die paketvermittelte Übertragung ermöglicht TCP/IP-Anwendungen und macht Netzbetreiber zu Internet Service Providern (ISP).
Was sind die Unterschiede zwischen 2G und 3G Mobilfunknetzen?
2G Netze (wie GSM) sind primär für Sprachübertragungen und SMS konzipiert. 3G Netze (wie UMTS) ermöglichen schnellere Datenübertragungen und Multimedia-Anwendungen. 2.5G Netze, wie GPRS, stellen eine Übergangstechnologie dar, die bereits paketvermittelte Datenübertragung ermöglicht.
Welche Rolle spielen Mobilfunknetzbetreiber in der Wertschöpfungskette?
Mobilfunknetzbetreiber spielen eine zentrale Rolle in der Wertschöpfungskette des mobilen Internets. Sie sind wichtig für die Bereitstellung der Infrastruktur und die Ermöglichung des Zugangs zu mobilen Diensten. Ihr Verhältnis zu Content-Anbietern ist von besonderer Bedeutung.
- Arbeit zitieren
- Axel Oepkemeier (Autor:in), 2002, Geschäftsmodelle im mobilen Internet, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108120