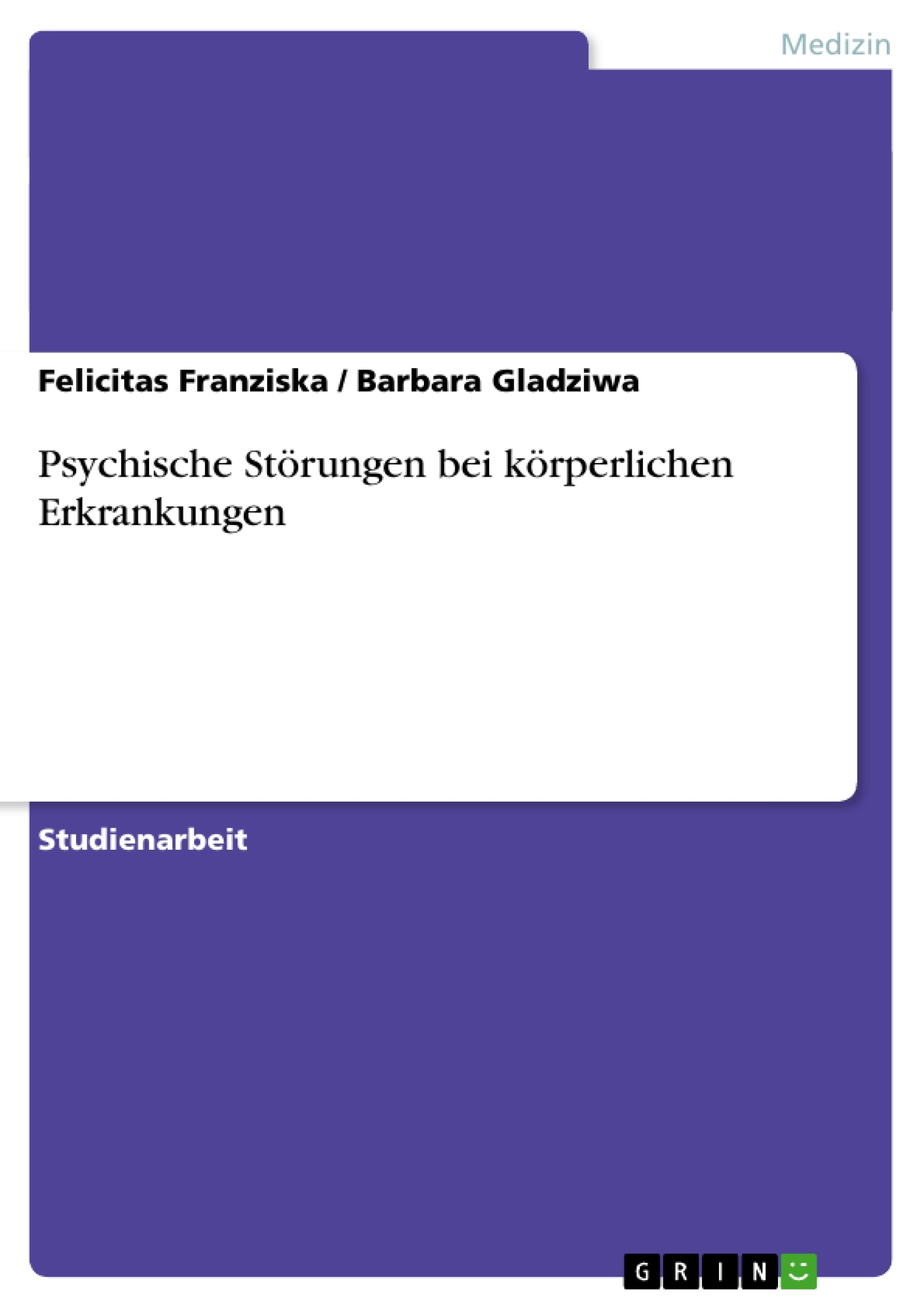Hausarbeit
Felicitas Franziska Barbara Gladziwa
Matrikelnummer 234566
Großgruppe 6, Kleingruppe 23
Wintersemester 2002/03
Thema 8
Pschychische Störungen bei körperlichen Erkrankungen
(anhand eines Artikels von Martin C. Härter aus PPmP Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie, 2000, 50 (7), Seite 274-286)
1. Welche Schwierigkeiten ergeben sich bei der Diagnose einer komorbiden depressiven und somatischen Störung? Skizzieren Sie kurz die Methoden, mit deren Hilfe man diesen Problemen begegnen kann!
2. Diskutieren Sie die unterschiedlichen Ursache-Wirkungsbeziehungen der Komorbidität von depressiven Störungen und Tumorerkrankungen im Vergleich zu Angststörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie depressiven Störungen bei Diabetes mellitus (Typ I)!
3. Welchen Nutzen kann die Erforschung der Assoziation psychischer und somatischer Erkrankungen für die medizinische Diagnostik liefern? Welche weiteren Implikationen ergeben sich aus dem bisherigen Forschungsstand zur Komorbidität psychischer und somatischer Erkrankungen für die Arbeit des Mediziners in der Praxis?
1.
Komorbidität ist der zentrale Bergriff des Artikels von M.C. Härter (2000) „Psychische Störungen bei körperlichen Erkrankungen“. Mit Komorbidität bezeichnet man den Zusammenhang zwischen körperlichen Erkrankungen und psychischen Störungen. Man spricht von Komorbidität, wenn eine Störung eine andere bedingt, die Störungen gleichzeitig oder im Vorausgang, in Folge oder im zufälligen Zusammenhang auftreten.
Härter geht in seinem Artikel auf die verschiedenen Ansätze ein, die bisher verfolgt wurden um speziell das Vorliegen einer komorbiden depressiven Störung besser zu klassifizieren.
Eine Unterscheidung in primäre und sekundäre Depression wurde von Woodruff, Murphy und Herjanic (1967) vorgeschlagen. Diese Unterscheidung sollte dazu dienen Depressive Störungen nach ihrem Erscheinungszeitpunkt einzuteilen. Eine primäre Depression tritt in Abwesenheit oder vor dem Beginn einer somatischen Erkrankung auf während eine sekundäre Depression erst nach dem Beginn einer körperlichen Erkrankung auftritt.
Diese Unterscheidung ist für die Erklärung von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen klinisch wichtig, jedoch konnte sich dieses Konzept trotzdem nicht durchsetzen. Es mangelt an Validität der Unterscheidung v.a. weil die Reliabilität der retrospektiven Erfassung des Erkrankungsbeginns gering ist.
Patienten kommen häufig erst zum Arzt wenn der Beschwerdedruck wirklich groß ist, sie können ihre Krankheitsgeschichte nur schwer rekonstruieren und in korrekter zeitlicher Reihenfolge schildern. Die Schilderung der Krankheit ist stets geprägt von der subjektiver Bewertung, was große Beschwerden macht und nach Ansicht des Patienten erwähnenswert ist.
Für den Arzt ist es u.U. unmöglich den Erkrankungsbeginn und die Ursache-Wirkungsbeziehungen der komorbiden Störung zu erfassen. Für ihn ist die Einteilung nach Woodruff, Murphy und Herjanic (1967) zwar interessant und wäre auch klinisch nützlich, aber es ist nahezu unmöglich die Zuordnung der Art der Depression nach einem Anamesegespräch und einer Untersuchung wirklich vorzunehmen.
Eine andere Unterscheidung zur Klassifikation von komorbiden Störungen, wurde in den frühen 90er Jahren vorgenommen. Es gibt als Klassifikationssysteme seitdem das DSM-III-R und die ICD-9. Diese beiden Systeme führten durch eine sorgfältige Operrationalisierung der Kriterien zu einer erhöhten Reliabilität der diagnostischen Prozesse (Härter, 2000, Psychische Störungen bei körperlichen Erkrankungen, Seite 275).
Die Vergleichbarkeit von komorbiden Störungen und die Diagnose ebendieser, wurde erheblich verbessert, indem die Erkrankungen verschiedenen Kategorien zugeordnet wurden, psychische Störungen in der Formulierung und den dazugehörigen diagnostischen Kriterien präzisiert wurden.
Diese oben genannten Systeme dienen dazu einen Überblick, vom Wissenstand bezüglich der Assoziation von psychischen und somatischen Störungen zu geben.
Es gibt diverse epidemiologische Forschungsansätze zur Erfassung der Verteilung, der Risikofaktoren und gesundheitsbezogener Zustände und Ereignisse in der Bevölkerung.
Sie zeigen einen deutlichen Zusammenhang von somatischen und psychischen Erkrankungen. Aber es ist kaum möglich in der Epidemiologie von psychischen Störungen, konkretere Aussagen über die Art der Zusammenhänge und die sich hieraus ergebenden Konsequenzen zu machen. Es bestehen nämlich erhebliche Unterschiede in den Profilen und dem Umfang der einzelnen Studien zu diesem Zusammenhang.
Für viele psychische Erkrankungen fehlen methodisch anspruchsvolle epidemiologische Studien wie z.B. für die Komorbidität von Angststörungen und körperlichen Erkrankungen (J. Hoyer, M. Höfler, F. Jacobi und H.-U. Wittchen, 2002).
Außerdem wurden in den jeweiligen Studien meist nur spezifische Zusammenhänge untersucht, aber keine allgemeinen.
So stehen z.B. Panikstörungen und Herzerkrankungen sicher in einem Zusammenhang, wie auch Schlaganfall und eine generalisierte Angststörung. Aber ob auch andere psychische Störungen mit Herzerkrankungen oder Schlaganfall korrelieren, als Bedingung, Korrelat oder Folge, wurde bisher nicht genauer untersucht.
Generell werden aus Zeit- und Kostengründen bei Patienten nur die jeweiligen augenscheinlich vorrangigen Symptome untersucht und behandelt, während andere korrelierende Faktoren häufig außer Acht gelassen werden oder nachrangig bewertet werden.
Hier ist auch die Funktion von Fachärzten zu bedenken, die dazu tendieren können, Symptome nur in ihrem jeweiligen Gebiet zu diagnostizieren. Als Beispiel nenne ich hier Bauchschmerzen, wo z.B. Gynäkologe, Internist oder Psychiater zunächst einmal unterschiedlich bei der Ursachensuche vorgehen werden. So wird die Begründung und Behandlung von nervösen Magenverstimmungen aus unterschiedlichen Fachgebieten, aus verschiedenen Betrachtungsweisen heraus unterschiedlich ausfallen.
Hinsichtlich dieses Aspektes, ist auf die Wichtigkeit zur weiteren Erforschung dieser Zusammenhänge, für die Versorgung von Patienten hinzuweisen, da es bedeutsame Implikationen für die Diagnostik, Behandlung und den Verlauf von psychischen und assoziierten somatischen Störungsbildern hat. Also dient die weitere Erforschung sowohl der Optimierung der Versorgung wie der Prävention.
Die Vielfalt unterschiedlicher Konstellationen möglicher komorbider Symptome ist das größte Problem bei der Diagnose und bei der Klassifikation nach einem der obengenannten Studiendesigns.
Als unterschiedliche Konstellationen seien hier das zufällige Zusammentreffen von somatischer und psychischer Störung, eine psychische Störung hervorgerufen durch eine somatische Erkrankung oder eine psychische Störung, welche die körperliche Gesundheit ungünstig beeinflusst, genannt.
Die körperliche Begleiterkrankung bei psychisch gestörten Patienten ist nicht selten, wird aber häufig aus oben genannten Gründen nicht diagnostiziert.
Dies liegt an der mangelnden Vertrautheit des Arztes mit der Symptomatik von komorbiden psychischen Erkrankungen und dem durch sein Fachgebiet geprägtes „Schubladendenken“. Nach J. Hoyer et al. haben Patienten mit einer psychischen Störung häufig auch eine gestörte Symptomwahrnehmung und Defizite in ihrem Krankheitsverhalten, so dass die Diagnose einer evtl. vorliegenden somatischen Erkrankung deutlich schwieriger wird. Es kommt hinzu, dass dem Facharzt oder Allgemeinmediziner oft auch die organisatorischen und personellen Vorraussetzungen für eine sachgerechte und umfassende Diagnostik fehlen. Die Krankheiten ihrerseits können auch Merkmale haben, welche die Diagnose erschweren.
Um dem Problem, eine somatische und psychische Erkrankung als komorbide Erkrankung zu erfassen, entgegen zu wirken, müssten die Diagnoseverfahren der jeweils behandelnden Ärzte geprüft und ergänzt werden.
So ist es überlegenswert in der Psychiatrie, eine internistische Basisdiagnostik bei der Eingangsuntersuchung als Routine durchzuführen. Das bedeutet also der Untersuchung in der Psychiatrie das „Routinelabor“ (BKS; BB; Leber-/Nierenfunktion, BZ etc., TSH-Bestimmung v.a. bei älteren Patienten), bei Erstbehandlung EKG, Röntgen-Thorax bei älteren Patienten und weitere apparative Diagnostik sowie gezielte Diagnostik bezüglich spezieller Risiken, hinzuzufügen. Ein Internist sollte analog dazu bei psychisch erkrankten Patienten, besonders auf damit verbundene typische Probleme achten, beispielsweise die häufig erhöhte Aspirationsrate bei Schizophrenie und der damit verbundenen Gefahr durch einen Bolustod oder die Folgen von Substanzmissbrauch, Mangel- oder Fehlernährung bei psychischen Erkrankungen.
Probleme, die hier zu beachten sind, können nicht-, nur partiell- oder direkt medikamentenassoziierte- Probleme sein.
Besonders wichtig bei der Erfassung von komorbiden psychosomatischen Störungen ist auch die Beachtung des räumlichen Umfeldes. So ist zu hinterfragen, ob wirklich die Krankheit die depressive Störung bedingt oder eher das veränderte Umfeld des Patienen. Dies wird deutlich, anhand folgender Beobachtungen: Bei stationär behandelten Patienten erhöhte sich die Prävalenz für eine Major Depression auf 8% und für alle depressiven Störungen um 15-36%. (vgl. M.C. Härter, 2002, Psychische Störungen bei körperlichen Erkrankungen, Seite 275).
Ebenso wichtig ist die Art des Forschungsansatzes zur Erfassung der Komorbiditiät. So werden unterschiedliche Fragebogenverfahren, klinische Interviewtechniken bzw. standarisierte klinische Interviewverfahren oder Kombinationen von Fragebögen und Interview sowie körperlicher Untersuchung eingesetzt. Des weiteren muss berücksichtigt werden, wie reliabel und valide eine somatische Erkrankung erfassbar ist.
Die Schwierigkeiten bei der Diagnose einer komorbiden depressiven und somatischen Störungen sind also nicht gering, da man immer vor der Frage steht, was Ursache und was Wirkung ist. Durch Studien mit verschiedensten Profilen und die Einteilung von komorbiden Erkrankungen in verschiedene Kategorien, wird diesen Problemen begegnet und die Diagnostik von komorbiden depressiven und somatischen Störungen optimiert.
2.
Härter (2000) geht auf die Prävalenz von psychischen Störungen bei körperlichen Erkrankungen und ihre Ursache-Wirkungs-Beziehung ein:
- Tumorerkrankungen und depressive Störungen
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Angststörungen
- Diabetes mellitus (Typ I) und depressive Störungen.
Es bestehen hier jeweils unterschiedliche Ursache-Wirkungs-Beziehungen der einzelnen Störungen.
Epidemiologische Forschungsansätze beschäftigen sich jeweils mit der verschiedenen räumlichen und zeitlichen Verteilung in unterschiedlichen Populationen. Hieraus kann man Schlüsse über unterschiedliche Ursachen-Beziehungen der Störungen ziehen.
Bei der Erfassung dieser Beziehungen, ist der spezielle Forschungsansatz zu beachten und die damit verbundene Untersuchungsart.
So kann eine Tumorerkrankung, die einen tiefen Einschnitt im Leben des Patienten bedeutet, mit ihren Einschränkungen, die sie für den Patienten nach sich zieht, der Grund für eine psychische Krise sein. Viele Patienten können diese Krisensituation mit Hilfe ihres sozialen Umfeldes ohne größere psychische Störungen bewältigen und dann mit der veränderten Lebenssituation umgehen.
Ein signifikanter Anteil an Tumorpatienten entwickelt jedoch nach der Diagnosestellung bis Behandlungsende einer Tumorerkrankung, aus dieser Krisensituation heraus eine psychische Störung mit relevanter klinischer Ausprägung. Hier ist die somatische Krankheit – der Tumor – also die Ursache für die psychische Störung.
Studien zeigen, dass die Ausprägung der psychischen Störung aber nicht allein in der bloßen Diagnose „Tumorerkrankung“ ihre Ursache hat, sondern in ihrer Relevanz und Auswirkung von Schweregrad des Tumors und vom Behandlungsumfang abhängt.
Es ist ungeklärt, ob eine Depression selbst Risikofaktor für eine Tumorerkrankung ist, da u.U. erst die Tumorbehandlung eine genauere medizinische Beobachtung des Patienten mit sich bringt, so dass auch schon vorher vorhandene Neigungen zu Depressionen erst jetzt beobachtet werden bzw. durch die Krisensituation sich die Depression manifestiert,
Der Anteil an Tumorpatienten, der aus der Diagnose heraus eine psychische Störung entwickelt, ist jedoch nicht höher als der von Patienten mit anderen körperlichen Erkrankungen. Das bedeutet also, dass trotz der hohen Belastung durch die Krankheit, die Tumorpatienten weitgehend psychisch unauffällig sind.
Es besteht zwar die Vermutung, dass die Tumorerkrankung psychische Störungen mit sich bringt bzw. dass die Diagnose den Ausbruch einer Depression impliziert, aber dass Tumorerkrankungen an sich komorbide sind, ist nicht belegt.
Auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen wurde der Ursache-Wirkungszusammenhang mit einer psychischen Störung untersucht. Hier war es aber nicht die Depression die vermehrt in diesem Zusammenhang beobachtet wurde, sondern die sogenannte Angststörung.
Bei dieser Art von körperlichen Erkrankungen, sind die somatischen Auswirkungen von psychischen Effekten besonders hoch, da sie sowohl indirekt als auch direkt das Gesundheitsverhalten beeinflussen. Symptome können sich bis hinein in die Pathophysiologie verstärken: Ständiges Herzrasen bei Angst, kann die Physiologie des Herzens bis zum Herzklappenfehler verändern.
Ängstliche und depressive Symptome stehen häufig in Verbindung mit Brustschmerzen und Tachykardien bei Personen, die sonst nicht zur Risikogruppe für kardiale Erkrankungen zählen. Ausgenommen Patienten mit koronaren Herzerkrankungen wird sonst bei Personen mit thorakalen und kardialen Beschwerden, eine hohe Prävalenz von Psychischen Auffälligkeiten beschrieben.
Bei vielen dieser Patienten ist ein Paniksyndrom die Ursache der Beschwerden. So sind fast die Hälfte der Patienten, die unter Brustschmerzen leiden und einen angiographischen Normalbefund haben, Patienten die unter einer Panikstörung leiden.
Panikbedingte Tachykardien können möglicherweise für temporäre Herzklappen-Deformationen sorgen, was zeigt, dass eine psychische Störung durchaus auch zur Verschlechterung oder zum Eintreten einer körperlichen Störung beitragen kann.
So ist also bei der Komorbidität von Herz-Kreislauf-Erkrankungen die psychische Erkrankung die Ursache für die körperlichen Beschwerden, während dies ja bei der Tumorerkrankung basierend auf bisherigen Studien in eher umgekehrter Beziehung steht, falls dort überhaupt von Komorbidität die Rede sein kann.
Während es bei Tumorerkrankungen also nur bedingt von Komorbidiät die Rede sein kann, besteht bei einer Depressiven Störung unzweifelhaft ein erhöhtes Risiko für ischämische Herzerkrankungen und früheres Versterben von Patienten in der Post-Infarkt-Phase. Hier ist die Assoziation statistisch abgesichert. Die kausalen Mechanismen, die ihr zugrunde liegen sind jedoch nicht geklärt. Dass eine Assoziation zwischen endokrinologischen Erkrankungen und psychischen Störungen besteht, ist seit langem bekannt. V.a. zwischen depressiven Störungen und Über- und Unterfunktionen der Schilddrüse, Erkrankungen der Nebennieren sowie Diabetes mellitus besteht ein Zusammenhang, auf den ich im Folgenden näher eingehen werde.
Es wurden verschiedene psychischen Störungen im Zusammenhang mit Diabetes mellitus untersucht wie Angsterkrankungen, affektive Erkrankungen und Depressionen. Es traten bei Diabetikern erhöhte Pravälenzraten psychischer Störungen auf, wobei aber allein die Depressionen für den signifikanten Unterschied zwischen Korntrollpersonen und Diabetikern verantwortlich waren.
Die Eigenkontrolle des Stoffwechsels und psychosoziale Variablen, tragen zum Erkrankungsrisiko und Krankheitsverlauf im besonderem Maße bei. Dies ist die Begründung dafür, dass depressive Patienten, durch ihr Verhalten ihre Gesundheit maßgeblich beeinflussen können. Depressive Neigungen sind also ursächlich an der Entwicklung des Gesundheitszustandes des Patienten beteiligt.
Es wurden hierzu u.a. Studien über die Komorbidität von Essstörungen und Diabetes durchgeführt. Diese sind jedoch nicht repräsentativ, da man nur Patienten erfasst hat, die sich zur Behandlung in spezialisierte Einrichtungen begeben hatten. So sind die Studien über Diabetiker und Essstörungen an einer selektiven Patientengruppe mit vermehrten psychosozialen Problemlagen und erhöhten Prävalenzraten für Essstörungen durchgeführt worden.
Da es nicht von der Hand zu weisen ist, dass die Ernährung den Gesundheitszustand prägt und beeinflusst, wie auch das soziale Umfeld, das körperliche Befinden beeinflusst, ist die psychische Lage eines Patienten als komorbide zu einer Stoffwechselerkrankung zu betrachten.
Zwar sind die bisher erforschten Assoziationen nicht ausreichend um den Ursache-Wirkungszusammenhang von psychischer Störung und sich draus ergebener Stoffwechselerkrankung als unabdingbar zu belegen, da die Studien bisher nur in selektiven Gruppe durchgeführt worden sind, aber sie unterstützen die These, dass komorbide psychische Störungen den Verlauf und die Gesundungschancen körperlich kranker Patienten ungünstig beeinflussen.
3.
Die Bedeutung der Erforschung der Assoziation von psychischen und somatischen Erkrankungen, ist von hoher Relevanz für die Klinik und ihre Diagnostik. Sie ist besonders wichtig bei der Beurteilung der Situation eines Patienten, der Länge des Krankenhausaufenthaltes, seiner Therapiecompliance und den Auswirkungen auf die Lebensqualität (Härter, 2000, Psychische Störungen bei körperlichen Erkrankungen, Seite 276).
Die Zuordnung der Ursache-Wirkungs-Beziehung bei einer komorbiden Erkrankung, kann die Grundlage für die Therapiefolge sein.
Das Abwägen von Risikofaktoren für den einzelnen Patienten wird durch genaue Daten erheblich verbessert. Ebenso geben die ermittelten Risikofaktoren, die Möglichkeit präventiv vorzugehen. Dies geschieht indem sie möglichst begrenzt werden oder durch frühzeitige Behandlung zumindest die Schwere einer Krankheit verringert wird.
Als Beispiel sei hier eine 50 jährige herzkranke Patientin, mit früheren depressiven Episoden genannt, in deren Familie es gehäuft zu depressiven Störungen und Herzerkrankungen kam. Ihr steht ein Umzug in eine fremde Stadt bevor. Hier kann durch Gespräche und Hilfe bei der Suche nach sozialer Unterstützung etc. vorgebeugt werden, um die Patientin vor allzu großer Belastung durch die veränderte Lebenssituation zu bewahren und das Risiko für erneute Herzbeschwerden und Depressionen zu verringern.
Außerdem sollte besonders auf die körperliche Gesundheit der Patientin geachtet werden durch eine ausgewogene, regelmäßige Ernährung, da auch Abgeschlagenheit, Schlappheit und Mangelernährung dazu führen können, dass die Patientin in einen Zustand von Antriebslosigkeit gerät. Die Patientin sollte sich Zeit zur Entspannung nehmen und lernen Stress abzubauen, da dieser für das Eintreten von Herzbeschwerden ein besonderes Risiko ist.
Körperliche Beschwerden sind bei solch einer Patientin von besonders hohem Risiko, da eine komorbide psychische Störung v.a. aufgrund der ohnehin schon bestehenden Neigung eine hohe Wahrscheinlichkeit hat.
Dem Mediziner sollten für seine Arbeit in der Praxis, die Assoziation von komorbiden psychischen und somatischen Störungen bekannt sein.
Der Zusammenhang von Schmerz und depressiven Symptomen und deren Interaktion in beide Richtungen, muss ihm bei Schmerzbehandlung bewusst sein. Besonders bei Risikopatienten – Personen, die zu Depressionen neigen – muss er sich bewusst sein, zu welchen Folgen akute und auch chronische Schmerzen führen können.
Ein einfühlsames Arzt-Patienten Gespräch, hilft dem Patienten, bei der Entwicklung seiner Einstellung zur Krankheit und dem Umgang damit. Sogar ein ansprechendes Wartezimmer kann dem Patienten helfen zu einer positiveren Einstellung verhelfen.
Hilfen zu einer gesunden Lebensweise durch z.B. Ernährungsberatung, Rückenschulung etc., können dem Patienten in seinem Gesundheitsbewusstsein schulen und seinen Allgemeinzustand verbessern.
Krankenhausaufenthalte sollten nicht nur aus Kostengründen begrenzt sein, sondern auch deshalb, weil sie nicht unerheblich zum psychischen Befinden des Patienten beitragen. Der Patient soll eben nicht durch den Krankenhaus eine „neue“ Krankheit entwickeln.
Die erhebliche psychische Belastung für einen Patienten bei einer Langzeitbehandlung im Krankenhaus darf weder von Ärzten noch vom Pflegepersonal unterschätzt werden. Angemessene Besuchszeiten, Zeit der Ärzte und des Pflegepersonals für den einzelnen Patienten, Betreuung durch Sozialarbeiter, Beschäftigungstherapeuten, Musiktherapeuten, Physiotherapeuten etc. sollen bedacht werden, um dem Patienten seinen Krankenhausaufenthalt zu erleichtern.
Den Schwierigkeiten bei der Diagnose von komorbiden psychischen und somatischen Störungen muss der Mediziner kennen. Er ist zu einer sorgfältigen Beobachtung und Befragung seiner Patienten verpflichtet, um komorbide Erkrankungen einzuordnen und optimal zu behandeln.
Die Erforschung dieser Sachverhalte ist aber nicht nur für den Arzt, der seine Behandlungsqualität verbessern und seine Diagnostik optimieren kann, und für Patienten von Vorteil, der von einer verbesserten Behandlung profitieren kann, sondern auch für Krankenkassen und Staat. Durch Prävention und verbesserte Diagnostik, können Kosten gespart werden.
Literaturverzeichnis:
(1) Härter, Martin C.; Pschychische Störungen bei körperlichen Erkrankungen, PPmP Psychotherapie Psychosomatik, Stuttgart, New York 2000; 50 (7), 274-286
(2) Härter, Martin C. ; Internistische Probleme in der psychiatrischen Krankenversorgung 2002 www.psych.uni-freiburg.de, Freiburg
(3) Hoyer, Jürgen; Höfler, Michael; Jacobi, Frank; Wittchen, Hans-Ulrich Komorbidität zwischen körperlichen Erkrankungen und Angststörungen, www.psylux.psych.tu-dresden; Dresden, München 2002
(4) Kerejarto, Margit v.; Beckmann, D.; Großmann, K.;. Janke A.; .Steingrüber, H.-J.; Medizinische Psychologie, Berlin, Heidelberg, New York 1974, Kap. 2.2.3.5., Seite 35; Kap.1.2.1. – 1.2.6. Dimensionen der Übertragung: Organische Krankheiten; 6.2. Psychologische Medizin
(5) Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch u.a. Morbiditiät, Morbus Cushing, Diabetes mellitus, Koinzidenz; Berlin, New York, 1998; 258.Auflage
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema der Hausarbeit über psychische Störungen bei körperlichen Erkrankungen von Felicitas Franziska Barbara Gladziwa?
Das zentrale Thema ist die Komorbidität, also das gleichzeitige Auftreten oder der Zusammenhang zwischen körperlichen Erkrankungen und psychischen Störungen.
Welche Schwierigkeiten können bei der Diagnose einer komorbiden depressiven und somatischen Störung auftreten?
Schwierigkeiten entstehen durch die Vielfalt möglicher komorbider Symptome, die Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer Depression, die Rekonstruktion des Erkrankungsbeginns durch den Patienten, die subjektive Bewertung der Krankheit durch den Patienten, die unterschiedliche Herangehensweise von Fachärzten und die mangelnde Vertrautheit mit der Symptomatik von komorbiden psychischen Erkrankungen.
Welche Methoden können helfen, die Probleme bei der Diagnose von komorbiden depressiven und somatischen Störungen zu bewältigen?
Die Diagnoseverfahren der behandelnden Ärzte sollten geprüft und ergänzt werden. In der Psychiatrie könnte eine internistische Basisdiagnostik als Routine bei der Eingangsuntersuchung durchgeführt werden. Internisten sollten bei psychisch erkrankten Patienten besonders auf damit verbundene typische Probleme achten.
Welche unterschiedlichen Ursache-Wirkungs-Beziehungen der Komorbidität werden in der Hausarbeit diskutiert?
Die Hausarbeit diskutiert die Ursache-Wirkungs-Beziehungen bei der Komorbidität von depressiven Störungen und Tumorerkrankungen, Angststörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie depressiven Störungen bei Diabetes mellitus (Typ I).
Gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen Tumorerkrankungen und dem Auftreten von Depressionen?
Es ist ungeklärt, ob eine Depression selbst Risikofaktor für eine Tumorerkrankung ist. Die Ausprägung einer psychischen Störung hängt von Schweregrad des Tumors und vom Behandlungsumfang ab. Es ist nicht belegt, dass Tumorerkrankungen an sich komorbide sind.
Wie beeinflussen Angststörungen Herz-Kreislauf-Erkrankungen?
Symptome von Angststörungen können sich bis hinein in die Pathophysiologie verstärken. Ständiges Herzrasen bei Angst kann die Physiologie des Herzens bis zum Herzklappenfehler verändern. Panikbedingte Tachykardien können möglicherweise für temporäre Herzklappen-Deformationen sorgen.
Inwiefern beeinflusst Diabetes mellitus (Typ I) depressive Störungen?
Diabetiker weisen erhöhte Pravälenzraten psychischer Störungen auf, wobei allein die Depressionen für den signifikanten Unterschied zwischen Kontrollpersonen und Diabetikern verantwortlich sind. Depressive Neigungen sind ursächlich an der Entwicklung des Gesundheitszustandes des Patienten beteiligt.
Welchen Nutzen hat die Erforschung der Assoziation psychischer und somatischer Erkrankungen für die medizinische Diagnostik?
Die Erforschung ist besonders wichtig bei der Beurteilung der Situation eines Patienten, der Länge des Krankenhausaufenthaltes, seiner Therapiecompliance und den Auswirkungen auf die Lebensqualität. Die Zuordnung der Ursache-Wirkungs-Beziehung bei einer komorbiden Erkrankung kann die Grundlage für die Therapiefolge sein.
Welche Implikationen ergeben sich aus dem bisherigen Forschungsstand zur Komorbidität psychischer und somatischer Erkrankungen für die Arbeit des Mediziners in der Praxis?
Der Mediziner sollte die Assoziation von komorbiden psychischen und somatischen Störungen kennen und die Schwierigkeiten bei der Diagnose von komorbiden psychischen und somatischen Störungen berücksichtigen. Er ist zu einer sorgfältigen Beobachtung und Befragung seiner Patienten verpflichtet, um komorbide Erkrankungen einzuordnen und optimal zu behandeln.
- Quote paper
- Felicitas Franziska (Author), Barbara Gladziwa (Author), 2003, Psychische Störungen bei körperlichen Erkrankungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108146