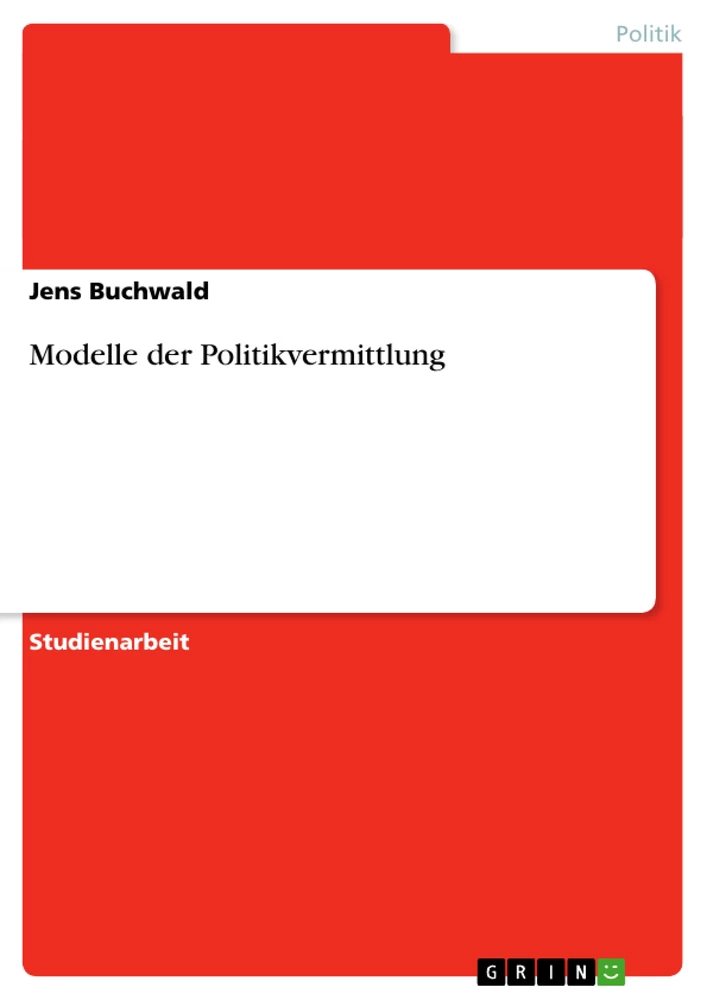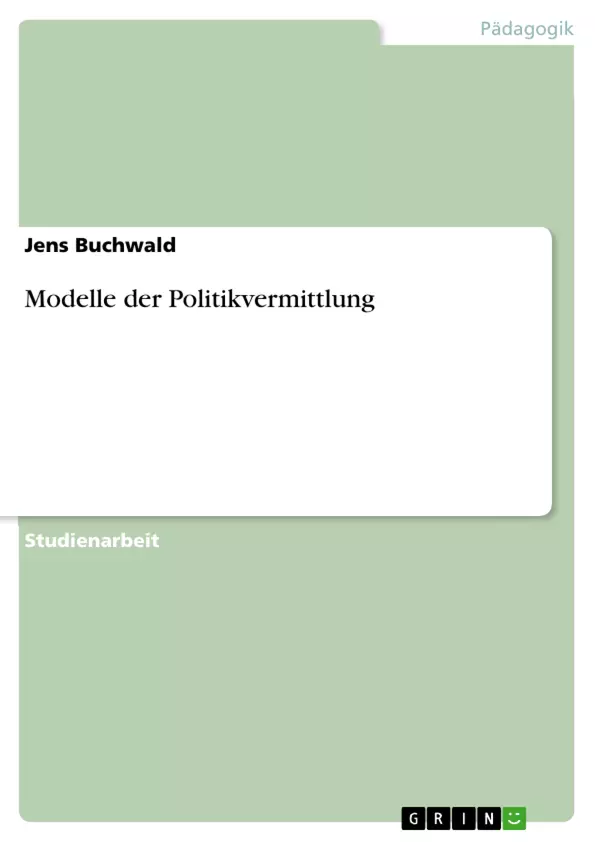In einer Welt, in der die Grenzen zwischen Realität und medialer Darstellung zunehmend verschwimmen, stellt sich die intrigue Frage: Wer lenkt wirklich die politische Agenda? Tauchen Sie ein in eine fesselnde Analyse der komplexen Beziehungen zwischen Politik, Medien und Öffentlichkeit, die unser Verständnis von Macht und Einfluss in modernen Demokratien herausfordert. Diese tiefgreifende Untersuchung enthüllt die subtilen Mechanismen, durch die politische Themen geformt, vermittelt und von der Bevölkerung aufgenommen werden, und deckt auf, wie Parteien, Medien und Bürger in einem ständigen Wechselspiel um die Deutungshoheit ringen. Anhand aufschlussreicher Modelle der Politikvermittlung, von Top-Down-Strategien der Elitenbeeinflussung bis hin zu Bottom-Up-Bewegungen der Bürgerbeteiligung, wird ein vielschichtiges Bild der Kräfteverhältnisse gezeichnet, das traditionelle Annahmen über politische Meinungsbildung in Frage stellt. Erforschen Sie die Rolle der Massenmedien als Gatekeeper und Verstärker politischer Botschaften, die Bedeutung von Agenda-Setting-Prozessen und die Auswirkungen von Medialisierung auf die politische Landschaft. Entdecken Sie, wie politische Akteure strategische Kommunikation einsetzen, um öffentliche Wahrnehmung zu beeinflussen, und wie sich die Bürger durch neue Technologien und soziale Medien Gehör verschaffen. Diese Arbeit bietet nicht nur eine umfassende Analyse der theoretischen Grundlagen, sondern auch einen praxisnahen Einblick in die Mechanismen der politischen Kommunikation und Medienwirkung, der für jeden, der die Dynamik der modernen Politik verstehen will, unerlässlich ist. Lassen Sie sich von dieser fesselnden Analyse die Augen öffnen und gewinnen Sie ein tieferes Verständnis für die Kräfte, die unsere politische Realität prägen, von der Rolle der Parteien und Politiker bis hin zur Bedeutung der Medienlandschaft und der zunehmenden Bedeutung der Bürgerbeteiligung. Ergründen Sie die Feinheiten der öffentlichen Meinung und die komplexen Wechselwirkungen zwischen politischen Akteuren, Medien und der Gesellschaft, und entdecken Sie, wie politische Entscheidungen wirklich getroffen werden. Tauchen Sie ein in die Welt der politischen Kommunikation und Medienwirkungsforschung, und gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Funktionsweise unserer Demokratie, von der politischen Agenda bis zur Rolle der sozialen Medien.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Zur „Agenda-Setting“-Forschung
3. Modelle der Politikvermittlung
3.1 Das Top-Down-Modell
3.2 Das Mediokratie-Modell
3.3 Das Bottom-Up-Modell
3.4 Das Biotop-Modell
4. Schlussbemerkung
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Zwischen Politik und Medien besteht in demokratischen Systemen ein enges Austauschverhältnis, welches durch gegenseitige Abhängigkeit gekennzeichnet ist.[1] Dieses Dependenzverhältnis wird allerdings durch eine dritte Partie, die Bevölkerung, die Öffentlichkeit oder auch das Publikum erweitert, so dass eine Dreiecksbeziehung entsteht. In diesem Beziehungsgeflecht ist nun jede der drei Partien auf die andere angewiesen, um auf jeweils unterschiedliche Art und Weise die eigenen Interessen und Belange so erfolgreich wie möglich durchzusetzen.
Parteien und Politiker bedürfen der Medien als Vermittler, um Unterstützung für ihr Handeln bei der Bevölkerung zu bekommen und um ihre Zielvorstellungen einem möglichst großen Publikum zugänglich zu machen. Sie sind auf die Bevölkerung und ihr Wohlwollen angewiesen, um ihre politische Macht zu erhalten, d.h. wiedergewählt zu werden. Die Medien und Journalisten benötigen Informationen aus der Politik, um ihrer öffentlichen Aufgabe in Form von Informations-, Meinungsbildungs- sowie Kritik- und Kontrollfunktion nachzukommen.[2] Sie sind somit auch Dienstleister für die Öffentlichkeit, und aus wirtschaftlichen Interessen heraus wiederum auf genau diese angewiesen, um ihre Existenz zu sichern. Die Bevölkerung schließlich ist in den meisten Fällen gebunden an die verschiedenen Massenmedien, um an Informationen und Nachrichten über politische Entscheidungen von Regierung und Parteien zu gelangen. Indem sie über letztere in einem Wahlprozess abgestimmt haben, sind sie natürlich in einer repräsentativen Demokratie wiederum abhängig von deren politischen Entscheidungen.
Einige der Anliegen dieser drei gesellschaftlichen Gruppen ergänzen und überschneiden sich, und es entsteht ein komplexes Gesamtsystem von Geben und Nehmen, so dass es schwierig ist festzustellen, wer die politische Meinung in einem Land bestimmt. Ziel dieser Arbeit ist es aber, sich genau der Lösung dieser Frage anzunähern: „Welche gesellschaftlichen Gruppen bestimmen die politische Agenda - die Parteien, die Medien oder das Publikum selbst?“ Dazu sollen insbesondere die Modelle der Politikvermittlung zum Verhältnis von Parteien, Medien und Publikum von Ulrich von Alemann[3] herangezogen werden. Einleitend wird ein komprimierterer Überblick zur klassischen „Agenda-Setting“-Forschung gegeben, welcher verdeutlichen soll, welchen Einfluss allein die Massenmedien auf die vorherrschende öffentliche Meinung und auch auf Entscheidungsprozesse der Politiker und Parteien haben.
2. Zur „Agenda-Setting“-Forschung
Im Laufe der Geschichte der empirischen Medienwirkungsforschung ist die Funktion der Medien im politischen Meinungs- und Willensbildungsprozess kontrovers diskutiert worden. Tatsache aber ist: Um sich einen Eindruck vom komplexen politischen Geschehen zu schaffen, ist die Bevölkerung in den meisten Fällen auf indirekte Umweltwahrnehmung angewiesen. Dies geschieht durch interpersonale Kommunikation, d.h. durch Gespräche mit anderen Menschen, vor allem aber durch die Massenmedien.[4]
In Anlehnung an Bernard Cohen, der 1963 formulierte, dass Medien nicht beeinflussen, was die Menschen denken, sondern worüber sie sich Gedanken machen[5], stellten Maxwell McCombs und Donald Shaw 1972 ihre „Agenda-Setting“-Hypothese auf. Sie konstatierten, dass es eine Rangordnung von politischen Streitfragen, sogenannten „Issues“ gab, die von der Bevölkerung in einer bestimmten Reihenfolge als wichtig angesehen wurden. Ihr Ziel war es herauszufinden, ob diese persönliche Rangordnung der Themen der Rangordnung der von den Medien herausgestellten Themen entsprach, ob also die Medien für die persönliche Einschätzung von öffentlichen Themen die Ordnung vorgaben.[6] Gegenstand der Untersuchung war der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf von 1968, bei welchem in der Kleinstadt Chapel Hill 100 registrierte aber in punkto Stimmabgabe noch unentschlossene, also potenziell beeinflussbare, Wähler telefonisch befragt wurden, welche Themen sie als am wichtigsten ansahen. Gleichzeitig wurden Meldungen aus lokalen und überregionalen Rundfunk- und Printmedien in 15 Wahlkampfschlüsselthemen unterteilt und diese anhand von Häufigkeit des Vorkommens in der Berichterstattung eingeteilt. Mittels Bevölkerungsumfrage und Medieninhaltsanalyse stellten die Wissenschaftler in ihrer Pionierstudie fest, dass eine fast vollständige Übereinstimmung der Themenpräferenzen von Medienberichterstattung und Rezipienten vorherrschte, d.h. die Öffentlichkeit stufte Themen mit dergleichen Wichtigkeit ein, wie diese von den Medien vermittelt wurden.[7]
Zu den vielen Unzulänglichkeiten der Studie, auf welche die Autoren teils selber hingewiesen haben, gehörte u.a. die grobe Kategorienwahl der Medienthemen und die kleine Stichprobe der Wähler, aber auch das völlige Außerachtlassen der Realität, die die beiden untersuchten Variablen unabhängig voneinander beeinflusste. Um möglichst alle Faktoren zu berücksichtigen gab es im Laufe der folgenden Jahre bis heute eine große Anzahl an Folgestudien, die aber für diese Arbeit nicht von außerordentlicher Bedeutung sind. Vielmehr stellt sich hier die Frage, ob die Bedeutung, die die Medien bestimmten Themen beimessen sich direkt in den Tagesordnungen der politischen Elite, also der Parteien und Politiker wiederspiegelt. Dieser Zusammenhang zwischen Medienagenda und der Agenda der politischen Eliten wird „Policy Agenda-Setting“ genannt.[8] Auf die vorangestellte Frage gibt es aufgrund weniger empirischer Arbeiten allerdings keine eindeutige Antwort, auch wenn in Einzelfällen eine Beeinflussung nachgewiesen werden konnte. Zusätzlich stehen Parteien und Medien ja in einer engen wechselseitigen Verflechtung miteinander, so dass von einer eindeutig einseitigen Beeinflussung der Politik durch die Massenmedien nicht die Rede sein kann.[9] Dies soll unter anderem auch im folgenden Kapitel anhand verschiedener Modelle der Politikvermittlung aufgezeigt werden.
3. Modelle der Politikvermittlung
Um der Grundfrage dieser Arbeit nachzugehen, wer die politische Agenda bestimmt – die politischen Parteien, die Massenmedien oder das Publikum – werden nacheinander vier Modelle der Politikvermittlung von Ulrich von Alemann vorgestellt, welche sich wiederum auf die Modelle der niederländischen Forscher Jan Kleinnijenhuis und Ewald Rietberg[10] beziehen.
3.1 Das Top-Down-Modell
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Top-Down-Modell (Bildquelle: www.dadalos.org)
Das Top-Down Modell geht davon aus, dass Parteien und Politiker auf der ersten und obersten Stufe im politischen Kommunikationsprozess stehen. Sie treffen aktiv Entscheidungen, fassen Gesetzesbeschlüsse und beeinflussen damit die reale Welt. Diese von ihnen geprägte Realität wiederum empfangen sie als Rückkopplung zurück, nehmen sie auf und richten ihre Handlungen genau danach aus. In einem nächsten Schritt vermitteln sie die ihre daraus konstruierte politische Agenda weiter an die Medien, welche in dem Modell ausschließlich auf diese Informationszufuhr der Politik angewiesen sind. Die unterste Stufe stellt schließlich das Publikum dar - sie bekommen die politischen Informationen und Themen von den Medien vermittelt.[11]
Das Modell ist allerdings eher schlicht, da es nur einen einseitigen Informationsfluss in Richtung Publikum beschreibt, dennoch sind eine Reihe von wichtigen Beobachtungen hervorzuheben. Die Parteien sind hier die erste handelnde Instanz im politischen Kommunikationsprozess, und üben daher die größte Macht aus, um öffentliche Aufmerksamkeit auf die von ihnen präferierten Themen zu richten und dafür Akzeptanz zu finden. Hierzu bedienen sie sich unterschiedlicher Strategien wie gezielten Interviews, Parteitagen oder ausgeklügelten PR-Inszenierungen. Allerdings haben Regierungs- und Oppositionsparteien nicht die gleichen Möglichkeiten. So verfügt die jeweilige Regierungspartei über größere personelle wie materielle Ressourcen, wie beispielsweise durch das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Als regierende Partei sind sie jedoch auch maßgeblich an der öffentlichen Themenwahl beteiligt, sie bestimmen also hauptsächlich was in die politische Agenda aufgenommen wird. Oppositionsparteien hingegen sind in erster Linie genötigt zu reagieren, und neigen daher zu Polarisierung grundlegender politischer Themen.[12] Aber „der Regierungsvorsprung wird nicht nur durch schlichte Fehler der Regierung, sondern auch durch die Unabhängigkeit der Presse konterkariert, [...], ferner durch die Eigenarten des deutschen politischen Systems und der deutschen politischen Kultur. Dazu gehören insbesondere der Föderalismus und eine Tendenz zur Konkordanz- bzw. Proporzdemokratie.“[13] Über die Länderregierungen, deren Vertreter im Bundesrat sitzen können Oppositionsparteien in der Bundesrepublik Deutschland maßgeblich an der Regierungspolitik mitwirken. Somit ist auch für die Opposition ein gewisses Mitspracherecht gesichert, was eher zu Lösungen politischer Probleme in beidseitigem Einverständnis führt. Hauptsächlich geschieht dies in Fällen, die der Kulturhoheit der Länder unterliegen, welche auch die Rundfunkhoheit beinhaltet. Doch ist immer wieder versucht worden, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Rundfunkgremien von parteipolitischer Seite durch Vertreter der beiden großen deutschen Volksparteien zu beeinflussen und zu unterwandern, wodurch deren Autonomie in Gefahr geraten ist. Erst die Einführung privater Fernsehsender im Laufe der 1980er Jahre hat das Interesse der Parteien diesbezüglich ein wenig abflauen lassen.[14]
„Zu den verheißungsvollen Kommunikationsstrategien politischer Parteien – gerade im Wahlkampf – gehört es darüber hinaus, mit Hilfe von Symbolen oder symbolischen Handlungen Themen zu bestimmen und Begriffe zu besetzen. Vor allem in Wahlkämpfen verdichtet sich diese Form der ‚symbolischen Politik’.“[15] Weniger die konkrete Politik, sondern vielmehr ihre erfolgversprechende Verpackung in publikumsgerechte Häppchen und ihre Vermarktung spielen eine Rolle beim Versuch, Mehrheiten zu gewinnen. Hierzu dienen ebenso professionelle wie geschickte PR-Inszenierungen, die dem Publikum anstatt der realen komplexen Politik eine Scheinwirklichkeit vorgaukeln und zu Personalisierungsstrategien, Gefühlskampagnen und ideologischen Scheinfokussierungen führen.[16] An diesem Punkt stellt sich nun die Frage, ob es diese reale Politik als solches überhaupt gibt, wenn das Publikum Politik fast ausschließlich aus den Medien rezipiert, und diese so zur eigentlichen Wirklichkeit wird. Entwerfen Massenmedien also die Realität, wie es Vertreter der konstruktivistischen Medientheorie behaupten?[17]
3.2 Das Mediokratie-Modell
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Mediokratie-Modell (Bildquelle: www.dadalos.org)
Im Mediokratie-Modell wird angenommen, dass hauptsächlich die Massenmedien, quasi als Vierte Gewalt im Staate, die öffentliche Meinung beeinflussen und damit die politische Agenda diktieren. Politische Entscheidungen und Themen werden durch die Medien rückwirkend aus der Umwelt aufgenommen und dann auf der einen Seite zurück auf die Politik gespiegelt, auf der anderen Seite dem Publikum weitergegeben. Die Agenda der Medien wird somit also zwangsläufig zur bestimmenden politischen Agenda.[18]
Gerade im letzten Jahrhundert haben die Massenmedien durch starke Expansion getragen von wirtschaftlichem Erfolg und neuen technischen Verbreitungsmöglichkeiten immer mehr an Macht gewonnen. Im Rahmen dieser Entwicklung ist es zu einem Medienwandel gekommen, in welchem oftmals sachliche Information durch seichte Unterhaltung abgelöst wurde, und Politik personalisiert wurde durch den Zwang des Fernsehens zur Visualisierung von öffentlichen Personen.[19] Vor allem neuartige TV-Nachrichtenmagazine widmen sich neben politischen Inhalten immer mehr ausgefallenen und auffallenden Ereignissen: „Ein journalistisches Genre annonciert sich selbst als Akteur, als Organisator von Konflikten und Zusammenstößen, als Infotainment: Alles Recht gehört dem Schlag und der Schlagzeile.“[20] Dieser Wandel von Form und Inhalt schlägt sich im Bereich der Printmedien in den letzten beiden Jahrzehnten aber auch im Wachstum der Auflagenzahlen und Titelanzahl der Kunden- und Publikumszeitschriften nieder. Wobei das Fernsehen in dieser Zeit durch die Einführung des privat-kommerziellen Rundfunks und durch Kabel- und Satellitenübertragung sicherlich die größere Veränderung durchgemacht hat. Und die Folgen für die Politik sind groß. Zwar kommt den Parteien durch diese Extensität der heutigen Medien eine zuvor nie dagewesene Beachtung zu und damit die Möglichkeit, Themen schnell zu vermitteln. Damit gehen jedoch Intensitäts- und Treueverluste sowie ein Beständigkeits- und Berechenbarkeitsschwund einher, was sich an der drastischen Zunahme von Wechselwählern zeigt.[21] Wie durch das Zappen mit der Fernbedienung von einem Fernsehprogramm zum anderen hin- und hergeschaltet werden kann, springt der Wähler unter Einfluss der von den Medien abgebildeten Realität von einer politischen Überzeugung zur anderen, von einem Trend zum anderen, von einer Mode zur nächsten.[22]
Dabei durchlaufen die von den Medien behandelten Themen einen bestimmten Kreislauf in der Berichterstattung äquivalent zur öffentlichen Aufmerksamkeitszuwendung. Danach „erlebt das Thema (1) eine Vorphase der Thematisierung, (2) eine Entdeckungsphase, (3) einen Höhepunkt, (4) eine Abschwungphase, (5) eine Nachproblemphase.“[23] Außerdem unterliegen Themen in den Medien bestimmten Nachrichtenwertfaktoren, durch welche politische Wirklichkeit verarbeitet wird. Dies sind Kriterien nach denen der Nachrichtenwert eines Themas bemessen wird, und ohne wenigstens einem der Kriterien zu entsprechen wird kein Thema medial herausgestellt werden. Damit eine potenzielle Nachricht in den westlichen Massenmedien Platz findet, sollte sie sich auf Elite-Nationen und Elite-Personen beziehen. Je stärker ein Ereignis personalisiert ist, desto eher wird es zur Nachricht. Es gilt auch, je negativer ein Ereignis ist, desto stärker wird es von den Medien beachtet. Es sollte auch einen gewissen Überraschungseffekt aufweisen, aber dennoch mit bereits vorhandenen Vorstellungen und Erwartungen des Publikums in Einklang zu bringen sein.[24]
Die große Bedeutung, die Medien bei der Vermittlung zwischen Parteien und Öffentlichkeit zugemessen wird, kann aber auch auf die innerparteiliche Kommunikation übertragen werden. Parteimitglieder erfahren heutzutage sehr stark über die Massenmedien, was sich thematisch und personell in ihrer Partei abspielt – die Auflagen der Parteizeitungen sind rückläufig und Parteiabende können kaum mehr Informationen liefern als die Medien, vor allem was die Bundespolitik angeht.[25]
Innerhalb des Mediensystems gibt es das Prinzip der Meinungsführerschaft. Hierbei informieren sich die Medien bei ihrer Themenauswahl untereinander an anderen qualitativ vermeintlich übergeordneten Trendsetter-Medien, und nehmen dies als Maßstab für die eigene Berichterstattung. Dieses Orientieren von Journalisten an Journalisten bei der Themenauswahl wird „Inter-media-Agenda-setting“ genannt.[26] Somit wird davon ausgegangen, dass Journalisten stark am Prozess des gesellschaftlichen Wertewandels beteiligt sind, da sie Sichtweisen von ihnen nahe stehenden Bevölkerungsschichten übernehmen oder ihre Berichterstattung gemäß dieser Standpunkte färben, des weiteren natürlich auch ihre eigenen Sichtweisen vermitteln und diese wiederum voneinander übernehmen. Somit drohen in diesem Modell Journalisten und Medien zu den alleinigen Herrschern der politischen Agenda und zu großen Dirigenten des gesellschaftlichen Wertesystems zu werden, indem sie die Politik ihren eigenen Werten der Publikation unterwerfen.[27] Und was sie nicht berichten bleibt unbeachtet in der Öffentlichkeit.
3.3 Das Bottom-Up-Modell
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Bottom-Up-Modell (Bildquelle: www.dadalos.org)
Das Bottom-Up-Modell unterstellt, dass das Publikum die politische Agenda bestimmt, indem es Themen aus der realen Welt aufnimmt und sie über die Medien artikuliert, um auf diese Weise die veröffentlichte und öffentliche Meinung zu beeinflussen und indirekt Parteien und Regierungen zu erreichen. Die Medien fungieren hier also als Vermittler, die eine verstärkende Funktion für die Anliegen der Bürger besitzen. Über demokratische Wahlen ist es der Bevölkerung darüber hinaus möglich, direkt auf die politische Willensbildung einzuwirken. Parteien und Politiker beeinflussen dann die Ereignisse der realen Außenwelt, welche von den Wählern wiederum wahrgenommen werden.[28]
Diese Politikbestimmung von unten über den Verstärker der Medien hat das Bundesverfassungsgericht folgendermaßen beschrieben: „Soll der Bürger politische Entscheidungen treffen, muss er umfassend informiert sein, aber auch die Meinungen kennen und gegeneinander abwägen können, die andere gebildet haben. Die Presse hält diese ständige Diskussion in Gang; sie beschafft die Information, nimmt selbst dazu Stellung und wirkt als orientierende Kraft in der öffentlichen Auseinandersetzung. In ihr artikuliert sich die öffentliche Meinung; die Argumente erklären sich in Rede und Gegenrede, gewinnen deutliche Konturen und erleichtern so dem Bürger Urteil und Entscheidung.“[29]
Hier wird ein Idealbild der Presse in einer Demokratie beschrieben, welches sich so in der Realität sicherlich nicht aufrechterhalten lässt, wie die beiden weiter oben beschriebenen Modelle der Politikvermittlung zeigen. Trotzdem gibt es einzelne Argumente und Entwicklungen, welche das Bottom-Up-Modell untermauern, und für eine Machtverschiebung hin zur Bevölkerung und deren Bestimmung der politischen Agenda sprechen. So zum Beispiel bei der Kommerzialisierung des Rundfunks im Bereich des Fernsehens, die zwar ursprünglich in Deutschland parteipolitisch motiviert war und selbstverständlich auch wirtschaftlichen Interessen diente, dennoch aber für eine Markt-, Kunden- und Zuschauerorientierung sorgte, was dem Publikum zugute kam.[30] Ottfried Jarren spricht in diesem Zusammenhang von einer Wandlung von auf Staat und Organisationen festegelegten „Klassenmedien“ über auf die Gesellschaft verpflichtete „Massenmedien“ zu publikumsorientierten „Zielgruppenmedien“, die sehr wandlungsfähig sind und auch jeweils an ein bestimmtes Publikum gebunden sind.[31] Natürlich gibt es hierzu auch kritische Stimmen und so merkt Fritz Wolf zur Kommerzialisierung der klassischen elektronischen Medien an: „Sie verändert Akteure und Handlungsmuster; sie verwandelt den öffentlichen Raum in einen Rummelplatz. Der Daseinszweck der privaten Sender ist nicht ein irgendwie geartetes öffentliches Interesse, sondern der Verkauf eines möglichst großen Publikums an die Werbung. Der Kommerz tritt demokratisch auf, denn er kennt keine Parteien. Dafür kennt er auch keine Bürger – nur Konsumenten.“[32]
Dennoch lassen sich zum Beispiel im Bereich des Hörfunks mit einer großen Anzahl von privatrechtlich-kommerziell organisierten Radiosendern, Lokalradios und verschiedenen sogenannten Offenen Kanälen eindeutige Demokratisierungsansätze von unten beobachten. Und auch bei den Printmedien hat durch einfache und günstige Kopier- und Satztechniken eine technische Revolution stattgefunden, die Bürgerinitiativen, kleineren politischen Gruppierungen, Arbeitskreisen und Selbsthilfegruppen zugute kommt. Auch innerhalb der etablierten Parteien ist so die Möglichkeit zur Kommunikation und Gegenöffentlichkeit versus die jeweilige Parteiführung stark angestiegen.[33]
Aber auch die sogenannten neuen elektronischen Medien wie das Internet tragen durch ihre dezentrale und nicht hierarchische Organisationsstruktur dazu bei, ein passives Publikum in eine aktive Öffentlichkeit umzuwandeln, die sich im Sinne ihrer Interessen zu artikulieren weiß und an Einfluss gewinnt. Diese Multi-Media-Kommunikation von den Bürgern ausgehend stellt sich gegen die Herrschaft der Parteipolitiker und Medienunternehmen von oben.[34] Dies wird aber nicht nur von einzelnen Bürgern sondern ebenfalls stark von weltweit organisierten sogenannten Nongovernmental Organizations (NGOs) genutzt. Greenpeace, Amnesty International, World Wild Fund (WWF) und viele andere nicht zu Regierungen gehörende Organisationen setzen sich auch mit Hilfe neuer Medien für ihre jeweiligen Ziele ein, und beeinflussen auf diese Art und Weise Politik und Parteien in ihrem Sinne. Durch ihre Mitgliedschaft in einer derartigen Organisation können Menschen also ihre Anliegen artikulieren und Anstöße zu deren Durchsetzung geben, dennoch bleibt die Frage offen, wie weit die Macht des einzelnen Individuums geht und wie sehr das Erreichen eines Ziels abhängig ist vom Zusammenspiel des gesamten gesellschaftlichen Kommunikationssystems, in dem auch die großen Massenmedien und etablierte Politiker statt herer Ziele lediglich ihre eigenen Interessen verfolgen.
3.4 Das Biotop-Modell
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Biotop-Modell (Bildquelle: www.dadalos.org)
Mit seinem Biotop-Modell versucht von Aleman über die Verwendung der drei bereits behandelten Modelle weniger ein verallgemeinerndes Symbiose-Modell der vorangegangenen zu kreieren, als vielmehr über die Auswertung der niederländischen Studie von Kleinnijenhuis und Rietberg die vielfältigen Prägungen und Verflechtungen vor allem zwischen Parteien und Medien aber auch des Publikums aufzuzeigen. Die niederländischen Wissenschaftler kommen nämlich über Korrelationstests der Zusammenhänge zu dem Ergebnis, dass sich Top-Down- und Bottom-Up-Modell in Bezug auf die direkte Beeinflussung der politischen durch die öffentliche Agenda bestätigen, während sie das Mediokratie-Modell ablehnen.[35] Zwischen Parteipolitik und Publikum gibt es bei ihnen also ein Zusammenspiel, und die Medien verhalten sich weder zur einen noch zur anderen Seite offen aufnahmefähig. In der deutschen Parteien und Kommunikationsforschung herrschen dazu hingegen unterschiedliche Meinungen, und die meisten Wissenschaftler gehen davon aus, dass Politik und Medien zu Lasten des Publikums in Verbindung stehen.[36] Dieser/s sogenannte „Biotop zwischen Politikern und Journalisten“[37] ist von gegenseitiger Abhängigkeit und einer gegenseitigen Tauschbeziehung geprägt, bei welchem die Vorteile der Politiker darin liegen, dass sie durch Massenmedien ins Blickfeld der öffentlichen Aufmerksamkeit geraten, also persönliche Publicity bekommen, und ihnen nützliche Sachverhalte thematisiert werden sowie im Umkehrschluss ihnen schadende Themen möglichst vermieden oder entschärft werden. Des weiteren hilft es Politikern, wenn sie von Journalisten über öffentliche Stimmungen oder politische Widersacher informiert werden und sich der Gunst der Presse sicher sein können. Auf der anderen Seite nützt Medienvertretern die Nähe zu Politikern ebenfalls, da sie dadurch an Ansehen gewinnen und Einfluss auf die Themenwahl erhalten. Außerdem spielen für sie vor allem exklusive Information von Politikern eine große Rolle, die oft nur durch eine über die Jahre aufgebaute und gepflegte Wertschätzung möglich ist.
Dieses symbiotische Beziehungsgeflecht dient hauptsächlich einem gemeinsamen Ziel: Die politische Kommunikation zwischen den beiden Gruppen aufrechtzuerhalten.[38] „Gewiss macht es die Politik den Journalisten nicht leicht. Jeder Wahlkampfberater weiß, dass Journalisten Nachrichten wünschen, und wo keine sind, werden welche hergestellt: Hier eine Veranstaltung, dort eine Wahlkampfreise – der Nachrichtenwert gleich Null. Ereignis-Management nennt man das.“[39] Um Öffentlichkeit für ihre Themen zu schaffen, findet von beiden Seiten also gleichermaßen die Inszenierung von sogenannten Pseudoereignissen statt, die ohne die Massenmedien nicht stattfinden würden.[40] Das Publikum bleibt dabei nur Zuschauer und ist passiv zur Beobachtung der zum Teil symbolischen Politik der beiden Akteure verdammt.
4. Schlussbemerkung
Das in der Einleitung angesprochene Abhängigkeitsverhältnis zwischen Parteien, Medien und dem Publikum, die jeweils auf die Durchsetzung ihrer eigenen Interessen bedacht sind, ist durch die Vorstellung der verschiedenen Modelle der Politikvermittlung Ulrich von Alemans im vorangegangenen Kapitel ausgiebig beleuchtet worden. Nun gibt es für jedes der vier Modelle wissenschaftliche Belege und Beispiele, so dass schnell klar wird, dass es keine eindeutige Antwort auf die Frage gibt, welche der drei Gruppen die politische Agenda letztendlich bestimmt – es können lediglich Tendenzen ausgemacht werden. Auch sind in der empirischen Medienwirkungsforschung sehr viele Ansätze und Theorien zu diesem Thema vorhanden, die zwar jeweils empirisch belegt werden können aber oftmals zu sehr einseitigen Ergebnissen kommen.
Am seltensten kommt es eindeutig zu einer Festsetzung der politischen Themen von unten, also vom Publikum ausgehend (allein der Begriff Publikum weist schon auf eine gewisse Passivität hin), wie das im Bottom-Up-Modell beschrieben wird, da die Bevölkerung einerseits sehr von der Informationszufuhr der Medien und andererseits stark von den Urteilen der Politik und Parteien abhängig ist. Um aktiv Einfluss geltend zu machen, muss sie sich möglichst zu gesellschaftlich relevanten Gruppen mit hoher Repräsentativität zusammenschließen, ansonsten bleibt sie unbeteiligt.
Wie sieht das in den anderen Modellen zur Bestimmung der politischen Agenda aus? Die Agenda-Setting-Forschung hat trotz variierender Ergebnisse gezeigt, dass es der Forschungsstand erlaubt, „von einem starken Einfluss der Medienberichterstattung auf die Bevölkerungsrangordnung der Wichtigkeit politischer Themen zu sprechen. Mit anderen Worten, die Massenmedien bestimmen durch Publikationshäufigkeit und Aufmachung mit, welche Probleme in einer Gesellschaft als besonders wichtig und daher lösungsbedürftig angesehen werden und welche Probleme vernachlässigt werden.“[41] Diese Schlussfolgerung ist eindeutig im Bereich des Mediokratie-Modells anzusiedeln und gibt diesem Recht, indem es den Medien bescheinigt, Einfluss sowohl nach oben in Richtung Politiker als auch nach unten in Richtung Publikum geltend machen zu können.
Geht man nun davon aus, dass die Medien ihrerseits wiederum stark von der Informationszufuhr der Parteien und Politiker abhängig sind, gelangt man schnell zu Belegen für das Top-Down-Modell, wobei festgehalten werden muss, dass Politiker zur Durchsetzung ihrer Interessen in umgekehrter Weise auch auf die Massenmedien angewiesen sind. So wird also deutlich, dass es wie im Biotop-Modell beschrieben vor allem ein enges wechselseitiges Beziehungsgeflecht und symbiotisches Abhängigkeitsverhältnis zwischen den beiden Hauptakteuren Parteien und Medien ist, welches die politische Agenda bestimmt. Dabei manipulieren sich beide Gruppen gegenseitig, um ihren Anliegen Gehör zu verschaffen. Politische PR übt sich in gezielt gelenkter Lobbyarbeit und inszeniert zwecks Gewinnung neuer politischer Macht künstlich Ereignisse, die hauptsächlich symbolischen Wert haben, während Journalisten Kampagnen gegen Parteien und Politiker lostreten, um ihrerseits Ansehen zu erlangen und Einschaltquoten und Auflagenzahlen in die Höhe zu treiben.
Literaturverzeichnis
- Alemann, Ulrich von: Parteien und Medien. In: Gabriel, Oscar W./Niedermayer, Oskar/Stöss, Richard (Hrsg.): Parteiendemokratie in Deutschland. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2002, S. 467-483
- Berkowitz, Dan: Who Sets the Media Agenda? The Ability of Policymakers to Determine News Decisions. In: Kennamer, J. David (Hrsg.): Public Opinion, The Press and Public Policy. Praeger, Westport/London, S. 81-102
- Brettschneider, Frank: Agenda Setting – Forschungsstand und politische Konsequenzen. In: Jäckel, Michael/ Winterhoff-Spurk, Peter: Politik und Medien. Vistas, Berlin 1994, S. 211-229
- Cohen, Bernard C.: The Press and Foreign Policy. Princeton University Press, Princeton 1963
- Guggenberger, Bernd: Das Verschwinden der Politik. In: Die Zeit, Nr. 41 vom 7. Oktober 1994, S. 65
- Holtz-Bacha, Christina: Medien und Politik. In: Nohlen, Dieter (Hrsg.): Kleines Lexikon der Politik. C. H. Beck oHG, München 2001, S. 291
- Jarren, Ottfried: Politik und politische Kommunikation in der modernen Gesellschaft. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Band 39/1994, S. 3-10
- Kleinnijenhuis, Jan/ Rietber, Ewald M.: Parties, Media, the Public and the Economy: Patterns of Social Agenda-Setting. In: European Journal of Political Research, 28/1995, S. 95-118
- McCombs, Maxwell E./ Shaw, Donald F.: The Agenda-Setting Function of Mass Media. In: Public Opinion Quaterly 36/1972, S. 176-187
- Pfetsch, Barbara: Themenkarrieren und politische Kommunikation. Zum Verhältnis von Politik und Medien bei der Entstehung der politischen Agenda. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Band 39/1994, S. 11-20
- Sarcinelli, Ulrich: Im Kampf um politische Aufmerksamkeit. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.09.1998, Nr.222, S. 15
- Schulz, Winfried: Nachricht. In: Noelle-Neumann, Elisabeth/ Schulz, Winfried/ Wilke, Jürgen (Hrsg.): Fischer Lexikon Publizistik/Massenkommunikation. Fischer Verlag, Frankfurt 1997, S. 307-337
- Wolf, Fritz: Alle Politik ist medienvermittelt. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Band 32/1996, S. 26-31
- www.dadalos.org (Stand 01.05.2003)
[...]
[1] Vgl. Holtz-Bacha, Christina: Medien und Politik. In: Nohlen, Dieter (Hrsg.): Kleines Lexikon der Politik. C. H. Beck oHG, München 2001, S. 291
[2] Vgl. ebd., S.291
[3] Alemann, Ulrich von: Parteien und Medien. In: Gabriel, Oscar W./Niedermayer, Oskar/Stöss, Richard (Hrsg.): Parteiendemokratie in Deutschland. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2002, S. 467-483
[4] Vgl. Brettschneider, Frank: Agenda Setting – Forschungsstand und politische Konsequenzen. In: Jäckel, Michael/ Winterhoff-Spurk, Peter: Politik und Medien. Vistas, Berlin 1994, S. 211
[5] Vgl. Cohen, Bernard C.: The Press and Foreign Policy. Princeton University Press, Princeton 1963, S. 13
[6] Vgl. McCombs, Maxwell E./ Shaw, Donald F.: The Agenda-Setting Function of Mass Media. In: Public Opinion Quaterly 36/1972, S. 177
[7] Vgl. Brettschneider, Frank: Agenda Setting – Forschungsstand und politische Konsequenzen. In: Jäckel, Michael/ Winterhoff-Spurk, Peter: a.a.O., S. 214/215
[8] Vgl. Berkowitz, Dan: Who Sets the Media Agenda? The Ability of Policymakers to Determine News Decisions. In: Kennamer, J. David (Hrsg.): Public Opinion, The Press and Public Policy. Praeger, Westport/London, S. 85
[9] Vgl. Brettschneider, Frank: Agenda Setting – Forschungsstand und politische Konsequenzen. In: Jäckel, Michael/ Winterhoff-Spurk, Peter: a.a.O., S. 223
[10] Kleinnijenhuis, Jan/ Rietber, Ewald M.: Parties, Media, the Public and the Economy: Patterns of Social Agenda-Setting. In: European Journal of Political Research, 28/1995, S. 95-118
[11] Vgl. Alemann, Ulrich von: Parteien und Medien. In: Gabriel, Oscar W./Niedermayer, Oskar/Stöss, Richard (Hrsg.): a.a.O., S. 470
[12] Vgl. ebd., S. 471
[13] ebd., S. 472
[14] Vgl. Alemann, Ulrich von: Parteien und Medien. In: Gabriel, Oscar W./Niedermayer, Oskar/Stöss, Richard (Hrsg.): a.a.O., S. 473
[15] Pfetsch, Barbara: Themenkarrieren und politische Kommunikation. Zum Verhältnis von Politik und Medien bei der Entstehung der politischen Agenda. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Band 39/1994, S. 16
[16] Vgl. Alemann, Ulrich von: a.a.O., S. 473
[17] Vgl. ebd., S.474
[18] Vgl. Alemann, Ulrich von: a.a.O., S. 468/469
[19] Vgl. ebd., S. 475
[20] Wolf, Fritz: Alle Politik ist medienvermittelt. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Band 32/1996, S. 30
[21] Vgl. Guggenberger, Bernd: Das Verschwinden der Politik. In: Die Zeit, Nr. 41 vom 7. Oktober 1994, S. 65 f.
[22] Vgl. Alemann, Ulrich von: a.a.O., S. 476
[23] Pfetsch, Barbara: Themenkarrieren und politische Kommunikation. Zum Verhältnis von Politik und Medien bei der Entstehung der politischen Agenda. a.a.O., S. 14
[24] Vgl. Schulz, Winfried: Nachricht. In: Noelle-Neumann, Elisabeth/ Schulz, Winfried/ Wilke, Jürgen (Hrsg.): Fischer Lexikon Publizistik/Massenkommunikation. Fischer Verlag, Frankfurt 1997, S. 331
[25] Vgl. Alemann, Ulrich von: a.a.O., S. 477
[26] Pfetsch, Barbara: Themenkarrieren und politische Kommunikation. Zum Verhältnis von Politik und Medien bei der Entstehung der politischen Agenda. a.a.O., S. 19
[27] Vgl. Alemann, Ulrich von: a.a.O., S. 477/478
[28] Vgl. Alemann, Ulrich von: a.a.O., S. 478
[29] BverfGE 20, S. 174 f.
[30] Vgl. Alemann, Ulrich von: a.a.O., S. 479
[31] Vgl. Jarren, Ottfried: Politik und politische Kommunikation in der modernen Gesellschaft. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Band 39/1994, S. 6
[32] Wolf, Fritz: Alle Politik ist medienvermittelt. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Band 32/1996, S. 29
[33] Vgl. Alemann, Ulrich von: a.a.O., S. 480
[34] Vgl. ebd.
[35] Vgl. Kleinnijenhuis, Jan/ Rietber, Ewald M.: Parties, Media, the Public and the Economy: Patterns of Social Agenda-Setting. a.a.O., S. 114
[36] Vgl. Alemann, Ulrich von: a.a.O., S. 481
[37] ebd.
[38] Vgl. ebd., S. 482
[39] Wolf, Fritz: Alle Politik ist medienvermittelt. a.a.O., S. 31
[40] Vgl. Pfetsch, Barbara: Themenkarrieren und politische Kommunikation. Zum Verhältnis von Politik und Medien bei der Entstehung der politischen Agenda. a.a.O., S. 18
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Einleitung?
Die Einleitung thematisiert das enge Austauschverhältnis zwischen Politik und Medien in demokratischen Systemen, welches von gegenseitiger Abhängigkeit geprägt ist. Es entsteht eine Dreiecksbeziehung zwischen Politikern, Medien und der Bevölkerung, in der jede Partei auf die andere angewiesen ist, um ihre Interessen durchzusetzen. Die Arbeit zielt darauf ab, zu untersuchen, welche gesellschaftlichen Gruppen die politische Agenda bestimmen.
Was ist die "Agenda-Setting"-Forschung?
Die "Agenda-Setting"-Forschung untersucht den Einfluss der Medien auf die öffentliche Meinung und die Relevanz bestimmter Themen. Die Hypothese besagt, dass die Medien beeinflussen, worüber die Menschen nachdenken, indem sie eine Rangordnung von politischen Streitfragen (Issues) vorgeben. Die Forschung untersucht, ob die Medien die öffentliche Wahrnehmung der Wichtigkeit verschiedener Themen beeinflussen.
Was sind die Modelle der Politikvermittlung?
Die Arbeit stellt vier Modelle der Politikvermittlung nach Ulrich von Alemann vor:
- Top-Down-Modell: Parteien und Politiker stehen an erster Stelle und beeinflussen die Medien und das Publikum.
- Mediokratie-Modell: Die Medien diktieren die politische Agenda und beeinflussen Politik und Publikum.
- Bottom-Up-Modell: Das Publikum bestimmt die politische Agenda, indem es Themen über die Medien artikuliert und die Politik beeinflusst.
- Biotop-Modell: Die Beziehungen und Verflechtungen zwischen Parteien, Medien und Publikum werden aufgezeigt.
Was besagt das Top-Down-Modell?
Das Top-Down-Modell besagt, dass Parteien und Politiker die erste und oberste Stufe im politischen Kommunikationsprozess einnehmen. Sie treffen Entscheidungen und beeinflussen die Realität. Diese vermitteln sie dann an die Medien, die diese Informationen an das Publikum weitergeben.
Was besagt das Mediokratie-Modell?
Das Mediokratie-Modell geht davon aus, dass die Massenmedien die öffentliche Meinung beeinflussen und somit die politische Agenda bestimmen. Die Medien nehmen politische Entscheidungen auf und spiegeln sie sowohl auf die Politik als auch auf das Publikum zurück.
Was besagt das Bottom-Up-Modell?
Das Bottom-Up-Modell besagt, dass das Publikum die politische Agenda bestimmt, indem es Themen aus der realen Welt aufgreift und über die Medien artikuliert, um Parteien und Regierungen zu beeinflussen. Die Medien fungieren hier als Vermittler der Anliegen der Bürger.
Was besagt das Biotop-Modell?
Das Biotop-Modell betrachtet die vielfältigen Verflechtungen zwischen Parteien, Medien und Publikum. Es zeigt auf, dass ein enges wechselseitiges Beziehungsgeflecht und symbiotisches Abhängigkeitsverhältnis zwischen Parteien und Medien die politische Agenda bestimmt.
Was ist die Schlussbemerkung?
Die Schlussbemerkung fasst die verschiedenen Modelle der Politikvermittlung zusammen und kommt zu dem Schluss, dass es keine eindeutige Antwort auf die Frage gibt, welche der drei Gruppen die politische Agenda letztendlich bestimmt. Es können lediglich Tendenzen ausgemacht werden, wobei das engste Beziehungsgeflecht zwischen Parteien und Medien liegt.
Welche Literatur wird verwendet?
Es wird ein Literaturverzeichnis mit verschiedenen wissenschaftlichen Quellen angegeben, die für die Analyse verwendet wurden, wie unter anderem Werke von Ulrich von Alemann, Maxwell McCombs, Donald Shaw und Bernard Cohen.
- Quote paper
- Jens Buchwald (Author), 2002, Modelle der Politikvermittlung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108253