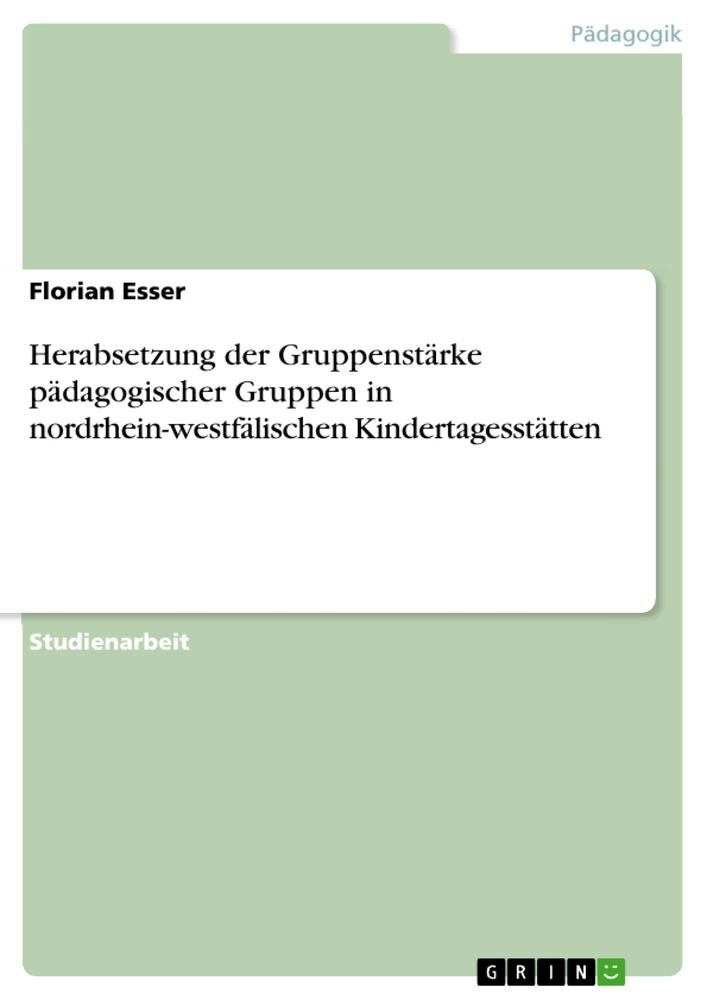Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Gruppenstärke der zu betreuenden Kinder in nordrhein-westfälischen Kindertagesstätten auseinander. Hierbei folgt der Autor der Frage, ob eine Herabsetzung der Gruppengröße bzw. der altersbezogenen Fachkraft-Kind-Relation, eine signifikante Erhöhung der Betreuungsqualität zur Folge hätte. Der Autor klammert in seiner Hypothese den gegenwärtigen Mangel an Betreuungsplätzen bewusst aus und setzt diese als gegeben voraus. Da sein Fokus auf der Strukturqualität der Kindertagesbetreuung und nicht der Infrastruktur außerfamiliärer Betreuungsangebote liegt. Zudem wird der Autor den Status Quo in Sachen Gruppengröße in Augenschein nehmen, hierzu eine wissenschaftliche Einschätzung anführen sowie seinen hypothetischen Lösungsansatz darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Personalschlüssel (auch Fachkraft-Kind-Schlüssel)
- Fachkraft-Kind-Relation
- Rahmenbedingungen
- Gesetzlicher Rahmen
- Struktureller Rahmen
- Situationsanalyse in nordrhein-westfälischen Kindertagesstätten
- Pre-Pandemische Situationsanalyse
- Medio-Pandemische Situationsanalyse
- Gruppengröße reduzieren - eine wissenschaftliche Einschätzung
- Hypothetisches Konzept zur Gruppenreduzierung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gruppengröße in nordrhein-westfälischen Kindertagesstätten. Ziel ist es, herauszufinden, ob eine Reduzierung der Gruppengröße oder der Fachkraft-Kind-Relation zu einer signifikanten Steigerung der Betreuungsqualität führt. Der Autor konzentriert sich dabei auf die Strukturqualität der Kindertagesbetreuung und nicht auf die Infrastruktur der Angebote. Er analysiert den Status Quo, führt eine wissenschaftliche Einschätzung an und stellt einen hypothetischen Lösungsansatz vor.
- Die Bedeutung des Personalschlüssels und der Fachkraft-Kind-Relation für die Qualität der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung.
- Die gesetzlichen und strukturellen Rahmenbedingungen der Kindertagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen.
- Die Auswirkungen von großen Gruppengrößen auf die pädagogische Arbeit, die Entwicklung der Kinder und die Belastung des Fachpersonals.
- Die wissenschaftliche Evidenz für die positive Wirkung kleinerer Gruppen auf die Qualität der Betreuung und die Förderung der Kinder.
- Der Entwurf eines hypothetischen Konzepts zur Reduzierung der Gruppengröße in Kindertagesstätten.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss der Gruppengröße auf die Betreuungsqualität in Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen. Sie skizziert den Fokus auf die Strukturqualität und setzt die Verfügbarkeit von Betreuungsplätzen voraus.
- Begriffsklärung: Das Kapitel erläutert die zentralen Begriffe Personalschlüssel und Fachkraft-Kind-Relation, die für die Bewertung der Betreuungsqualität von großer Bedeutung sind.
- Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel behandelt die rechtlichen Grundlagen der Kindertagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen (KiBiz) und stellt die strukturellen Rahmenbedingungen in NRW dar, die laut Experten verbesserungsbedürftig sind.
- Situationsanalyse in nordrhein-westfälischen Kindertagesstätten: Die Situationsanalyse betrachtet die pre-pandemische und die medio-pandemische Situation in Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen und beleuchtet die Herausforderungen durch ungünstige Personalschlüssel, große Gruppengrößen und die Belastung des Fachpersonals.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die Gruppengröße, die Fachkraft-Kind-Relation, die Betreuungsqualität, die Strukturqualität der Kindertagesbetreuung, die Auswirkungen von großen Gruppengrößen, die wissenschaftliche Evidenz für die positive Wirkung kleinerer Gruppen und ein hypothetisches Konzept zur Reduzierung der Gruppengröße in Kindertagesstätten.
- Arbeit zitieren
- Florian Esser (Autor:in), 2021, Herabsetzung der Gruppenstärke pädagogischer Gruppen in nordrhein-westfälischen Kindertagesstätten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1082569