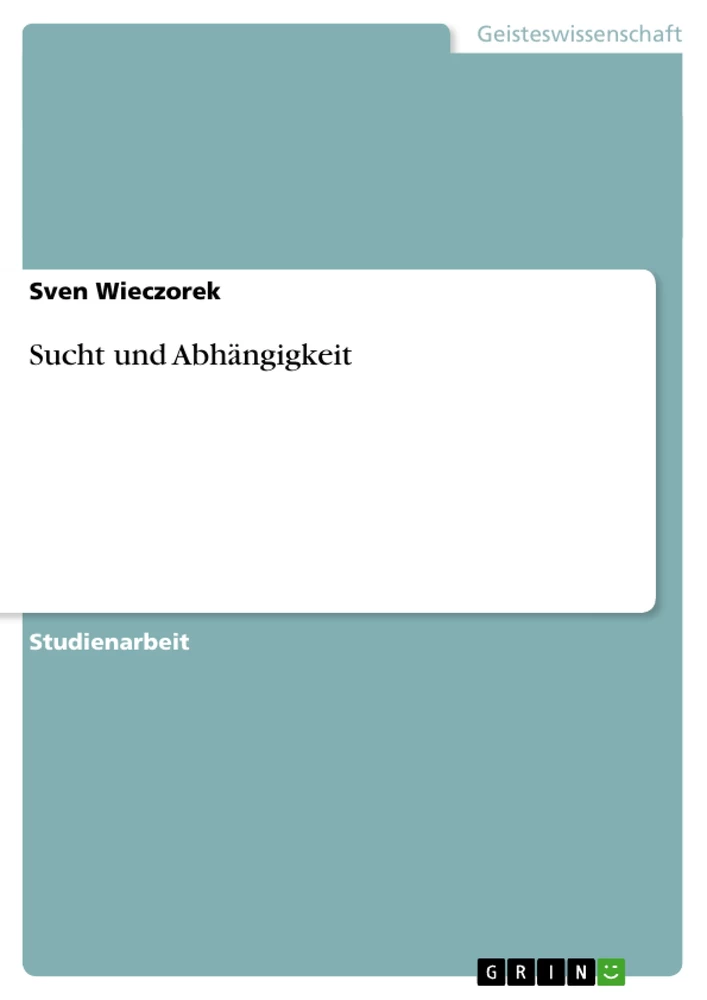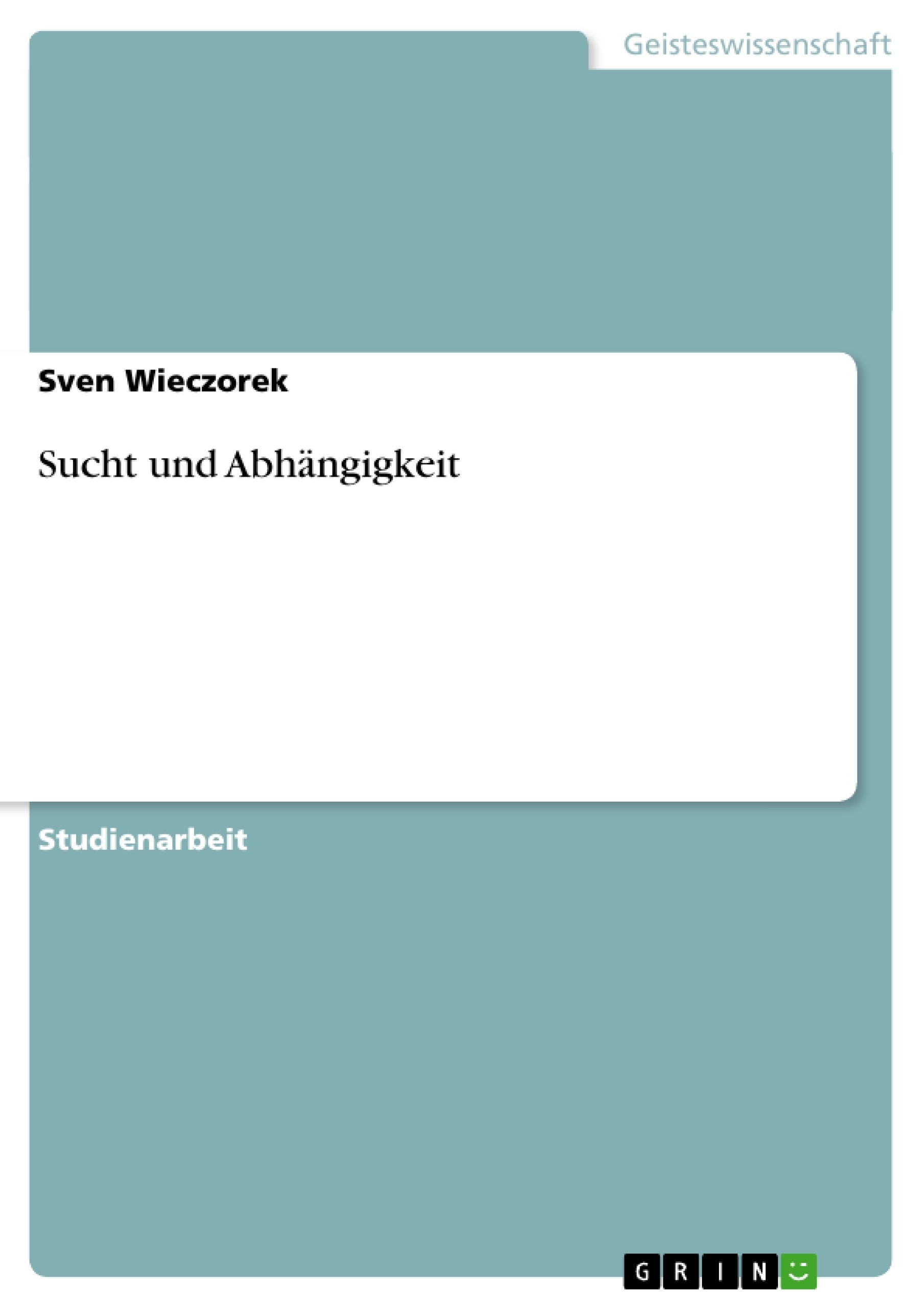Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Fesseln der Sucht allgegenwärtig sind, ein unsichtbarer Feind, der sich in die Tiefen der menschlichen Psyche gräbt. Diese fesselnde Analyse entführt Sie auf eine Reise durch das komplexe Terrain der Abhängigkeit, von ihren historischen Wurzeln in antiken Kulturen bis hin zu den neuesten neurowissenschaftlichen Erkenntnissen über die Mechanismen im Gehirn. Entdecken Sie, wie Substanzen wie Alkohol, Opium, Cannabis, Kokain und Nikotin seit Jahrtausenden die menschliche Erfahrung prägen, und wie sich unsere Definition und unser Verständnis von Sucht im Laufe der Zeit entwickelt haben. Erfahren Sie mehr über die feinen Unterschiede zwischen physischer und psychischer Abhängigkeit, die subtilen Wege, auf denen Drogen in den Körper gelangen, und die verheerenden Auswirkungen, die sie auf Einzelpersonen und Gemeinschaften haben können. Tauchen Sie ein in die Theorien, die versuchen, das Wesen der Abhängigkeit zu erklären, von der klassischen Theorie der physischen Abhängigkeit bis zu den neueren Modellen positiver Verstärkersysteme und der Rolle des mesolimbischen Dopaminsystems. Diese tiefgreifende Untersuchung enthüllt nicht nur die dunkle Seite der Sucht, sondern beleuchtet auch die Hoffnung auf Heilung und die Bedeutung von Empathie und Verständnis im Umgang mit diesem weit verbreiteten Problem. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die die Komplexität der menschlichen Natur und die Herausforderungen des modernen Lebens verstehen wollen, bietet diese Arbeit einen umfassenden Überblick über das Thema Sucht, der sowohl informativ als auch zum Nachdenken anregt und ein tieferes Verständnis für die Betroffenen fördert und neue Perspektiven für Prävention und Behandlung eröffnet. Die Auseinandersetzung mit stoffgebundenen und nicht-stoffgebundenen Süchten, wie beispielsweise der Internetabhängigkeit, verdeutlicht die Allgegenwärtigkeit dieses Problems in unserer heutigen Gesellschaft. Lassen Sie sich von dieser Analyse dazu anregen, die Welt der Sucht mit neuen Augen zu sehen und sich aktiv an der Suche nach Lösungen zu beteiligen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Sucht/Abhängigkeit
2.1. Historisches
2.2. Definition Sucht/Abhängigkeit
2.3. Theorien der Abhängigkeit
2.3.1. Die Theorie der physischen Abhängigkeit
2.3.2. Die Theorie der positiven Verstärkersysteme
2.3.3. Verstärkersysteme im Gehirn
2.3.4. Das mesolimbische Dopaminsystem
2.3.5. Interzelluläre Sensitivierung und Neuroadaptation
2.4. Formen der Abhängigkeit
2.4.1. Stoffungebundene Abhängigkeit
2.4.1.1. Internetabhängigkeit
2.4.2. Stoffgebundene Abhängigkeit
2.4.2.1. Physische Abhängigkeit
2.4.2.2. Psychische Abhängigkeit
2.4.2.3. Drogeneinnahme und Absorption
2.4.2.3.1. Orale Einnahme
2.4.2.3.2. Injektion
2.4.2.3.3. Inhalation
2.4.2.3.4. Absorption durch die Schleimhäute
2.4.2.4. Fünf häufig missbrauchte Drogen
2.4.2.4.1. Tabak/Nikotin
2.4.2.4.2. Alkohol
2.4.2.4.3. Cannabis/Marihuana
2.4.2.4.4. Kokain
2.4.2.4.5. Opiate (Heroin/Morphium)
3. Diskussion
1. Einleitung
Die Sucht, seit Jahrtausenden eine Geißel der Menschheit und doch erst seit wenigen Jahrhunderten erforscht. Man kann sie als eines der größten gesellschaftlichen und gesundheitspolitischen Probleme unserer modernen Kultur bezeichnen. Jeder kann betroffen sein, ohne es zu bemerken. Wir können sogar soweit gehen und behaupten, daß jeder von uns süchtig ist, nur weil er oder sie gesellschaftliche Verpflichtungen wegen einer einzigen Tätigkeit z. B. dem Sport zuliebe, vernachlässigt. Selbst gesetzliche Verbote oder medizinische Intervention haben kaum eine Chance gegen die Sucht. Teilweise verschlimmert sich die Lage dadurch noch. Stattdessen greifen Politiker und der Polizeiapparat immer mehr zu einer Politik der Duldung und Legalisierung durch „kontrollierte Vergabe von Suchtersatzstoffen wie Methadon an Heroinsüchtige“ oder durch Duldung des Besitzes kleiner Mengen Haschisch (Wiesemann, 2000, S. 7).
Das beste Beispiel für diese Art von Politik sind die Niederlande, wo Haschisch in kleinen Mengen frei käuflich ist. Welche Politik die bessere ist, ob strikte Verbote oder Duldung, wird sich erst in ein paar Jahren bis Jahrzehnten abschätzen lassen.
Das Ziel dieser Hausarbeit ist es, dem Leser das sehr weitreichende Thema Sucht in komprimierter Form und doch auf eine verständliche Weise näher zu bringen und ihn ein wenig mehr für die Süchte und die damit entstehenden Probleme seiner Mitmenschen zu sensibilisieren.
2. Sucht/Abhängigkeit
2.1 Historisches
Die Menschen können auf eine lange „Tradition“ von Alkohol- und Drogenkonsum zurückblicken. Man denke da nur an die ausschweifenden Feste und Trinkgelage der Römer, Griechen und Ägypter. Vor 9000 Jahren schon wurde das erste Bier gebraut. Zumindest lässt es sich soweit zurückverfolgen. Viele der heute bekannten Drogen wie Alkohol, Opium, Cannabis oder Tabak wurden schon vor Jahrtausenden konsumiert und wegen ihrer berauschenden Wirkungen geschätzt.
Der Begriff Alkohol, welcher auf das arabische Wort „al-kuhl“ zurückgeht, kann mit
„das Feinste, feines Pulver“ übersetzt werden. So aus dem Spanischen übernommen bezeichnete er ursprünglich die feinen, flüchtigen Bestandteile des Weines. Bereits den Sumerern und Akkadern war der Alkohol bekannt. Im alten Ägypten wurden, laut Aufzeichnungen, Arbeitslöhne in Form von Brot- und Biereinheiten ausgezahlt.
Opium, hergestellt aus dem Schlafmohn (Papaver somniferum L.), soll schon 4000 v. Chr. von den Sumerern und Ägyptern wegen seiner heilsamen und berauschenden Wirkung genutzt worden sein. In China hielt der Schlafmohn nach seiner Kultivierung als Schmerzmittel sogar Einzug in die traditionelle chinesische Medizin.
Cannabis, eine Gattung der Hanfgewächse (Cannabaceae) ist seit Jahrtausenden Nutz- und Heilpflanze. In China wurde Cannabis ab 3000 v. Chr. für die Herstellung von Kleidung und Seilen und seit 2000 v. Chr. auch als Heilpflanze genutzt. In Indien in bestimmte kultische Handlungen einbezogen, etablierte sich Cannabis auch als Rauschmittel.
In Südamerika war der Kokastrauch (Erythrxylon coca) als Rauschmittel bekannt. Vermutlich wurde er seit ca. 2500 v. Chr. als Kulturpflanze angebaut. Das Kauen der unverarbeiteten Kokablätter besitzt immernoch, vor allem in Peru und Bolivien, eine jahrhundertelange Tradition. Als Kokain wird das in den 50er Jahren
erstmals chemisch isolierte, aktive Alkaloid des Kokastrauches bezeichnet und als Mittel gegen Depressionen eingesetzt. 25Jahre nach der Entdeckung wurde Kokain als Getränkezusatz unter dem Namen Coca-Cola als Allheilmittel vermarktet. Ein Liter Coca-Cola enthielt bis 1903 etwa 250mg Kokain!
Die Tabakpflanze (Nicotina tabacum L.) wurde schon vor Jahrhunderten von den amerikanischen Ureinwohnern wegen ihrer berauschenden Wirkung genutzt. Erst im 16. Jahrhundert kam die Tabakpflanze durch spanische Eroberer nach Europa, wo sie erst als Zierpflanze gehalten wurde. Das Schnupfen oder Rauchen ist hier auch erst seit der Mitte des 16. Jahrhunderts bekannt.
Doch wann kam der Begriff der Sucht auf?
Vorformen des Wortes Sucht im gotischen „sauths“, im altnordischen „sots“ und im altfriesischen „secht“ bedeuten alle übereinstimmend Krankheit.
In dieser Bedeutung wurde der Begriff Sucht bis in das 17. Jahrhundert angewandt.
Der Begriff Sucht selbst geht auf das griechische Wort „siech“ zurück und bedeutet krank. Erst Mitte des 18. Jahrhunderts wurde der Begriff Sucht direkt mit körperlichen Leiden in Verbindung gebracht. Bei Krankheiten wie Gelbsucht oder Schwindsucht hat sich diese Begriffsverschmelzung bis heute gehalten. Neben der Krankheitsbedeutung im eigentlichen Sinne wurde die Sucht auch in Ausdrücken wie Schlafsucht, Gewinnsucht oder Rachsucht verwendet. Damit wurde ein krankhaft übersteigerter Trieb, ohne Aussicht auf Heilung, beschrieben. Einen solchen krankhaften Trieb beschrieben ab dem 18. Jahrhundert Begriffe wie Opiumsucht oder Trunksucht.
2.2 Definition Sucht/Abhängigkeit
Diese Begriffe waren aber noch sehr vieldeutig. Aus diesem Grund wurde es ab dem 20. Jahrhundert immer wichtiger, den Sinngehalt des Wortes Sucht eindeutiger festzulegen. Dieses wurde von der WHO (World Health Organisation) mehrfach versucht.
Der Begriff Sucht wurde 1957 von der WHO definiert als „ein Stadium chronischer oder periodischer Berauschung durch die wiederholte Einnahme einer natürlichen oder synthetischen Droge.“
Diese Definition beinhaltet:
- den überwältigenden Wunsch oder das Bedürfnis, die Droge immer wieder zu sich zunehmen und sich die Droge unter allen Umständen zu beschaffen
- die Tendenz, die Dosis der Droge zu erhöhen
- die psychische und/oder eine physische Abhängigkeit von den Wirkungen der Droge
- eine zerstörerische Wirkung auf die Person und die Gesellschaft (Wiesemann, 2000, S. 43)
Dabei wurde unterschieden zwischen der „minderschweren Gewöhnung“ ohne Zwang zur Einnahme, allenfalls mit geringer Tendenz zur Steigerung der Dosis der Droge und zwischen „schwerwiegender Sucht“ mit Zwang zur Einnahme und der Tendenz zur Steigerung der Dosis der Droge. Diese Definition war jedoch sehr unspezifisch und schloss nur die Gruppe der stoffgebundenen Süchte ein. Ebenso wurde von der WHO beklagt, dass die Begriffe Sucht und Gewöhnung sich im allgemeinen Sprachgebrauch sehr stark verwischen und auf alle
möglichen Arten des Missbrauchs von Substanzen gemeinsam angewendet würden. Durch die immer lauter werdende Kritik von Psychologen und Soziologen an diesem einseitig, biologisch ausgerichtetem Suchtmodell wurde in den 60er Jahren eine 2. Definitionsphase durch die WHO eingeleitet.
1964 wurde dann von der WHO der Begriff der Abhängigkeit eingeführt. Dieser ließ sich sowohl biologisch als auch gesellschaftlich interpretieren. Dadurch wurden unangenehme Fragen, wie die nach der Grenze zwischen der schwerwiegenden Sucht und der harmlosen Gewöhnung, welchen sich die WHO gegenüber sah, fast gänzlich ausgeschlossen.
Die WHO definiert Abhängigkeit als „einen Zustand (physisch oder psychisch), der aus der Wechselwirkung eines Stoffes mit dem Organismus entsteht und durch Verhaltens- und andere Reaktionen charakterisiert ist.“ (http://smilewski.bei.t-online.de/html/body_suchtdefinition.html)
Laut ICD10 (Internationale Klassifikation psychischer Störungen) ist jemand abhängig, wenn mindestens drei oder mehr der folgenden Kriterien während des letztens Jahres gleichzeitig vorhanden waren:
- „ein starker Wunsch oder ein Zwang, ein Suchtmittel zu konsumieren“
- „verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge des Konsums des Suchtmittels“
- „ein körperliches Entzugssyndrom bei Beendigung oder Reduktion des Konsums“
- „Nachweis einer Toleranz: Um die ursprünglich durch niedrige Mengen erreichte Wirkung hervorzurufen sind zunehmend höhere Mengen erforderlich“
- „Fortschreitende Vernachlässigung anderer Interessen und Vergnügen zugunsten des Suchtmittelkonsums und/oder erhöhter Zeitaufwand, um die Substanz zu beschaffen, zu konsumieren oder sich von den Folgen zu erholen“
- „Anhaltender Substanzgebrauch trotz des Nachweises eindeutiger schädlicher Folgen (körperlicher, psychischer oder sozialer Art)“
(http://www.api.or.at/akis/texte/002/icd10.htm)
2.3 Theorien der Abhängigkeit
Der Begriff Abhängigkeit hat sich bis heute in der Medizin etabliert und stellt die offizielle Bezeichnung für Suchterscheinungen dar.
In der biologischen Psychologie wird dabei von zwei Theorien ausgegangen, die beide gegensätzlicher Natur sind, die Theorie der physischen Abhängigkeit und die Theorie der positiven Verstärkersysteme.
Beide möchte ich hier kurz vorstellen.
2.3.1 Die Theorie der physischen Abhängigkeit
Die Theorie der physischen Abhängigkeit stellt die ersten Erklärungsversuche für die Drogensucht dar.
Sie besagt, dass Drogenkonsumenten physisch abhängig werden, wenn sie hohe Dosen der Droge konsumieren. Entzugserscheinungen die auftraten, wenn die Droge nicht eingenommen wurde, zwangen dann zur wiederholten Einnahme.
Aus diesem Grund versuchten die ersten Suchttherapieprogramme in Krankenhäusern den Süchtigen die Droge langsam zu entziehen. Das brachte den Vorteil, dass die Entzugserscheinungen, im Gegensatz zum sofortigen Entzug, weniger schlimm waren. Aber fast alle der so therapierten Patienten fielen wieder in ihre alten Gewohnheiten zurück und konsumierten die Droge weiter. Das hatte zwei Gründe. Bei stark süchtig machenden Drogen wie Heroin oder Kokain gibt es keine schmerzhaften Entzugserscheinungen (Gawin, 1991). Der zweite Grund ist, dass bei vielen Süchtigen die Einnahmegewohnheit „ein ständiges Auf und Ab von Orgie und Entzug ist“ (Mello und Mendelson, 1972). Einerseits fehlt das Geld zum Drogenkauf und andererseits passen die Drogenexzesse am Wochenende gut zum Arbeitsalltag in der Woche.
Bei heutigen Theorien der physischen Abhängigkeit wird versucht, den Rückfall nach einer längeren Periode ohne die Droge mit einzubinden (Koob et al., 1993).
Das geht darauf zurück, dass konditionierte Entzugserscheinungen durch Umweltreize ausgelöst werden, wenn ein Süchtiger eine Situation erlebt, in der zuvor die Droge erlebt wurde.
„Die Theorie, dass ein Rückfall in erster Linie aus einem Versuch heraus entsteht, konditionierten Entzugserscheinungen entgegenzuwirken, muss sich zwei wesentlichen Problemen stellen.“ (Pinel, 1997, S. 357)
Das erste Problem geht davon aus, dass die situationsbedingten Effekte denen der Droge ähnlich sind. Süchtige bevorzugen auch häufig auf Drogen schließende Situationen und konsumieren trotzdem keine Drogen. Aus diesem Grund ist es eher unwahrscheinlich, dass konditionierte Entzugserscheinungen der Hauptgrund für einen Rückfall sein könnten.
2.3.2 Die Theorie der positiven Verstärkersysteme
Das Scheitern der Theorie der physischen Abhängigkeit machte dann den Weg frei für die Theorie der positiven Verstärkersysteme. Sie besagt, das die durch den Drogenkonsum entstehenden angenehmen Effekte der Hauptgrund für den Drogenkonsum sind und nicht die Vermeidung von Entzugserscheinungen, die aber trotzdem mit in Betracht gezogen werden.
Angenehme Effekte sind z B. ansonsten gehemmte Verhaltensweisen, die beim Drogenkonsum ungehemmt ausgelebt, positiv belohnt werden. Dieser Effekt wirkt indirekt, das heißt, die Person fühlt sich gut bei dem, was sie tut, obwohl es keinen Belohnungseffekt durch positive Verstärkung im eigentlichen Sinne gibt. Besonders am Anfang der Abhängigkeit stellt dies einen wichtigen verstärkenden Faktor dar. Die positive Verstärkung nimmt mit dem Rauschmittelkonsum zu.
Dazu gibt es zwei interessante Theorien. Die erste besagt, dass die positive Verstärkung zunimmt, weil die konditionierte Toleranz gegenüber den schädigenden Auswirkungen der Droge stärker entwickelt ist, als gegenüber den angenehmen Effekten (Krank, 1989; Tabakoff und Hoffmann, 1988).
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Dieses Dokument behandelt das Thema Sucht/Abhängigkeit, einschließlich Definitionen, Theorien, Formen und historischer Hintergründe.
Welche historischen Aspekte der Sucht werden behandelt?
Das Dokument geht auf die lange Tradition des Alkohol- und Drogenkonsums in verschiedenen Kulturen zurück, beginnend mit den Römern, Griechen und Ägyptern. Es werden auch die Ursprünge von Begriffen wie Alkohol und die Verwendung von Substanzen wie Opium, Cannabis und Tabak in der Antike erläutert.
Wie definiert die WHO Sucht und Abhängigkeit?
Die WHO definierte Sucht 1957 als einen Zustand chronischer oder periodischer Berauschung durch wiederholte Einnahme einer Droge, gekennzeichnet durch den Wunsch nach der Droge, die Tendenz zur Dosiserhöhung und zerstörerische Wirkungen. Der Begriff Abhängigkeit wurde 1964 eingeführt und als ein Zustand definiert, der aus der Wechselwirkung eines Stoffes mit dem Organismus entsteht und durch Verhaltensreaktionen charakterisiert ist.
Welche Kriterien werden laut ICD10 für eine Abhängigkeit angeführt?
Laut ICD10 liegen Abhängigkeit vor, wenn mindestens drei der folgenden Kriterien im letzten Jahr gleichzeitig vorhanden waren: starker Wunsch oder Zwang zum Konsum, verminderte Kontrollfähigkeit, körperliches Entzugssyndrom, Toleranzentwicklung, Vernachlässigung anderer Interessen und anhaltender Gebrauch trotz schädlicher Folgen.
Welche Theorien der Abhängigkeit werden in diesem Dokument behandelt?
Es werden zwei Haupttheorien der Abhängigkeit in der biologischen Psychologie vorgestellt: die Theorie der physischen Abhängigkeit und die Theorie der positiven Verstärkersysteme.
Was besagt die Theorie der physischen Abhängigkeit?
Die Theorie der physischen Abhängigkeit besagt, dass Drogenkonsumenten physisch abhängig werden, wenn sie hohe Dosen der Droge konsumieren. Entzugserscheinungen führen dann zur wiederholten Einnahme.
Was ist die Theorie der positiven Verstärkersysteme?
Die Theorie der positiven Verstärkersysteme besagt, dass die durch den Drogenkonsum entstehenden angenehmen Effekte der Hauptgrund für den Drogenkonsum sind.
Welche Formen der Abhängigkeit werden genannt?
Das Dokument unterscheidet zwischen stoffungebundener Abhängigkeit (z.B. Internetabhängigkeit) und stoffgebundener Abhängigkeit (z.B. Tabak/Nikotin, Alkohol, Cannabis/Marihuana, Kokain, Opiate).
Welche Einnahmemethoden von Drogen werden erwähnt?
Das Dokument erwähnt verschiedene Einnahmemethoden wie orale Einnahme, Injektion, Inhalation und Absorption durch die Schleimhäute.
Welche Substanzen werden als häufig missbrauchte Drogen genannt?
Tabak/Nikotin, Alkohol, Cannabis/Marihuana, Kokain und Opiate (Heroin/Morphium) werden als häufig missbrauchte Drogen genannt.
- Citar trabajo
- Sven Wieczorek (Autor), 2003, Sucht und Abhängigkeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108351