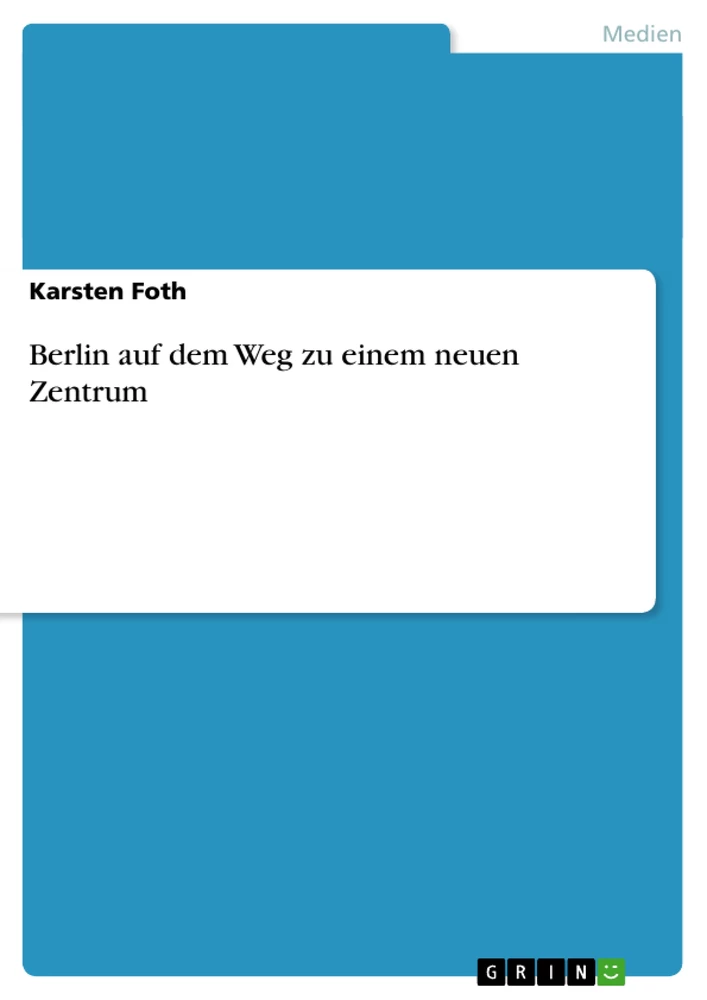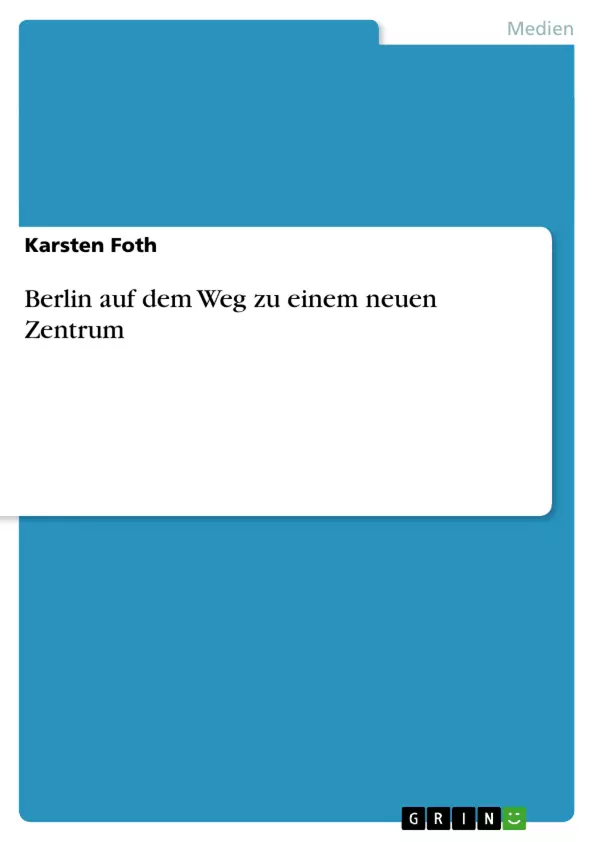„Berlin auf dem Wege zu einem neuen Zentrum“
Ein Gedankenpapier
Kaum eine Diskussion beherrscht nun schon über Jahre hinweg die Berliner Öffentlichkeit so sehr wie die über den Status der Stadt und die Suche nach dem Zentrum Berlins. Gerade bei Großveranstaltungen wie der Berlinale oder diversen Filmpreisverleihungen lassen die Medien stets Fragen nach Glimmer, weltstädtischem Flair und Metropolengröße mitschwingen. Die Befragten, egal ob Passanten oder Prominenz, antworten bereitwillig und fordern weltstädtische Offenheit, Hochhäuser und vor allem ein Zentrum, wo sich Tag und Nacht das urbane Leben tummelt. Oft kommen die Vergleiche mit Amsterdam, London und zuweilen sogar Düsseldorf, wo zumindest in der Nacht ein eindeutiges Zentrum wahrnehmbar ist. Selbst das politische Zentrum, das Berlin durch seine Rolle als Bundeshauptstadt innehat wird in Frage gestellt und zwar spätestens dann, wenn man in den südlichen Bundesländern im Zuge des Länderfinanzausgleichs und der Sonderzuwendungen zweifelt, wozu man eigentlich so eine Hauptstadt im entfernten Preußen braucht? Bemerkenswert ist aber vor allem eines: egal wo das Thema auch ansetzt, ob örtlich beim neuen „Einkaufszentrum“ am Potsdamer Platz, der förderungsbedürftigen City-West oder der High-Budget-Shoppingmeile Friedrichsstraße oder einfach bei der leicht griesgrämigen Mentalität der Berliner, am Ende steht immer ein Punkt im Zentrum der Diskussion – der Schlossplatz. Das seit nunmehr zwölf Jahren mehr oder weniger brachstehende Areal auf der Spreeinsel scheint so was wie die städtebauliche Achillesferse der Berliner Innenstadt zu sein und „wenn hier erst mal alles wieder in Ordnung ist, hat nicht nur Berlin sein Herz wieder, sondern Deutschland auch sein Zentrum und die Berliner werden wieder glücklich und zufrieden sein!“
Angesichts solcher Bewegungen und Meinungen scheint es sinnvoll zu sein, sich fachlich tiefer und fundierter mit diesem Thema auseinander zu setzen. So geschehen in der Seminarreihe der Planungs- und Architektursoziologie „Berlin auf dem Wege zu einem neuen Zentrum“ an der Technischen Universität Berlin, auf welchem dieses Exposé basiert. Unter der Betreuung von Herrn Prof. Harald Bodenschatz befassten sich im Wintersemester 2001/2002 Studenten der Architektur und der Stadtplanung mit den Fragestellungen nach den Nutzungen, der Bewertung und der Wahrnehmung der Innenstadt bzw. der verschiedenen Zentren und was überhaupt ein Großstadtzentrum ausmacht? Diskutiert wurden auch die verschiedenen Nebenzentren, die zahlreichen Konflikte vor allem in den 90er Jahren und die geschichtliche Entwicklung. Schon dabei offenbarten sich interessante Besonderheiten.
Bereits um 1400 hatte Berlin als relativ unbedeutende Stadt kein eindeutiges Zentrum im Sinne eines einzigen zentralen Platzes; die drei wichtigsten Funktionen (Rathaus, Kirche und Markt) waren auf drei Plätze verteilt. Diese Besonderheit der Polyzentralität hatte seinen Anfang also schon im Mittelalter und sollte sich durch alle folgenden geschichtlichen Epochen ziehen. Mit der Monarchie und dem Barock begann die Herausbildung von repräsentativen Orten und der Ausbau der Dorotheen- und der Friedrichsstadt war der Beginn der Verlagerung nach Westen. Hier war vor allem die Aufsplittung der Funktionen bemerkenswert: während in der Altstadt im Osten eher städtische und bürgerliche Einrichtungen vorhanden waren, zog es die Herrschaftlichkeit, das Repräsentative, die Politik und den Reichtum nach Westen. Im 19. Jahrhundert wurde dieser Drang zur Polyzentralität vor allem durch die Entstehung der Eisenbahn mit der Herausbildung von Bahnhöfen als neue Tore zur Stadt sowie die Entwicklungen der umliegenden Städte und Gemeinden auf eine andere Ebene transformiert. Gleichzeitig vollzogen sich in der Stadt neuere Nutzungswanderungen, wie z.B. die vom produzierendem Gewerbe an den Stadtrand und darüber hinaus. Somit wurde auch das Umland immer mehr beeinflusst, wobei sich erhebliche Unterschiede heraus kristallisierten. Damit einher ging auch die größte Stadterweiterung bis dato. Auf den eher technischen Plänen von James Hobrecht basierend, charakterisiert der wilhelminische Gürtel aus dem letzten Drittel des 19. Jhrdt. schon allein städtebaulich die Nutzungs- und Imagegegensätze, z.B. dadurch dass es im reicheren Westen und Süden viel mehr Stadtplätze als in den Arbeitergegenden im Norden und Osten gibt. Durch die Stadterweiterungen wurden die Innenstädte allein durch ihr Alter schon automatisch zu Zentren definiert und übernahmen neue Aufgaben. Fast ausschließlich während dieser Kaiserzeit kristallisierten sich die noch heute wichtigsten zentralen Plätze für das städtische Leben heraus. Die bedeutendsten sind der Alexanderplatz im Osten und der Bereich Leipziger Straße / Leipziger Platz / Potsdamer Platz im Westen. Nahezu einmalig unter den europäischen Großstädten ist die Herausbildung eines völlig neuen zweiten Zentrums um den Zoologischen Garten herum, wo zu Fontanes Zeiten gerade mal einzelne dörfliche Bebauung vorhanden war, nun aber durch das KaDeWe und sein Umfeld ein bürgerlicher Gegenpol zur monarchischen Mitte entstand.
Bis zu diesem Punkt war aber die Funktionsmischung immer noch ein wichtiges Merkmal der Innenstadtlagen und eine Diskrepanz zu den Außenbezirken hielt sich in Grenzen. Der große Bruch folgte in der Zeit der Weimarer Republik und danach. Mit fortschreitender Funktionstrennung definierte sich die Innenstadt nun vorrangig durch einen geringen Wohnanteil. Der Alex etablierte sich als erster reiner Angestelltenplatz, der Fehrbelliner Platz im Westteil wurde zum Verwaltungszentrum, die Unterzentren der Außenlagen gewannen immer mehr an Bedeutung und der Anteil der Wohnungen in der Innenstadt nahm stetig ab. Die beiden wichtigsten Umstände für die besondere Entwicklung der Stadt und des Zentrums sollten aber erst folgen: die weitläufige Zerstörung der Innenstadt während des zweiten Weltkrieges und die Teilung der Stadt bis 1989. Wie sich eine durch Kriegszerstörungen gezeichnete Stadt unter „normalen“ Bedingungen entwickeln kann zeigt Warschau, wo durch viel Engagement die historische Mitte zumindest nach Außen hin in den 50er Jahren wieder aufgebaut wurde. In Ostberlin wurde mit dem Forum Friedericianum ähnliche Anfänge gemacht, jedoch ging man in der Stadtentwicklung geteilte Wege und das „Politikum Berlin“ wurde auf beiden Seiten der Mauer auch städtebaulich erfahrbar. Mit Meilensteinen wie der Karl-Marx-Allee angefangen brachte die DDR Stadtplanung vor allem eins mit sich – die fast völlige Abkehr des alten Stadtgrundrisses (was zuvor jahrelang von vielen Planern sogar gefordert wurde) mit Ausnahme vielleicht der Friedrichstadt. Das Schaffen eines politischen Zentrums für einen sozialistischen deutschen Staat stellte sich allerdings als recht schwierig und langwierig dar und war mehreren ideologischen Veränderungen unterworfen. Erst Mitte der 70er Jahre präsentierte sich der zentrale Bereich der Hauptstadt der DDR: vom Alex über den Fernsehturm und das Marx-Engels-Forum bis hin zum politischen Forum aus Palast der Republik, Staatsratsgebäude und Außenministerium. Doch schon in den 80ern kehrte man sich von diesem Ost-Städtebau wieder ab; die Hinterlassenschaften aus dieser Zeit sind die Bereiche an der Wilhelms- und der Friedrichstraße und das wiedererbaute Nikolaiviertel an historischer Stelle. Auch im Westteil gestaltete sich die Frage nach dem Zentrum schwierig. Zunächst hieß es mit „demokratischer Architektur“ wie dem Hansaviertel der IBA 57 oder der Ernst-Reuter-Siedlung Zeichen zu setzen. Offiziell konnte man ja auch gar kein eigenes Zentrum für Westberlin proklamieren weil man ja dadurch indirekt die Existenz des anderen Berlins zugeben würde. Faktisch etablierten sich der Fehrbelliner Platz als Verwaltungs- und die Schlossstraße in Steglitz als Geschäftszentrum fast automatisch und auch die Unterzentren wie z.B. die Karl-Marx-Straße, die Wilmersdorfer Straße oder die Altstadt Spandau erfüllten ihre Aufgaben im städtischen Leben der Westberliner. Erst spät begann man eine eigene Innenstadt hervorheben zu wollen, den Bereich am Bahnhof Zoo. Nur waren dort kaum Zentrumsfunktionen ansässig, so dass durch viel Anstrengung und vor allem Öffentlichkeitsarbeit der Ku-Damm und der Breitscheidplatz zu dem Zentrum der Stadt hochstilisiert wurden. Durch Kunst, Kommerz und den Mercedesstern auf dem Europacenter wurde somit vor allem nach außen hin das neue Westberlin publiziert. Die einst so zentralen Orte Pariser und Potsdamer Platz lagen ohnehin im Niemandsland und somit fast gänzlich brach.
War dieser lange Rückblick in die Geschichte zum Verständnis der Ereignisse in den 90er Jahren wirklich notwendig? Schon, denn er bildet sozusagen die Grundlage für die angestrebte städtebauliche Zusammenfügung der Stadthälften und den Ausbau zur Bundeshauptstadt und Global-City – allerdings eher dahingehend, dass man diese Grundlage entweder gar nicht oder nur als scheinheilige Begründung für etwaige Projekte heranzog. So preiswert und in dieser Größe wie am Potsdamer Platz findet man als Großkonzern in solch zentraler Innenstadtlage in Europa kein zweites Bauland mehr. Die Geschichte wird mit der Andeutung historischer Straßenführungen wie der Alten Potsdamer oder der Bellevuestraße und dem Teilerhalt des Kaisersaal eher schlecht kopiert, sehr wichtig war aber der Hinweis auf die herausragende Bedeutung des Platzes in den Vorkriegsjahren, womit sich die riesigen Ausmaße dieses neuen Zentrums gut legitimieren ließen. Durch großangelegte Öffentlichkeitsarbeit hat sich mittlerweile der Markenname „Potsdamer Platz“ für ein ganzes Gebiet etabliert – fraglich bleibt nur, was dieses Ensemble mit Berlin zu tun hat und ob es ein wahres Zentrum ist. Ein zweites Beispiel ist die „Unter den Linden“ und der „Pariser Platz“. Mit viel Druck galt es „die gute Stube der Stadt“ originalgetreu wieder herzustellen. Mit den streng gehaltenen Maßen der Bauten können die Investoren aber ganz gut leben, bieten sie doch sehr gute Vorraussetzungen für eine sehr gewinnbringende Vermarktung auf dem Immobilienbereich. Jedenfalls sehr viel bessere als durch reinen, und dann vielleicht auch noch sozialen Wohnungsbau wie er zu DDR-Zeiten gleich nebenan in der Wilhelmstraße gebaut wurde. Geplant war dieser auch in der Friedrichstraße, doch hier hat der Metropolenwahn mit seiner Orientierung in Richtung Geld in den neunziger Jahren sehr schnell zugeschlagen. Mit aus heutiger Sicht zweifelhaften Konzeptionen wie den Friedrichstadtpassagen konnte hier durch Umgehen einiger stadtplanerischer und bürokratischer Instanzen die Geschäftsstraße in Nord-Süd-Richtung wieder aufgebaut werden. Es gab allerdings so eine Nord-Süd-Achse nie, immer nur die besagten Ost-West-Straßen mit der Friedrichstraße als Verbindung. Soviel also zum Thema Aufbau durch Wiederherstellung der alten Mitte. Besonders bemerkenswert bei all diesen Projekten ist aber die Verdrängung der Berliner. In den sowieso recht schlecht vermarkteten Wohnungen in den besagten Gebieten wohnt, wenn überhaupt jemand, jedenfalls nicht die alteingesessene Berliner Klientel und inwiefern sie auch von ihr und nicht nur von den Touristen als Zentrum wahrgenommen werden ist fraglich. Bestes Beispiel dafür ist die Oranienburger Straße. Als wahres Zentrum der Alternative haben die dortigen Bewegungen selbst den Investorenstrom angezogen, der mittlerweile die Szene wieder verdrängt hat. Es tummelt sich zwar immer noch das nächtliche Leben dort, aber eben nicht mehr geprägt durch die eigentlichen Berliner sondern bevölkert von durch Reiseführer darauf aufmerksam gemachte Touristen. Immer noch eine Besonderheit stellt nach wie vor der Bereich am Bahnhof Zoo dar. Nachdem der hochstilisierte Status nach dem Mauerfall wegfiel, sah es zunächst danach aus, als wenn Ku-Damm und Co. den neuen aufstrebenden Zentren im Osten nichts entgegenzusetzen werden haben. Anziehungspunkte wie die Filmfestspiele oder das Casino wanderten ab. Als Erinnerung daran, dass das Gebiet trotzdem noch was zu bieten hat, wurde nach Außen der Name „City West“ publiziert. Mittlerweile hat sich aber die Struktur des Gebiets durchgesetzt und neben den Funktionen als ein zentraler Verkehrsumschlagplatz und eher ungewollten Zentrumsnutzungen zieht es auch wieder Investitionen überregionaler Bedeutung an. Ein großes Rückrad ist aber vor allem das hohe Wohnaufkommen im unmittelbaren Einzugsbereich, wodurch langzeitlich die vorhandenen, wenn auch etwas minderwertigeren Zentrumsangebote von Einheimischen genutzt werden. Die City-West ist dadurch jedenfalls Berlintypischer als so mancher Bereich in Mitte. Ebenfalls typisch für das Berlin nach der Wiedervereinigung ist auch die besagte Diskussion um den Schlossplatz. Ein Kuriosum für wahr: die alltäglichen Zentren der Bevölkerung sind die Ortszentren und Kieze, vielleicht noch die Kinocenter – die Emotionen hängen aber an diesen einem Platz. Zwar ist es richtig, dass die Museumsinsel wohl der einzige zentrale Bereich Berlins mit Weltgeltung ist, doch die Intensität und die Ebene der Debatten ist doch recht überhöht. Hier wird ein einziger Ort in seiner (zukünftigen) Bedeutung nicht nur für die Stadt sondern für ganz Deutschland derart hochgeschraubt, dass jeglicher Konsens unmöglich scheint. Dabei hatte dieser Platz eigentlich nie diese große Bedeutung, wie sie ihm heute vor allem von Schlossbefürwortern oft gern zugesprochen wird. Auch städtebaulich stellte das Schloss eher kaum das Herz der Barocken Stadt und der Museumsinsel dar und selbst Schinkel hatte seine Probleme mit dem Bau. Eine wahre Zentrumsrolle für das Volk spielte aber der Palast der Republik und es bleibt zu hoffen, dass bei allen noch folgenden Diskussionen dieser Aspekt der Nutzung durchsetzen wird und der Palast nicht nur als letzte ideologische Barriere des Ost-Städtebaus für den ausufernden Westen beseitigt werden muss. Dieses dogmatische Infragestellen der Ostarchitektur wie es z.B. auch im Planwerk Innenstadt stattfand ist nämlich auch eher hinderlich und gefährdet teilweise gute städtebauliche Lösungen und die Besonderheit der Berliner Vielfalt. In ihr sollte man auch eher einen Vorteil sehen als ständig zu versuchen das Zentrum herauszuputzen und dabei die lebendigen Unterzentren, die Wohnquartiere und die ganzstädtische soziale Infrastruktur zu vernachlässigen.
Der wichtigste Punkt bei aller Diskussion um Investoren, Weltbedeutung, Wirtschaftswachstum und Glimmer scheint mir doch eher die Bevölkerung zu sein. Ein Großstadtzentrum zeichnet sich doch nicht durch eine Masse an Sehenswürdigkeiten, monumentalen Bauwerken und Einrichtungen, die von Touristen bestaunt werden, aus, sondern vor allem auch durch die Frequentierung durch die eigene Bevölkerung. Da dies in den letzten zehn Jahren eher vernachlässigt wurde, sollte es bei noch anstehenden Entwicklungen umso mehr berücksichtigt werden. Und zwar sowohl beim Schlossplatz als auch einem Bereich, der bis jetzt weder in diesem Exposé noch in besagtem Seminar angesprochen wurde: dem Regierungsviertel. Mit dem Reichstag ist es gut gelungen, einen Ort zu etablieren, der auch von den Berliner als Zentrum wahrgenommen wird und wo man auch gerne öfter hingeht um z.B. seinen Gästen sein Berlin zu zeigen. Leider bleibt der Bau eines Bürgerzentrums nun aus und auch städtebaulich wird der vollendete Bereich vom Band des Bundes zum Lehrter Bahnhof wenig Raum für die Wahrnehmung eines Mittelpunktes bieten. Trotzdem lege ich einige Hoffnungen auf die Vollendung des Bereiches, allerdings auf einer etwas anderen Ebene als es die Politiker und Bauherren tun. Wenn sich dann später wirklich Leute, ob Berliner oder Gäste, Alt oder Jung, nach dem Besuch des Reichstages oder dem Flanieren auf den Linden am Ufer der Spree an dieser Treppe des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses treffen, ist das auch eine nicht zu unterschätzende Qualität. Noch besser wäre es aber, wenn wie in den 80er Jahren auf dem Platz der Republik wieder Fußball gespielt, sich relaxed oder Konzerten gelauscht werden würde. Wenn das nach Beendigung der dortigen Bauarbeiten wirklich passiert und sich der Tiergarten wieder bis Reichstag und Kanzleramt ausdehnt, gäbe es wieder ein weiteres Berliner Unikum, welches den Ruf nach dem Zentrum vielleicht etwas verhallen lässt und die Lebensqualität mehr in den Vordergrund rückt.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text „Berlin auf dem Wege zu einem neuen Zentrum“?
Der Text ist ein Gedankenpapier, das sich mit der Frage nach dem Zentrum Berlins auseinandersetzt. Er untersucht die Diskussionen über den Status der Stadt, die Suche nach einem zentralen Ort und die Wahrnehmung Berlins als Metropole.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die folgenden Themen: die Suche nach dem Zentrum Berlins, die Polyzentralität der Stadt seit dem Mittelalter, die historische Entwicklung der verschiedenen Zentren, die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs und der Teilung der Stadt, die städtebauliche Entwicklung nach der Wiedervereinigung und die Rolle von Großprojekten wie dem Potsdamer Platz und dem Schlossplatz.
Welche historischen Epochen werden im Zusammenhang mit der Zentrumsfrage betrachtet?
Der Text betrachtet die Entwicklung Berlins und seiner Zentren vom Mittelalter über die Monarchie, das 19. Jahrhundert, die Weimarer Republik, die Zeit des Nationalsozialismus, die Teilung der Stadt bis zur Wiedervereinigung und der Gegenwart.
Welche Rolle spielt die Polyzentralität in der Entwicklung Berlins?
Die Polyzentralität, also das Vorhandensein mehrerer Zentren, wird als ein prägendes Merkmal der Stadt seit dem Mittelalter dargestellt. Die wichtigsten Funktionen waren von Beginn an auf unterschiedliche Plätze verteilt.
Welche Auswirkungen hatten der Zweite Weltkrieg und die Teilung der Stadt auf die Zentrumsfrage?
Der Zweite Weltkrieg und die Teilung der Stadt führten zu erheblichen Zerstörungen und einer getrennten Entwicklung in Ost- und Westberlin. In Ostberlin wurde ein politisches Zentrum geschaffen, während in Westberlin der Bereich um den Bahnhof Zoo zum Zentrum hochstilisiert wurde.
Wie werden die Großprojekte Potsdamer Platz und Schlossplatz im Zusammenhang mit der Zentrumsfrage diskutiert?
Der Potsdamer Platz wird als Beispiel für eine fragwürdige Entwicklung dargestellt, bei der kommerzielle Interessen über die Bedürfnisse der Bevölkerung gestellt wurden. Der Schlossplatz wird als ein Ort mit überhöhter Bedeutung diskutiert, dessen Wiederaufbau kontroverse Meinungen hervorruft.
Welche Bedeutung hat die Bevölkerung für ein Großstadtzentrum?
Der Text betont, dass ein Großstadtzentrum nicht nur durch Sehenswürdigkeiten und monumentale Bauwerke geprägt ist, sondern vor allem durch die Frequentierung durch die eigene Bevölkerung.
Welche Rolle spielt das Regierungsviertel im Zusammenhang mit der Zentrumsfrage?
Der Text sieht im Reichstag einen Ort, der von den Berlinern als Zentrum wahrgenommen wird. Er hofft, dass das vollendete Regierungsviertel trotz einiger Kritikpunkte ebenfalls zu einem Anziehungspunkt für die Bevölkerung wird.
Welche Kritikpunkte werden an der Stadtentwicklung nach der Wiedervereinigung geäußert?
Der Text kritisiert die Verdrängung der Berliner durch Investorenprojekte, die Orientierung am Geld und die Vernachlässigung der sozialen Infrastruktur.
Was ist das Fazit des Textes in Bezug auf die Suche nach dem Zentrum Berlins?
Der Text plädiert dafür, bei der Stadtentwicklung die Bedürfnisse der Bevölkerung stärker zu berücksichtigen und die lebendigen Unterzentren und Wohnquartiere nicht zu vernachlässigen.
- Quote paper
- Karsten Foth (Author), 2002, Berlin auf dem Weg zu einem neuen Zentrum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108362